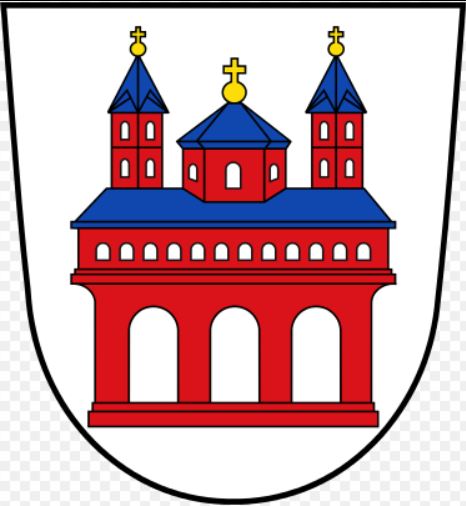Curtis B. Dall
Amerikas Kriegspolitik
Roosevelt und seine Hintermänner
Aus dem Englischen übersetzt von
Julius Albrecht
Zweite Auflage
1975
GRABERT-VERLAG • TÜBINGEN
Titel der im Verlag Cathedral of the Christian Crusade, Tulsa, Oklahoma, erschienenen Originalausgabe: „FDR, My Exploited Father-In-Law”
ISBN 3 87847 026 6
Alle Rechte der Verbreitung in deutscher Sprache auch durch Film, Funk, Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger aller Art oder durch auszugsweisen Nachdruck sind vorbehalten.
(c) 1972 by Grabert-Verlag, 74 Tübingen Satz und Druck: Gulde-Druck, Tübingen Buchbindearbeiten: Großbuchbinderei Lachenmaier, Reutlingen
Inhaltsverzeichnis
| Geleitwort von Prof. App | 7 | |
| Einführung | 12 | |
| 1. Kapitel: | Die Begegnung mit Franklin Roosevelts Familie | 17 |
| 2. Kapitel: | Franklin D. Roosevelt I | 32 |
| 3. Kapitel: | Die Wall Street Jahre I | 37 |
| 4. Kapitel: | Ein Sommer auf dem Warburg-Gut | 44 |
| 5. Kapitel: | Tarrytowns Nachbarn | 47 |
| 6. Kapitel: | Franklin D. Roosevelt II | 55 |
| 7. Kapitel: | Eleanor Roosevelt I | 61 |
| 8. Kapitel: | Eleanor Roosevelt II | 76 |
| 9. Kapitel: | Die Versammlung in Chicago und Senator Huey Long | 89 |
| 10. Kapitel: | Prof. Felix Frankfurter | 96 |
| 11. Kapitel: | Herrn Baruchs Besuch | 104 |
| 12. Kapitel: | Die Amtseinsetzung des Präsidenten am 4. März 1933 | 110 |
| 13. Kapitel: | Ein Frühstück mit Henry | 116 |
| 14. Kapitel: | Abschiedsrede an das Weiße Haus | 131 |
| 15. Kapitel: | Sara Delano Roosevelt: magna cum laude | 142 |
5
| 16. Kapitel: | Louis MC H. Howe | 157 |
| 17. Kapitel: | Die Panik - Joe Kennedys Blanko-Verkäufe - Tennesse-Gas geht gut | 166 |
| 18. Kapitel: | Der Pfennig-Baum | 188 |
| 19. Kapitel: | Franklin D. Roosevelt - Das Finale | 192 |
| 20. Kapitel: | Zwanzig Jahre später: Kapitän Earle hätte es aufhalten können | 217 |
| 21. Kapitel: | Mein Besuch bei Admiral Kimmel | 235 |
| 22. Kapitel: | Die Vereinten Nationen - ihr wahrer Ursprung, ihre Wurzeln und Zweige | 251 |
| 23. Kapitel: | Konservative, Liberale und die übrigen | 272 |
6
Prof. Dr. A. J. P. App über Oberst Dalls Buch
Oberst Dall stammt aus einer alten amerikanischen Familie. Seine Eltern gehörten den ersten Gesellschaftskreisen an. Dementsprechend wurde er erzogen und promovierte an der Ivy-League Princeton-Universität. Er war in beiden Weltkriegen Offizier und ebenfalls war er Mitglied an der New Yorker Börse. 1926 heiratete er Anna Roosevelt und erlebte als Schwiegersohn, wie ihr Vater Gouverneur von New York und dann Präsident von den Vereinigten Staaten wurde. Er mochte sowohl Roosevelt wie auch Frau Eleanor Roosevelt gern, am meisten aber schätzte er Roosevelts Mutter Sarah Delano. Er sprach Roosevelt einen ähnlichen Charme zu, wie andere Menschen ihn in gleicher Art Hitler zusprachen: Roosevelt „besaß großen persönlichen Charme, und wenn er jemanden gern hatte oder wollte, daß ihn jemand gerne hatte, so konnte er beinahe unwiderstehlich sein”.
Oberst Dall erbringt den Nachweis dafür, daß Roosevelt, um Präsident zu werden, sich den internationalen Finanzmächten verpflichtete. Diese haben ihn von Anfang an insofern ausgebeutet, als sie die Macht über die amerikanischen Goldreserven bekamen und ihn in den Zweiten Weltkrieg verwickelten, was schließlich zum Morgenthau-Plan und Yalta-Verrat führte.
Oberst Dall ist heute ein in den Vereinigten Staaten hochgeachteter und anerkannter Wortführer der amerikanischen Konservativen und des Antikommunismus. In dem vorliegenden Werk zeichnet er auf, wie es kam, daß er schmerzerfüllt die offensichtlichen Fehler und das Unrecht der amerikanischen Politik erkannte. Es fing an, als Woodrow Wilson, der auch den internationalen Finanzmächten
7
verpflichtet war, 1813 das Federal Reserve System und die gestaffelte Einkommen-Steuer einführte. Ersteres nahm widerrechtlich dem Kongreß die Macht, Geld zu drucken, und übertrug diese den internationalen Bankiers. Dies und den Council of Foreign Relations sieht er als die Hauptursachen an für die Einmischung Amerikas in die beiden Weltkriege und für den Erfolg des Kommunismus, eine Ansicht, die von den meisten amerikanischen Konservativen geteilt wird.
Interessanterweise zitiert Dall Wilson, wie dieser dem Senator Porter James McCumber, North Dakota, gegenüber bekennt, daß die Vereinigten Staaten auch dann in den Ersten Weltkrieg eingetreten wären, „wenn Deutschland keinen Krieg oder keine Ungerechtigkeiten gegen unsere Mitbürger begonnen hätte”. Nach Dall verkehrte Wilson „die auf Nationalismus und Vorteil gerichtete Politik unseres Landes in eine auf Internationalismus und Schuld gerichtete Politik”.
Oberst Dall, damals Makler in Wallstreet, glaubt, daß der Börsenkrach im Jahre 1929 absichtlich von den „Welt-Finanzmächten” herbeigeführt worden ist. „Durch die von ihnen geplante Knappheit an genügend täglichem Geld auf dem New Yorker Geld-Markt wurde er ausgelöst” in der Absicht, Präsident Hoover zur Abdankung zu zwingen, das Volk arm zu machen und sich selbst zu bereichern. Er erwähnt nebenbei, daß im August 1929 Bernard Baruch und Winston Churchill zusammen Frankreich und Schottland besuchten, daß aber am 24. Oktober, am Tage des Börsenkraches, Winston Churchill um 2 Uhr 15 auf der Besucher-Galerie der Börse erschien. Während Roosevelt für das Weiße Haus vorbereitet wurde, waren Prof. Felix Frankfurter, Henry Morgenthau jr. und Bernard Baruch auffallend häufig zu Besuch bei dem in Aussicht genommenen Präsidenten. Als im Januar 1933 ein Besuch Baruchs bei FDR gemeldet wurde, gab Baruch
8
dem jungen Dall zu verstehen, daß Silber eine «gute Geldanlage wäre, und daß er selber „ungefähr 5/16 des sichtbaren Weltvorrates an Silber besäße”. Einige Monate später nach der Amtseinsetzung von Roosevelt verbreitete sich an einem Wochenende die erschreckende Nachricht, daß der Kongreß, als eine freundliche Geste „gegenüber westlichen Silber-Bergbau-Staaten, das US-Finanzministerium ermächtigt hätte, den Preis für Silber am freien Markt zu verdoppeln”.
Oberst Dall ist der Ansicht, daß die gleichen Welt-Finanzmächte, die Wilson beeinflußt und auch den Börsenkrach ausgelöst hatten, den Zweiten Weltkrieg dazu zu benutzen beabsichtigten, Hitlers schnell anwachsendes Tauschhandelsprogramm für den Welthandel, der weitgehendst den ausgebreiteten Goldhandel vereiteln sollte, zunichte zu machen”. Er schreibt weiter, genau so wie Wilson es im Jahre 1917 tat, so „führte auch Roosevelt gegen den Willen und Wunsch der Mehrheit der Amerikaner uns in den Zweiten Weltkrieg”. Er zeigt uns, wie Roosevelt Vorbereitungen traf, um den Japanern Pearl Harbor als Lockmittel anzubieten. Luftschutz und Flugzeugträger wurden zurückgezogen, um die Japaner zum Angriff zu verleiten, so daß Amerika sozusagen durch eine Hintertür in den Zweiten Weltkrieg schlidderte. Im Kongreß erlitt Roosevelt dann Seelenqualen über den „Tag der Niedertracht”, zeigte dadurch dem Lande gegenüber ein vollkommen falsches Bild, ließ ungerechterweise Admiral Kimmel und General Short in Ungnade fallen, um seine eigene verbrecherische Kriegshetzerei zu verbergen.
Das sensationellste Kapitel ist das zwanzigste. Darin beschreibt Dall seine Unterredung mit dem früheren Gouverneur Earle von Pensylvanien. Als Earle Roosevelts Marineattache in Istanbul war, klopfte 1943 eines Morgens Admiral Wilhelm Canaris, der Chef des Deutschen Geheimdienstes, an seine Zimmertür im Hotel. Er erklärte
9
ihm gegenüber, daß viele patriotische Deutsche Hitler ablehnten und bereit wären, Frieden zu schließen, daß aber „bedingungslose Übergabe” etwas wäre, dem die deutschen Generale niemals zustimmen würden . . . Wenn Roosevelt nur andeuten würde, daß er eine ehrenhafte Übergabe der Deutschen Armee anzunehmen bereit wäre, könnte ein derartiges Ereignis zustande gebracht werden”. Die Deutsche Armee würde dann nur die Ostfront gegen eine rote Invasion zu verteidigen haben.
Dieser Vorschlag wurde in geheimen Sitzungen von dem Deutschen Gesandten Franz von Papen, einem frommen Katholiken, und von Baron Kurt von Lersner bestätigt. Das alles geschah achtzehn Monate vor der Landung in der Normandie am 8. Mai 1945. Immer wieder sprach Earle die Bitte Roosevelt gegenüber aus, sein Telegramm mit dem Vorschlag „einer ehrenhaften Übergabe” seitens der Deutschen zu beantworten. Aber unglücklicherweise hatte, so erklärt Earle, „starker Weißer-Haus-Einfluß das Ohr des Präsidenten dahingehend, daß das ganze deutsche Volk ausgemerzt werden sollte, ganz gleich, wieviele amerikanische Soldaten dabei ihr Leben noch opfern mußten … um dieses scheußliche Endziel zu erreichen”. Roosevelt schob diese Gelegenheit, den Krieg zu beenden, beiseite, ja deutete sogar darauf hin, daß Earles Vorschlag womöglich ein Verrat sein könnte und beorderte ihn nach dem Pazifik.
Die Morgenthau-Planer Morgenthau, Baruch, Harry Dexter White und Alger Hiss hielten, so meint Dall, Roosevelt gefangen. Der Krieg schleppte sich noch weitere achtzehn Monate hin und endete damit, daß die Sowjetrussen Budapest, Prag und Berlin besetzten, wo sie heute noch sind. Oberst Dall bedauert, daß Roosevelts Einmischung in den Zweiten Weltkrieg zusammen mit der bedingungslosen Übergabe Amerika 237 049 Tote und Vermißte, 571 000 Verwundete und 350 Milliarden Dollars gekostet, das
10
Land in eine ungeheure nationale Schuld gestürzt und keines der idealen Ziele erreicht habe, für die wir angeblich gekämpft haben. Genützt hat sie nur den Feinden des Christentums und dabei halb Europa und Asien unter kommunistische Tyrannei gebracht.
Dall berichtet, wie als Krone des Verrats Morgenthau, Harry Dexter White und Harold Glasser, alle vom US-Schatzamt (Finanzministerium), „unglaublicherweise Sowjet-Rußland unsere Druckplatten” mit Spezial-Papier und -Tinte gaben, „um unser Geld in Ost-Deutschland drucken zu können, um den russischen Soldaten für zwei Jahre ihre Löhnung zahlen zu können”, und auch um ausgewählte Flüchtlinge auf Kosten des amerikanischen Steuerzahlers zu bereichern. Es waren im ganzen 19 Milliarden Dollar.
Oberst Dall liefert uns die Bestätigung und auch Streiflichter und Einblicke von den tragischen Ereignissen der verflossenen vierzig Jahre. Als Roosevelts Schwiegersohn war er Zeuge vieler dieser Ereignisse, so daß es sich lohnt, sein Buch zu lesen, da es aus erster Quelle kommt. Und obgleich es auf jede Sensationshascherei verzichtet, ist es doch ein ungewöhnlich sensationelles Buch. Wenn in einem solchen Buch Sachinteresse mit unantastbarer Echtheit und Glaubwürdigkeit verbunden ist, dann verdient es dieses Buch, nicht nur von Amerikanern, sondern auch von Deutschen gelesen zu werden.
Austin J. App, Ph. D.
11
Einführung
Betrachten Sie bitte eine Münze, entweder sehen Sie da die zugewandte oder die Kehrseite; beide Seiten sind jedoch wichtig. Um nun für gewisse Zwecke ein Bild zu schaffen, ist es bei einem Gemälde nicht nötig, beide Seiten zu zeigen, sondern nur eine. Das, was auf diesem Bilde dann gezeigt wird, ist nur für die arglosen und nicht eingeweihten Menschen bestimmt, zu denen auch ich eine lange, lange Zeit gehörte. Ein so geschaffenes Bild soll absichtlich irreführen, die Opfer auf vorbestimmte Wege locken, dabei sehr häufig auf gefährliche und kostspielige Pfade.
Ich hoffe, daß der Leser dieses Buches sich die Mühe geben wird, beide Seiten unseres ideologischen und politischen Bildes im Hinblick auf wichtige Ereignisse zu betrachten, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Die eine Seite ist sichtbar, die andere verborgen. Die Menschen sind häufig durch irgendwelche Umstände in der Lage, Ergebnisse zum Guten oder zum Schlechten zu kombinieren und zu bewirken.
In diesem Buch ist sehr viel über Franklin D. Roosevelt, seine Frau und seine Mutter sowie über Mitglieder der Familie und ihre Umgebung mitgeteilt worden; ebenfalls sind andere weltbekannte Persönlichkeiten genannt, denen ich teilweise näher begegnet bin.
Einige meiner Leser werden von manchen meiner Beobachtungen überrascht sein. Ich brauchte nicht lange zu untersuchen, sondern war in der Regel dabei und nicht nur als Beobachter in den ersten Reihen. Daher werden gewisse Teile dieses Buches im Gegensatz zu machen anderen Büchern stehen.
Mai 1933 schrieb ich einen Artikel für eine New Yorker
12
Zeitung, die „Wall Street und Pennsylvania Avenue”. Ich schrieb darin meine Ansicht über die neue demokratische Regierung, deren Chef mein Schwiegervater Roosevelt war, unter Berücksichtigung von „Wall Street”.
Ich hatte eine Zeitlang in Wall Street gearbeitet, der sichtbaren Quelle unserer Finanz-Organisation in unserem Lande, und kannte daher Wall Street sehr gut. Da ich jedoch keinen für die Regierung zu kritischen Artikel schreiben wollte, zeigte ich ihn meinem guten Freunde Basil O’Connor, einem früheren juristischen Teilhaber des Präsidenten und bat ihn um seine Meinung.
„Doc”, wie ich ihn nannte, las ihn und schaute gedankenvoll aus dem Fenster, dann sagte er: „Curt, der Artikel ist gewiß sehr interessant. Wenn du aber wirklich vorhast, ihn an eine Zeitschrift zu verkaufen, dann bitte an mich.” Diese Bemerkung, welche keine Herabsetzung meiner knospenden literarischen Talente bedeutete, zeigte mir jedoch ganz klar, daß er ihn für viel zu kritisch gegenüber der neuen Regierung hielt, vor allem da er von mir, einem Verwandten des obersten Beamten, und damit aus gut unterrichteter Quelle kam.
Erschrocken sagte ich: „Gut, Doc, wenn das deine Meinung ist, wird ,Wall Street und Pennsylvania Avenue’ niemals veröffentlicht werden.” Er wurde es nicht. Ich zerriß ihn.
Dieses Gespräch wurde in Docs Büro am Broadway 120 in New York vor dreiundreißig Jahren, also vor einer ziemlich langen Zeit, geführt. Inzwischen sind viele wichtige Ereignisse geschehen, manche darunter von wesentlicher Bedeutung für uns alle. Zahlreiche damals handelnde Personen sind inzwischen gestorben.
Zurückblickend sollten wir uns immer vor Augen halten: „Die Vergangenheit ist das Vorspiel - das Vorspiel für morgen!” Das amerikanische Volk ist weder dazu erzogen noch dressiert, zum international denkenden Intriganten
13
zu werden. Daher sind wir die regelrechten Opfer jener geworden, die nach der oben genannten Weise erzogen und dressiert worden sind. Es kommt noch hinzu, daß wir als Volk stark zum Hedonismus neigen, dabei besessen von Vergnügungen. Hierzu werden wir noch täglich durch unsere vom Ausland beeinflußte Presse, Radio und Fernsehen ermutigt und „geformt”. Auch werden wir ermutigt, uns aus den unersichtlichen Gründen ausgesprochener Weltplaner von Plattheiten in Anspruch nehmen zu lassen. Viele von uns wiegen sich in dem Gefühl, daß unsere politische Lage, ja selbst unsere Freiheit und unser Recht in den Vereinigten Staaten gesichert seien. Doch haben wir mit unserem großen Amateur-Internationalisten Woodrow Wilson im Jahre 1913 unsere gefährlichen Plätze auf seinem ruchlosen, politischen Schlitten eingenommen, und jetzt nähern wir uns dem Ende dieses katastrophalen Rennens.
Dann kam das zweite katastrophale Schlittenrennen mit FDR und seinen Nachfolgern. Wohin geht jetzt die Reise? Lassen wir uns nicht zum Narren halten! Doch werden uns Wohlstand, Freiheit und Recht langsam, aber sicher gestohlen und ständig angenagt. Wir, die wir heute alles schlucken, nehmen viele überbezahlte politische „Wohltaten” mit in Kauf, die natürlich alle mit unserem sauer verdienten Gelde bezahlt sind. Auch werden wir heute dazu getrieben, uns in die Angelegenheiten anderer Nationen zu mischen, was natürlich für die internationale Hochfinanz einen schönen Profit abwirft, zumal da sie über Kredite und Märkte genau Bescheid weiß. Ob man es glauben will oder nicht, es ist alles auf diese Art und Weise für uns so geplant worden.
Hinzu kommt noch, daß unsere Heimat mit einer Unzahl geschickt zurecht gemachter Biographien überflutet worden ist und noch überflutet wird. Sie sind über viele gewichtige, im öffentlichen Leben stehende Bürger sorgfältig ge-
14
schrieben worden mit dem Ziel, gewisse auf weite Sicht geplante internationale politische Maßnahmen zu fördern. Wenn wir dieses alles geschehen lassen, werden falsche Vorstellungen und „zurecht gemachte Nachrichten” ein freies Volk sehr bald zugrunde richten.
In den dreißiger Jahren haben diese uns allerlei Bilder vorgaukelnden Manager um ihrer egoistischen Zwecke willen das Wort „Isolationist” enthüllt, nur um uns irrezuführen. Isolationist bedeutet, sich von anderen fernhalten. Haben unsere Vorfahren nicht gerade aus diesem Grunde große physische Härte und Entbehrungen auf sich genommen, als sie von weit her zu unseren Küsten kamen? Haben sie nicht immer versucht, sich aus den verschiedenen Konflikten der Alten Welt herauszuhalten und sie zu vermeiden? Nun aber haben es die gerissenen Emissäre der European Central Bank Debt Financing fertig gebracht, sich mit Erfolg unserer Wirtschaft zu bemächtigen.
Die Worte „Isolationist” und „Isolationismus” sind auch hier so ständig mißbrauchte Begriffe, daß sie langsam zu „schmutzigen” Worten werden. Diese „Förderung” hat sich für die „Ein-Weltler” als sehr erfolgreich erwiesen, doch uns ist sie sehr teuer zu stehen gekommen. Unsere Menschenfreundlichkeit gegenüber anderen Völkern kann gar nicht in Frage gestellt werden. Sie hat in der ganzen Weltgeschichte nicht ihresgleichen.
Es wird fraglos auch viele geben, die mit manchen in diesem Buch niedergeschriebenen Beobachtungen nicht übereinstimmen. Das soll mir recht sein. Auf jeden Fall sollten sie sich melden, nicht um zu widersprechen oder zu mißbilligen, sondern um zu verbessern.
Meine einzige Bitte hierzu ist, daß die wohlbekannte und so häufig als Argument gebrauchte „Verleumdungs-Technik” durch Tatsachen ersetzt wird, und nicht durch Verleumdungen, die an Erpressungen grenzen, wenn sie von
15
irgendjemandem, einschließlich gut bezahlten Zeitungsartikel-Schreibern, vorgenommen werden kann. Ich habe nicht vor, zurückzuweichen.
Ich erinnere mich gut einer sinnigen Bemerkung: „Es ist besser, eine einzige Kerze in einem dunklen Räume anzuzünden, als ewig im Dunkel zu leben!” Ich hoffe, daß diese meine bescheidene „Kerze” hell leuchten möge und meinen Landsleuten, ja auch Menschen anderer Länder, von Nutzen sein wird. Dann mag der „dunkle Raum” wohl dadurch ein bißchen „heller” werden.
16
Erstes Kapitel
Die Begegnung mit Roosevelts Familie
Die von Zahllosen ausgesprochenen Meinungen über Roosevelt unterscheiden sich erheblich voneinander. Einige halten ihn für einen Helden, andere dagegen für einen Schuft. Diese Verschiedenheit kommt auch in der Bewertung einzelner Ereignisse zum Ausdruck, die als Ergebnis seiner sehr ausgedehnten politischen Tätigkeit entweder als gut oder als verheerend angesehen werden. Nur in einem Punkt herrscht Übereinstimmung: Roosevelt besaß großen persönlichen Charme. Wenn er jemanden mochte oder wünschte, daß jemand ihn gern haben sollte, konnte er beinahe unwiderstehlich sein.
Als ich zum ersten Male im Hause seiner Mutter in Hyde Park an einem Dezemberabend bei einem Essen neben ihm saß, fühlte ich sofort die ganze Kraft seines bestrickenden Wesens; es galt jedoch nicht mir allein, sondern einer Gruppe junger Menschen, die von seiner Tochter Anna zu einer Neujahrsfeier eingeladen worden waren. Ungefähr vier Monate später traf ich wieder bei einem Essen mit Roosevelt in seinem Büro zusammen, und zwar bei einer besonderen Gelegenheit: Er war Vize-Präsident der Fidelity and Deposit Company im Wall-Street-Bezirk in New York. Es war Ende März 1926, als ich ihn um die Hand seiner Tochter Anna bat in der Hoffnung, daß er mich als seinen künftigen Schwiegersohn anerkennen würde. Natürlich wußte er bereits Bescheid, so daß ich keine Absage erwartete, zumal da sein Benehmen mir gegenüber immer sehr herzlich gewesen war. Sind doch manche Väter bei solchen Gelegenheiten etwas schwierig.
17
Anfang des vergangenen Dezembers hatte ich Anna auf einer Gesellschaft bei Herrn und Frau Walter Douglas in ihrem Hause in der 5ten Avenue der Upper Seventies kennengelernt, die sie für ihre beiden Töchter Elisabet und „Kay” gaben. Unsere beiden Familien sind seit langem in Arizona befreundet gewesen.
Als Präsident einer großen Eisenbahngesellschaft war Herr Douglas ein überaus beschäftigter Mann. Am Wochenende auf dem Lande, spielte er genau so gern Tennis wie ich, und so wurden wir gute Freunde. An jenem Abend waren ungefähr zehn junge Leute bei Douglas, um nachher zu einem Weihnachtsball ins Ritz-Carlton-Hotel zu gehen. Unter den Gästen war ein ziemlich großes blondes Mädchen. Kay Douglas hatte mich zwar bei meiner Ankunft mit anderen im Empfangszimmer vor dem Essen vorgestellt, aber ich hatte den Namen nicht verstanden. Entzückt von ihrem freundlichen Lächeln und ihrem lebendigen Wesen, fragte ich Kay nach dem Essen nochmals, wie sie heiße. „Anna”, antwortete sie. „Anna Banana, so haben wir sie in der Schule genannt.” Als sie meinen etwas verwunderten Blick sah, lachte sie und fügte hinzu: „Sie heißt Anna Roosevelt, wir waren in Chapins Schule zusammen.”
„Gehört sie zu den Roosevelts in der Oyster Bay, Long Island?” fragte ich. „Nein, sie wohnt am Hyde Park, den Hudson hinauf und lebt hier in der Stadt mir ihren Eltern in der 65sten Straße.”
Als eine Stunde später die Tänzer in einem großen Kreis um eine Gruppe partnerlosen Herren tanzten, die zufällig in der Mitte des Saales standen, sah ich Anna, die mir beim Essen gegenüber gesessen hatte, an mir vorbei tanzen. Offenbar bemerkte sie mich in der Reihe der herumstehenden Herren und gönnte mir ein freundliches Lächeln, das ich erwiderte und sofort zu ihr hinging, um sie ihrem Partner wegzunehmen. Der erste Tanz führte zu ei-
18
nem zweiten, und so eröffnete sich für mich ein neuer Lebensabschnitt. Er führte mich zu jener besonderen Gelegenheit, die mich vier Monate später in New York im Büro der Fidelity and Deposit Company von Baltimore in einer ihrem Vize-Präsidenten Franklin Roosevelt angemessenen Umgebung wiederfand. Dank seiner zahlreichen Freunde und früheren politischen Verbindungen wurde er in seinem Finanz-Geschäft sehr geschätzt. Der Chef der Gesellschaft in Baltimore war sein Freund Van Lear Black.
Roosevelts Büro war ziemlich ungewöhnlich. Die Wände waren mit Marinebildern bedeckt, was allerdings nicht überraschend war, da er im Ersten Weltkriege als zweiter Sekretär unter Josephus Daniels bei der Marine gedient hatte. Einige Bilder von der Marine-Fliegerei interessierten mich besonders, weil ich im Ersten Weltkriege in England und Frankreich 1918 und 1919 bei den US-Marine-Fliegern gedient hatte.
Mein zukünftiger Schwiegervater begrüßte mich herzlich bei meinem Eintreten. Er saß behaglich in einem großen Ledersessel hinter seinem Schreibtisch ohne seine Beinschienen. Sobald ich ihm gegenüber Platz genommen hatte, bestellte er ein Frühstück für uns. Es wurde auf zwei Tabletts auf seinem Schreibtisch serviert. Wie ich mich noch erinnere, begann es mit einem großen Glas Tomatensaft. Da wir beide in Wall Street arbeiteten, wenn auch auf unterschiedlichen Gebieten, kamen wir gut miteinander aus und fachsimpelten. Er sprach über Männer, die uns beiden bekannt waren, und fragte mich nach meiner Stellung bei der Bank-Firma Lehman Brothers, die damals ihren Sitz in der Nähe im Old Farmers Loan und Trust Building Company hatte. Ich erklärte ihm, daß ich damit beschäftigt sei, eine Allgemein- oder Syndikatabteilung für die Firma zu organisieren, die den Großverkauf von jungen Aktien und Emissionen von Obligationen an zahlreiche
19
Versicherungsagenten in den verschiedenen Städten für den Weiterverkauf an ihre eigenen privaten Kunden einschließen sollten. Er fragte mich nach den Teilhabern der Firma, und ich nannte ihm Herbert Lehman und John Hancock, an die er sich noch vom Ersten Weltkrieg her in Washington erinnerte.
Bei Betrachtung seiner Bilder, Schiffe und Flugzeuge brachte ich das Gespräch dann auf Marine- und Segelflugzeuge, wobei ich ihm eine nie vergessene Geschichte erzählte, die ich Ende des Krieges in Frankreich erlebt hatte. Das interessierte ihn so stark, daß ich es hier wiedergeben möchte. Es handelte sich um Woodrow Wilsons Ankunft in Brest in Frankreich, Mitte Dezember, auf seinem Wege nach Paris und zur Friedenskonferenz im Jahre 1918. Der Schauplatz war der mit allen möglichen Schiffen überfüllte Hafen von Brest, die heftig im stürmisch aufgewühlten Wasser umhertanzten. Inmitten dieser Schiffe lag für sich allein die „George Washington” in grauer Kriegsbemalung. In Brest waren die Straßen überfüllt und von vielen Häusern wehten die Fahnen der Alliierten. Die felsigen Hügel über dem Hafen waren dunkelbraun und mit Tausenden amerikanischer Soldaten, Seeleuten und Marinern bedeckt, nicht zu vergessen die aufgestellten Truppen der verbündeten Nationen. Das war alles zu Ehren der Ankunft des Präsidenten der Vereinigten Staaten in Frankreich geschehen. Der Krieg, „die Welt reif für die Demokratie zu machen”, war vorbei. Woodrow Wilson war auf dem Weg zur Pariser Friedenskonferenz, und die Welt schien auf der Schwelle einer neuen Friedensepoche zu stehen. Die ganze Atmosphäre war gespannt. Die Erregung ging hoch und die lang zurückgehaltenen Gefühle füllten die Herzen der versammelten Truppen und Bürger.
Ich war als Fähnrich in dem US-Marine-Fliegerhorst in Guipavas, ungefähr acht Meilen von Brest, stationiert und
20
war auf fürchterlich schmutzigen Wegen gereist in der Absicht, unseren Präsidenten willkommen zu heißen. Da ich auf einem hohen Felsen stand, von dem aus die Vorgänge gut zu überblicken waren, konnte ich alles sehr gut beobachten. Nicht weit hinter mir stand der Sonderzug für den Präsidenten nach Paris. Die Maschine stampfte schwer, ihre Messingteile waren auf Hochglanz gebracht. Der hintere Aussichtswagen hatte ungewöhnlich lange Fensterscheiben. Um den Zug herum war der übliche rote Teppich, auf dem die höchsten Würdenträger Europas in ihren glänzenden Uniformen standen.
In diesem Augenblick kam eine Barkasse vom Außenhafen an den Wellenbrechern vorbei zur Landungsbrücke unter mir, die im Rhythmus mit der Wintertide stieg und fiel. Mit Hilfe einiger Seeleute entstiegen der Barkasse zwei Menschen, ein Mann und eine Frau. Es waren der Präsident und Mrs. Wilson. Sie stiegen die Treppe hinauf, die zur Spitze des Felsens führte, wo wir zusammengedrängt standen. Plötzlich kippte der nasse Steg, der Präsident verlor die Balance, rutschte aus und wäre gefallen, wenn seine aufmerksame Begleitung ihn nicht aufgefangen hätte.
Mir schien es sehr lang, bis sie endlich oben waren. Dort, direkt vor mir, stand der Präsident der Vereinigten Staaten. Sein Gesicht unter einem glänzenden Zylinder erschien mir sehr düster. Mrs. Wilson trug einen mit einer Orchidee geschmückten schwarzen Seehundsfell-Mantel. Sie verhielten einen Augenblick, etwas benommen durch die Menge, dann hob der Präsident seinen Hut und verbeugte sich. Aus allen Militär-Kapellen klang das „Star Spangled Banner”. Es war überwältigend. Tränen stiegen mir in die Augen, und ich hatte schwer zu schlucken. Als die letzten aufwühlenden Töne in der kalten, winterlichen Luft verklangen, schoß mir ein Gedanke blitzartig durch den Kopf: Das Land der Freien, „die Heimat der Tapfe-
21
ren”, so sollte es auch weiterhin sein! Der Rest des Schauspiels fiel dagegen ab. Die Kapellen spielten andere Nationalhymnen. Es wurde viel salutiert und Hände geschüttelt, und bald fuhr auch der Sonderzug mit seiner glänzenden Begleitung nach Paris zu der Friedenskonferenz ab. Keiner ahnte, welche furchtbare Enttäuschung ihrer dort harrte.
*
Für diese Geschichte zeigte FDR großes Interesse. Den Grund dafür erfuhr ich erst viel später. Er fragte mich in jeder Richtung aus über alles, was ich gesehen hatte, besonders über diejenigen, die an den Willkommenfeierlichkeiten teilgenommen hatten. Leider konnte ich ihm nicht über Einzelheiten berichten, da ich damals noch ein junger Fähnrich war und mir die hohen diplomatischen und militärischen Persönlichkeiten unbekannt waren. Er gab mir keine Erklärung für sein persönliches Interesse an diesem Schauspiel. Erst viel später erfuhr ich, daß er eine kleine Rolle auf der Friedenskonferenz gespielt hatte.
Die „George Washington” fuhr darauf nach den Vereinigten Staaten zurück und als Zweiter Sekretär der Marine war Franklin D. Roosevelt dabei. Er kam nicht wieder zurück, um den entscheidenden diplomatischen Sitzungen als Vertreter der Marine beizuwohnen, da Minister Daniels den Admiral William S. Bemson für diese Aufgabe bestimmt hatte. Er schickte jedoch den Zweiten Sekretär der Marine nach Europa, um bestimmte Marinestützpunkte einrichten zu helfen, wodurch Roosevelt Gelegenheit hatte, nach Paris zu fahren, um einigen Konferenzen beizuwohnen. Diese Reise machte er in Begleitung seiner Frau sowie unter anderen auch mit Bernard Baruch, Charles Schwab und John Hancock auf der „George Washington”; über Hancock hatten wir bereits beim Frühstück gesprochen.
22
Auf der Rückreise nach den Vereinigten Staaten fuhren sowohl Roosevelt wie auch Präsident Wilson auf der „George Washington”. Zu Roosevelts großer Freude lud ihn Präsident Wilson ein, ihn in seiner Kabine aufzusuchen, um gewisse Punkte über den Vertrag des Völkerbundes mit ihm zu besprechen, die Wilson dem Senat zur Anerkennung vorlegen wollte. Es ist eine geschichtliche Tatsache, daß Roosevelt in der Folge ein lebhafter Verfechter des Wilsonschen Völkerbundes wurde. Fraglos hatten die Gespräche auf dem Schiff viel dazu beigetragen.
Bei unserm Frühstück hörte ich indessen nicht viel darüber. Er erzählte mir nur, daß er als Zweiter Sekretär der Marine den Marine-Fliegerstützpunkt in Guipavas inspiziert hätte und den Kommandanten Landsdown, meinen Kapitän, kannte. Dann sagte er: „Curt, ich kenne deinen Onkel Neely Agnew. Ist er immer noch bei der Farmers Loan and Trust Company?” Ich bejahte dies und sagte ihm, daß ich ihn sehr gern hätte und er mir geraten hätte, nach Princeton zu gehen. Onkel Neely war Mitglied der Klasse von 1891.
Roosevelts Besuch in Harvard und sein scharfsinniger Humor wurden mir bei seiner nächsten Frage bewußt: „Nun, Curt, wo liegt eigentlich jene Hochschule?” Ziemlich gleichgültig sagte ich, sie läge in einer ländlichen Gegend in der Nähe einer kleinen Stadt in New Jersey. Jetzt aber kam ich an die Reihe, als ich mit Nachdruck hinzufügte: „Sie müßten eigentlich davon gehört haben, da wir jeden zweiten November unsere Junior Varsity Fußballmannschaft nach Cambridge gegen Harvard schicken.” Roosevelt, über die Schlagfertigkeit meiner Antwort in hohem Maße erfreut, warf seinen Kopf zurück und lachte laut auf.
Nach dem Frühstück verabschiedete ich mich, jedoch die Erinnerung an jene freundschaftliche Gelegenheit blieb mir stets in angenehmer Erinnerung, viel angenehmer als
23
die späteren formellen und weniger vertraulichen Mahlzeiten mit FDR und den zahlreichen Familienmitgliedern. Ich betone das Wort „später”. Als ich ihnen zuerst begegnete, waren die Franklin Roosevelts eine kongeniale Familie, wie man sie selten trifft. Sie waren sehr sympathisch und hielten zueinander, freundlich auch gegen andere Menschen in einer angenehmen Atmosphäre. Bei meinem ersten Besuch im Hause von Frau James Roosevelt in Hyde Park hatte ich Gelegenheit, dies zu erfahren. Es war bald nach meiner Zusammenkunft mit Anna auf dem Wohltätigkeitsball. Sie lud mich ein, das Wochenende in Hyde Park zu verbringen, da sie einen Hausball für das kommende Neujahr geben wollte. Mit Vergnügen nahm ich die Einladung an und zusammen mit einigen Freunden fuhr ich mit dem Nachmittagszug von New York nach Poughkeepsie. Zwei Wagen holten uns von der Bahn ab. Der eine war für die Gäste, der andere für Gepäck, Schlittschuhe, Hockeystöcke und für die umfangreiche Winterkleidung. Nach fünfzehn Minuten Fahrt kamen wir in einen durch große Bäume begrenzten langen Heckenweg, an dessen Ende ein geräumiges, aus Stein gebautes und mit Stuck verziertes Haus stand mit einer auf Säulen ruhenden Vorhalle. Die Wagen fuhren in einem großen Kreis vor und die Gäste wurden an der Tür herzlich von Frau Roosevelt begrüßt. Bald kam auch ihre Schwiegermutter, Frau Roosevelt, hinzu und bat uns nach dem Kofferauspacken in das große Wohnzimmer zum Tee. Ein sehr großer Weihnachtsbaum beherrschte das eine Ende des Wohnzimmers. Am anderen Ende war ein großer Kamin mit einem knisternden Feuer, vor dem wir zum Tee Platz nahmen.
Obwohl das Wohnzimmer sehr geräumig war - es reichte von der Frontseite des Hauses bis an das Ende - war es sehr anheimelnd, wahrscheinlich der getäfelten Wandbekleidung und der vielen Bilder wegen.
24
Roosevelt erschien erst kurz vor dem Abendessen. Gerufen durch den sonoren Klang einer großen chinesischen Tempelglocke in der Halle, trafen sich alle im Eßzimmer. Roosevelt erschien in seinem Rollstuhl und nahm an dem einen Ende der großen Tafel Platz, seine Mutter am anderen Ende ihm gegenüber und seine Gattin ihm zur Seite in der Mitte.
Gegenüber den jungen Leuten zeigte er sich sehr freundlich und aufgeschlossen, aber ich mußte immer daran denken, daß in seinen Augen ein gewisser trauriger Blick lag. Auch hatte ich den Eindruck, daß er trotz seiner vorgetäuschten Herzlichkeit unsicher war. Auch andere Menschen, die ihn in jenen Tagen kannten, merkten, wie tapfer er versuchte, die schwere körperliche Katastrophe, die ihn 1921 ereilt hatte, zu überwinden. Ich bewunderte ihn deswegen.
Die Roosevelt-Jungen waren ebenfalls alle zugegen, und da sie, mit Ausnahme von Jimmy, noch etwas zu jung für unsere Gruppe waren, blieben sie ein wenig abseits. Ich mochte sie sofort leiden. Jimmy und Elliot waren von Groton für die Weihnachtsfeiertage nach Hause gekommen und Franklin und Johnny für die Ferien von Buckley, einer Privatschule in New York City. Johnny, noch ein Kind, betrachtete die Gäste mit einem gewissen Argwohn als etwas ungewöhnliche Erscheinungen, und es war ihm unerfindlich, daß diese seine große Schwester interessant finden könnten.
Nach dem Essen gingen wir zu Archibald Rogers Wohnung, ganz in der Nähe. Ihre Sylvestergesellschaften waren berühmt. Der alte Rogers schien mir als Gastgeber etwas kalt und mürrisch, aber seine Frau, eine gute Freundin von Frau James Roosevelt, war freundlich und entgegenkommend, genau so wie ihr Sohn Edmund, der in der Jugend ein enger Freund von FDR gewesen und Annas Pate war. Trotz der engen Verbindung zwischen den beiden Familien blieb FDR nicht lange bei dieser Sylvester-
25
gesellschaft. Anna erzählte mir, er hätte das Gefühl, er fiele in seinen schweren Schienen auf, weshalb es ihm auch schwer fiele, sich zu bewegen.
Wie sehr sein Gebrechen ihn quälte, wurde mir erst am nächsten Tage in der Kirche bewußt. Wir wohnten dem Sonntagsgottesdienst der in der Nähe gelegenen St. James Episcopal-Kirche bei, in der FDR senior Kirchenvorsteher war. Das schöne, alte Gebäude entzückte mich, besonders war ich an dem großen Friedhof hinter der Kirche interessiert; die dort auf den alten Grabsteinen eingemeißelten Namen ließen mich wie in „Wer ist Wer” die in Hudson River Valleys wohnenden führenden Familien lesen.
FDR erschien früh und ging, auf seine Krücken gestützt, das Seitenschiff entlang zu seinem Platz vorne links. Da ich an diesem Morgen direkt hinter ihm saß, konnte ich genau sehen, wie schwer er auch hier unter seiner damaligen Kinderlähmung litt. Es wurde alltäglich, als ich es wiederholt sah, aber jedesmal gab es mir einen Schock, ich konnte mich nicht daran gewöhnen.
Die Stahlschienen, die Roosevelt tragen mußte, waren in der Mitte an seinen Schuhen befestigt und beim Stehen an seinen Kniegelenken festgeschnallt. Beim Sitzen mußte er jedoch die Schlösser selbst lösen, eins nach dem anderen. Das tat er auch, als er vor mir in der Kirche saß. Wenn die Schlösser gelöst waren, mußte er jedoch sitzen bleiben, bis er aufstehen mußte. Dann hatte er seine Beine auszustrecken, die Schlösser zu befestigen. Schließlich mußte ihm jemand beim Aufstehen helfen und ihm eine seiner Krücken nach der anderen geben. Das war für ihn eine häßliche Plage, die er in der Öffentlichkeit so weit wie möglich zu vermeiden suchte.
Ich merkte auch, daß ihm beim Sitzen geholfen werden mußte, die steifen Schienen zu lösen. Er mußte warten, mit beiden Beinen noch steif und unbequem sitzend, bis die Schlösser an den Kniegelenken gelöst wurden. Dann
26
konnte er sich erst ordentlich hinsetzen und seine Beine biegen.
So vermochte er auch nicht aufzustehen und die Hymnen mit der Gemeinde zu singen; an seiner Unruhe konnte man erkennen, wie peinlich ihm diese Situation war, obwohl er ein gleichmütiges Verhalten vortäuschte. Nach dem Gottesdienst wartete er, bis die meisten Menschen fort waren. Dann löste er seine Schienen, ich half ihm aufstehen und hielt ihn an den Armen, bis man ihm die Krücken reichte, und nachdem er sie in die richtige Lage gebracht hatte, ging er sehr langsam das Seitenschiff hinunter. Draußen warteten einige seiner alten Freunde auf ihn, die wußten, wie empfindlich er war, um ihn zu begrüßen und mit ihm zu sprechen. Seine augenscheinlich sehr beliebte Mutter war bald von einer Gruppe ihrer Freunde umgeben und man sah, wie ihr Lächeln und Grüßen allen galt. Von Anfang an war ich von dieser prächtigen, alten Dame entzückt. In meinen Augen war Sara Delano Roosevelt die hervorragendste Persönlichkeit der Hyde Park-Roosevelts.
*
Ich erinnere mich einer der glanzvollsten Wochenendgesellschaften gelegentlich einer zwanglosen und freien Hockeypartie, die wir auf Archibald Rogers zugefrorenem Teich spielten. Er lag in der Nähe ihres Herrenhauses mit einer Aussicht auf den Hudson und auf den Fluß selbst. Der von hohen Bäumen ganz und gar umgebene Teich war vier Morgen lang und breit und bildete eine ideale künstliche Eisbahn. Die Roosevelt-Mannschaft, bestehend aus der Familie und den Gästen, spielte gegen die Rogers-Mannschaft und ihre Gäste. Der Führer der Rogers-Mannschaft war der ehrwürdige „Pa” Corning von der berühmten Corning-Glass-Familie. Ihm zur Seite stand Edmond Rogers, denn „Pa” war schon älter und spielte
27
ziemlich behutsam, aber doch in einer überraschenden Art. Sein Spieleifer wurde von allen bewundert.
Von der Roosevelt-Mannschaft wurde ich zum Kapitän gewählt, obgleich ich mit einem Hockeystock nicht gut umgehen konnte. Während des Spieles wurde es klar, daß die Roger-Mannschaft uns überlegen war, vor allem dank der machtvollen Hilfe ihrer Gäste, die offenbar an der Hochschule Hockey gespielt hatten. Als die Sonne unterging, riefen uns die Mädchen zu, das Spiel zu beenden. Es war Zeit, nach Hause zu gehen. Die Mädchen - Anna, Kay Douglas, Helen Douglas Robinson, Annas Kusine und eine Großnichte von Teddy Roosevelt - drängten die Spieler zum Aufhören. Wir gingen zurück zum großen Kamin in Roosevelts Wohnzimmer, um Tee zu trinken. In Roosevelts Haus wurde kein Alkohol angeboten, aber ich erinnere mich, wieviel bei der Rogers-Sylvestergesellschaft trotz der Prohibition getrunken worden war.
Am Sonntagnachmittag, dem zweiten Neujahrstag, ging die Hausgesellschaft auseinander. Die meisten von uns fuhren mit dem Zug nach New York zurück. Ich begann, ernsthaft an Anna zu denken. Zurückblickend weiß ich, daß meine Gedanken von dem Gefühl beherrscht wurden, daß die Roosevelt-Familie die glanzvollste Familie war, der ich je begegnet bin.
*
Nach meiner Rückkehr ins bürgerliche Leben vom Überseedienst im Ersten Weltkrieg arbeitete ich erst für eine Bank in Wall Street, dann für verschiedene Maklerfirmen. Später wurde ich Geschäftsführer der Syndikats-Abteilung der Firma Lehmann Brothers.
Obgleich es in New York mit seinen Abendgesellschaften sehr lebhaft zuging, ließ ich mir dennoch jeden Donnerstag Abend Zeit für die Schwadron „A”. Es war ein Exerzierabend für die „C”-Truppe, bekannt als Teil jener berühm-
28
ten Nationalgarde. Die Schwadron „A” war sehr traditionsreich, was sich in der früheren Spick- und Spandisziplin und durch gutes Reiten widerspiegelte. In der „C”-Truppe war ich zunächst einfacher Soldat und wurde nach einer gewissen Zeit Trompeter.
Es wurde geritten, und wenn wir zu Pferde exerzierten, ritten wir ins Sommerlager. Da wir viel mit Pferden zu tun hatten, rochen wir auch nach Pferd. Wie viele meiner Kameraden, so hatte auch ich das Gefühl, daß die uns von der Regierung gegebenen Pferde von West Point als zu jung ausgemustert waren. Darum schien es für einen Reiter notwendig, abends zum Exerzieren rechtzeitig zu kommen, um sich das bestmögliche Pferd auszusuchen. Sonst konnte es vorkommen, daß man auf dem Rücken eines Pferdes landete, das den Exerzierabend zur Hölle machte. Mit einem dieser ungestümen Pferde machte ich einmal einen Ritt in der 59sten Straße, den ich nie vergessen werde. Wir waren gerade am Hotel Plaza vorbeigekommen und ritten Westwärts nach Camp Dix, als mein unruhiges Pferd, das sich schon die ganze Zeit über gebäumt und widerspenstig gezeigt hatte, auf einer Straßenbahnschiene, die zwecks besserer Sicht zwischen Katzenköpfen eingelegt war, ausrutschte, auf beide Kniee und auf die Nase fiel. Ich selbst flog über seinen Kopf zehn Fuß weiter und schlug mit meinem Kinn auf das Pflaster. Von diesem seltsamen Schauspiel werden die Zuschauer in der 59sten Straße sicherlich sehr beeindruckt gewesen sein. Ich selbst aber hörte nur die begeisterten und aufmunternden Zurufe meiner Kameraden: „Oben bleiben, oben bleiben!”
Als Junggeselle war das Leben in den ersten zwanziger Jahren in New York sehr interessant. Die militärische Tätigkeit bei der Schwadron „A” machte mir Spaß. Vor allem das nette Beieinander ihrer Mitglieder Roland Palmedo, Dick Lamarche, Pete Voorhis, meiner Vettern Rea
29
Agnew und Julian Romaine und noch vieler anderer. Der Chef der Gruppe „C”, Georges Matthews, war ein ausgezeichneter Offizier, wirklich ein Offizier unter Offizieren. Die meisten von uns waren ja Überseeoffiziere, Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg. Außerhalb der Welt dieses kongenialen Mannes und meiner Tätigkeit in Wall-Street gab es noch die angenehme gesellschaftliche Seite von New York: Ausfahrten in einem offenen Wagen im Central Park, wenn man ein Mädchen nach einer Gesellschaft nach Hause begleitete, unendlich viele Bälle und Gesellschaften und Wochenendbesuche auf dem Lande bei den Vettern. Während des Sommers wurde viel geritten und Tennis gespielt. Im Herbst waren die Sonnabende ausgefüllt mit Fußball. Das bedeutete vergnügte Fahrten nach Princeton, für Klassenzusammenkünfte und um aufregenden Ereignissen auf dem Rasen beizuwohnen und mit alten Freunden zusammen zu kneipen.
Nicht lange nach dieser Sylvesternacht erhielt ich wieder eine Einladung nach Hyde Park, der ich Folge leistete. Sie führte mich im März 1926 zum Frühstück mit FDR als seinen von ihm vorgesehenen Schwiegersohn. Anfang Juni gab es eine Hochzeit in Hyde Park. Kay Douglas war Brautjungfer und ihre Schulfreundin, „das große blonde Mädchen”, war die Braut.
Politische Fragen interessierten mich damals - 1926 - nur wenig. Ich glaubte, was die wichtigeren Kandidaten in den öffentlichen Ämtern den Presseberichten zufolge sagten und erwartete von ihnen, daß ihre öffentlichen Erklärungen und Zusagen, die sie den Leuten am Wahltag gegeben hatten, in vollem Maße durchgeführt werden würden. Die Ebbe und Flut verschiedener politischer Strömungen schwoll mit der Zeit an. FDR wußte, daß ich Wall Street für mein weiteres Fortkommen als sehr wichtig ansah. Aber er wußte auch, daß ich ihn respektierte und im Hinblick auf seine Ziele mit ihm zusammenarbeitete.
30
Damals wußte ich noch nichts über König-Macher oder „Image-Macher”, von ihrer ungeheuren Macht, Menschen und Ereignisse unter Kontrolle zu halten. Ich war vollkommen unwissend, was die Kunst „zurechtgemachter” Nachrichten anging. An und für sich dachte ich wie ein Republikaner, aber ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl mit der Familie führte mich in die Reihen der Demokraten. Allerdings fühlte ich mich ziemlich unsicher, wenn ich ein Kampfgespräch von Louis Howes und sein politisches Glaubensbekenntnis erlebte. Er war FDRs intimer politischer Berater. Louis bewohnte ein Zimmer in der obersten Etage und gehörte zum Haushalt von FDR. Meiner Meinung nach gingen seine Ansichten stark nach links; vielleicht konnte man einen Unterschied zwischen wirtschaftlichem Anstand und politischer Zweckmäßigkeit bei ihm feststellen.
Nachdem Louis es mehrere Jahre lang versucht hatte, mich zu seinen linksgerichteten Ideen zu bekehren, gab er es schließlich auf. Dafür machte er Überstunden und bearbeitete FDRs Gattin. Trotz vieler politischer Gegenströmungen, die mit der Zeit auftraten, blieben mein früherer Schwiegervater und ich immer gute Freunde, auch noch, als er später in die Tätigkeit der hohen Politik mit dem Mittelpunkt im Weißen Haus eingespannt war. Im täglichen Kommen und Gehen spielte der Opportunismus für die meisten von uns eine große Rolle. Für mich stand er jedoch an zweiter Stelle. Die Treue und Liebe zur Familie war bei mir vorrangig.
31
Zweites Kapitel
Franklin D. Roosevelt I
Über Franklin D. Roosevelt ist viel geschrieben worden, und es wird auch noch mehr über ihn geschrieben werden. Meine Stellungnahme jedoch ist rein persönlich und in mancher Hinsicht wohl einmalig. In der Regel haben die meisten bekannten Autoren oder ihre beruflichen Strohmänner in ihren Schriften über FDR und über seine Gattin immer eine bestimmte Richtung im Auge gehabt, um so ein spezifisch politisches und ideologisches Bild zu schaffen und damit das gewünschte Ziel zu erreichen.
Ich möchte in diesem Buch FDR mehrere Kapitel widmen, einem gebildeten Manne, den ich sehr gern hatte, als er mein Schwiegervater wurde. Das war zu einer Zeit, als die Politik erst einsetzte und dann allmählich zu einer überwältigenden Macht wurde.
Zwei Lebensabschnitte sind hier beschrieben worden: der erste endet beim Eintritt in die Politik, der zweite mit FDRs plötzlichem Tode. Er beginnt, als sein politischer Stern am höchsten stand, dann aber kommt der gradweise Abstieg bis zum endgültigen Fall in Warm Springs in Georgia im April 1945. Von dort reiste nach Ansicht vieler sein beinahe leerer Sarg nach Washington und Hydepark. Inzwischen hatte man den immer bereiten Harry S. Truman plötzlich aufgefordert, die Robe des höchsten ausführenden Staatsbeamten anzulegen und die Zügel der Regierung in Washington zu übernehmen, was er mit großer Würde tat.
Da die beiden Lebensabschnitte von FDR erheblich voneinander abweichen, entstand für mich eine Situation, die
32
zu Ungereimtheiten führte: meiner persönlichen Treue stand eine beträchtliche Besorgnis gegenüber. Eigentlich sollte es möglich sein, einen Menschen zu schätzen und trotzdem in politischer Hinsicht nicht mit ihm übereinzustimmen. Ich hatte niemals auch nur die geringste Spur eines politischen Opportunismus gegenüber FDR, weil ich garnicht so veranlagt war, dann aber auch, weil in der ersten Zeit unserer Bekanntschaft nichts von politischer Bedeutung erkennbar wurde, was mich zum Opportunismus hätte verleiten können, selbst dann nicht, wenn ich so veranlagt gewesen wäre.
Ich betrachtete Familie und Vaterland als das erste, Politik als Macht kam erst an zweiter Stelle. Ich habe den Eindruck, daß die Politik eine fromme Art und Weise ist, einem etwas vorzuspiegeln, von dem du genau weißt, daß du es nicht bist, nur um Stimmen zu bekommen, wobei die Presse tüchtig mithilft. Man kann dann hinter diesem so ordnungsgemäß geschaffenen Bild in der Sphäre der Regierung operieren, als ob man eine führende Rolle in einem Broadway-Drama spielte. Das ist sehr häufig der Fall. Die Bühne im Theater sowie die Bühne in der Politik haben immer vieles gemeinsam. In mancher Hinsicht sind sie sich gleich.
Das Theater oder ein Hollywoodfilm hat den Zweck, seine Zuhörerschaft zu erfreuen, um zahlreiche Kartenkäufer anzulocken mit dem Ziel, Geld zu machen. Das auf der politischen Bühne sinnvoll und laut angekündigte Partei-Programm soll dazu dienen, ein Bild herauszustellen, das ein noch größeres Publikum erfreuen und anziehen soll, zwar nicht für Geld, wohl aber für Stimmen. Ist dies erfolgreich, dann finden die politischen Unternehmer mittels einiger „suggestiver” Gesetzesvorlagen (natürlich wird laut verkündet, es geschehe nur im öffentlichen Interesse) Mittel und Wege, sich selbst und ihre führenden Schauspieler großzügig zu belohnen. Für gewöhnlich sind die
33
sorgfältig geheimgehaltenen „Hauptdarsteller” von einer kleinen Gruppe lange vor dem Wahltag ausgesucht, und zwar für beide große Parteien, so daß das Risiko gleich null ist.
Um ein „Staatsmann” auf der politischen Bühne zu werden, muß man erst einmal von den Hintermännern dazu gemacht werden. Wünschenswert ist es, daß ein derartiger Kandidat großen persönlichen Ehrgeiz besitzt, dann aber auch vielleicht infolge etwaiger früherer Vorkommnisse Repressalien gegenüber nachgeben muß, andererseits aber nicht die Fähigkeit besitzen darf, mit der Zeit zu unabhängig zu werden, sondern immer „Suggestionen” gegenüber willfährig zu sein. So könnte man mit Takt, Anstrengung und Unterwürfigkeit ein Staatsmann werden.
Zur rechten Zeit wurde Franklin Roosevelt ein talentierter „Super-Barrymore” auf der politischen Bühne, jederzeit bereit, seine Nase in die Kochtöpfe der politischen Zweckmäßigkeit zu stecken, ja sogar in politische Indiskretionen, um sich dadurch das sorgsam gedämpfte Beifallsklatschen seiner Hintermänner zu sichern. Fraglos glaubte FDR, daß er sich und seine Anhänger immer in Sicherheit bringen könne. Darin hat er sich jedoch verrechnet. Um einen Fußballausdruck zu gebrauchen, Joe Stalin war je nach Belieben Außenspieler, häufig spielte er aber auch als Stürmer, um ein Tor zu schießen. Aus verschiedenen Gründen betätigten viele unserer führenden Männer auf dem diplomatischen Fußballplatz in Washington lediglich ihre Muskeln in der Art des üblichen „Warmlaufens”.
Im Hinblick auf Joe Stalin soll man nicht vergessen, daß er und seine Sowjetgenossen nur eine Phase des „Warmlaufens” sind. Auf dem Felde des internationalen Bankwesens, der Wirtschaft, Erziehung und unserer Außenpolitik breitet sich dies immer mehr aus, wobei Außenpolitik ganz groß geschrieben wird. Man kann wohl nicht daran zweifeln, daß sie einen „fremden Beigeschmack” hat.
34
Da ich an meiner altmodischen Ansicht festhielt, ist es wohl nutzlos zu sagen, daß ich immer erst an zweiter Stelle kam. Allerdings muß ich betonen, daß zwei wichtige und ausgezeichnete Mitglieder der Familie Roosevelt mit meinen Anschauungen übereinstimmten. Das eine war die sehr wichtige Sara Delano Roosevelt, das zweite der Vetter Henry Parish aus New York. In seinem Hause hatte die Hochzeit seiner Nichte Eleanor Roosevelt stattgefunden.
In mancher Hinsicht wurde FDR der Öffentlichkeit gegenüber das führende „politische Leitpferd”. Er war jedoch nicht „der Antreiber” dieses politischen Fuhrwerks, also nicht der Mann, der die Zügel in den Händen hatte und die Peitsche schwang. Man könnte ihn eher als das weittragende „Geschütz” bezeichnen. Die Munition wurde rechtzeitig von „anderen” besorgt… von den nächsten Ratgebern einschließlich seiner Gattin und von einigen Führern des Council on Foreign Relations.
Im ersten Lebensabschnitt kannte ich Franklin Roosevelt zuerst als Freund, dann als Schwiegervater, weiter als Gouverneur und endlich als Präsidenten, einen ausgenutzten. Im zweiten Abschnitt war er Präsident der Vereinigten Staaten und bald eine führende Persönlichkeit in der Weltpolitik, dabei stark beeinflußt und geführt von seinen Ratgebern.
Es gibt interessante Mußmaßungen darüber, wie er als Präsident zum ideologischen und politischen Gefangenen wurde und wie er schließlich in die Falle geriet. Für ihn schien es kein Zurück mehr zu geben. Er beugte sich jeder Forderung, die sein Amt an ihn stellte. Augenscheinlich hatte dieses vor allem anderen, selbst vor seiner Gesundheit, Vorrang. Wie wir wissen, war er durch die Nachwirkungen der Kinderlähmung körperlich sehr behindert, was auch dazu beitrug, daß er im Weißen Haus den Menschen, ja selbst Betrügern gegenüber, sehr zugänglich war, vor
35
allem aber auch gegenüber naheliegenden politischen Einflüssen, die aus seiner Unbeweglichkeit ihren Vorteil zogen.
Selbst in dem von mir genannten zweiten Lebensabschnitt blieb meine persönliche Zuneigung zu ihm bis zum Schluß trotz meiner Bestürzung über die Erkenntnis der katastrophalen Politik aus dem Weißen Haus, katastrophal, wenn ich sie im Interesse des Landes betrachtete. Ich teile die tiefe Bestürzung der vielen Amerikaner, die diese Wandlungen der Politik erkannten und unter deren Nachwirkungen zu leiden hatten.
Für mich sind die Vereinigten Staaten und ihre Zukunft das Allerwichtigste! Bei dem zweiten Lebensabschnitt war mir, als ob ich einem Drama, einer ausgesprochenen politischen Tragödie, beiwohnte. Es hat sich bereits in vieler Hinsicht als wahr erwiesen, aber trotzdem wird es so weiter gehen, bis unsere Regierungspolitik in Washington andere Wege einschlägt, und bis die allerbesten Bürger auf gesetzlichem Wege zum Wohle aller Amerikaner die Zügel in die Hand nehmen und nicht im Interesse einiger machtbesessener Finanzhyänen handeln.
36
Drittes Kapitel
Die Wallstreet-Jahre I
Dank einer Empfehlung eines alten Freundes, Roland Palmedo, kam ich 1924 zu Lehman Brothers. Die Firma bestand damals aus den Herren Philip, Arthur und Herbert, dann kamen Harold, Allen, Robert (der Sohn von Philip), Monroe Gutman und John Hancock. Zusammen mit Goldmann Sachs hatte die Firma die Effektengarantie übernommen und die Zuteilung der bevorrechtigten und Stamm-Aktien von vielen der führenden Industriegesellschaften. In der Regel bildete Goldman-Sachs das Übernahmekonsortium.
Bald jedoch schon tauchten in beiden Firmen neue Gesichter auf. Sydney Weinburg wurde Syndikatmanager für Goldman und ich für Lehman. Auf Grund der engen, seit Jahren bestehenden Verbindung waren beide Firmen kaum Konkurrenten.
Sydney war jung, fähig und sehr energisch und wurde bald Teilhaber in der Firma. Wir wurden Freunde. Seine Feststellungen waren für mich immer sehr interessant und zutreffend. Nur einmal gerieten wir über Einzelheiten bei einer Offerte aneinander. Einige Jahre später, so um 1934 herum, hielt Sydney bei dem jährlichen „Ausflug” des Bond Clubs nach dem The Sleepy Hollow Country Club in Tarrytown, New York, mich zum besten. Wie üblich wurde jeden Tag das Golfspiel ausgetragen, Lotteriespiel usw., dazu Tennis sowie Kostümfeste und leichte Spiele für die zu spät Kommenden. Auf dem Rasen war ein Zelt mit Erfrischungen aufgeschlagen. Ein Essen abends beschloß das Programm.
37
Um jene Zeit war die Regierung in Washington in Wall Street nicht sehr beliebt, und zwar wegen ihrer sturen Haltung gegenüber dem Handel, auch wenn es dem Scheine nach nur aus politischen Gründen geschah.
Es stellte sich heraus, daß bei dem Pfeilwurfspiel, einem der beliebtesten Spiele, der Vergnügungsausschuß eine leuchtende Idee gehabt hatte, indem eine große Karikatur von Roosevelt aufgestellt wurde, begleitet von lebhaften Kommentaren. Das Bild stand in der Nähe des Pfeilwurfspieles. Ich befand mich gerade in der Reihe, um zu warten, bis ich dran war, drei Würfe aus fünfzehn Fuß Entfernung für einen Preis. Zufällig sah ich Sydney so von der Seite her. Er grinste mich an und schien mit irgend etwas sehr beschäftigt. Ich hatte meine Pfeile geworfen, sie lagen beieinander, aber ins Schwarze hatte ich nicht getroffen. Wie ich mich erinnere, kam Sydney auf mich zu und sagte: „Curtis, ich möchte dir etwas zeigen.” „Was?” fragte ich. „Hier, schau da ‘rüber”, und er wies auf das große Bild von FDR. „Kannst du sehen, was da gedruckt ist?” Immer noch lachend, sagte er: „Da!” Als ich mich nach vorne bückte, kam von irgendwo her ein Photograph hervorgeschossen und nahm unter allgemeiner Heiterkeit einen Schnappschuß von mir.
Dieses Bild von mir erschien in Life in einer Bildreihe über den Ausflug des Bond Clubs, dabei war auch ein Bild von Sydney, wie er Pfeile nach Fatima, einer sehr farbenfreudigen Dame, warf, ein anderes Bild zeigte den „Trostpreis” beim Tennis, einen von Gerüchen befreiten Skunks. Kürzlich las ich mit großem Interesse Sydneys andauernde und großartige Erfolge in Wall Street. Fraglos ist er einer der einflußreichsten Weltbankiers. In den Staaten ist er für beide große Parteien eine „hinter den Kulissen” stehende politische Großmacht geworden.
Mit der Zeit lernte ich bei Lehman Brothers die Teilhaber, vor allem die jüngeren, kennen. Harold und ich wurden
38
gute Freunde, besonders als ich nach North Tarrytown zog. Er wohnte dort. Dort kaufte ich ein Stück Land an der Nordwest-Seite vom Pocantico-See und baute ein Haus, von dem aus ich den See ganz überblicken konnte. Eine halbe Meile von mir entfernt wohnte mein alter Freund John Wack mit seiner reizenden Frau Ethel; gegenüber am See lag der sehr große Besitz von John D. Rockefeller und seinem Sohn „John D. Jr”.
Im Spätherbst und Winter spielten Harold Lehman und ich an manchem Wochenende auf dem Platz bei seinem Haus in Tarrytown eine Art Tennis. Er und seine Frau konnten die ganze Gesellschaft gut unterhalten. Harold arbeitete tüchtig und er spielte auch tüchtig. Er spielte sowohl Handball wie auch Tennis und rauchte eine große Menge schöner Zigarren. Am Ende eines Essens ließ Harold aus einem besonders feuchten Behälter eine Handvoll Zigarren bringen. Es war ein scheußliches Zeug. Traurig, daß Harold irgendwie Lungenentzündung bekam, . aber als er schon über den Berg zu sein schien, starb er ganz plötzlich. Es war ein großer Verlust für mich.
Herr „Herbert”, ein Schüler von Williams College, war älter als Harold, der ein Cornell-Schüler gewesen war. Meine Beziehungen zu dem Ersteren waren herzlich und freundlich, aber naturgemäß förmlicher. Er hatte FDR in Washington gekannt, allerdings nur oberflächlich, so wie John Hancock, damals Junior-Teilhaber. Während des Ersten Weltkrieges hatte er in der Marine gedient. Ich hatte schon verschiedene Leute kennengelernt, mit denen FDR seinerzeit in Wall Street Geschäfte abgewickelt hatte, aber sie hatten keinen sonderlichen Eindruck auf mich gemacht. Herr „Herbert” indessen machte auf mich den Eindruck eines soliden und gesunden Bankiers, so daß ich mich entschloß, ihn und FDR zusammenzubringen in der Hoffnung, daß sie sich gegenseitig behilflich sein könnten, zumal da beide Interesse an Politik hatten.
39
Für FDR war es schwer, sich mit seinen schweren Beinschienen und bei Gelegenheit auch an seinen Krücken zu bewegen, jedoch hatten seine Übungen und sein Schwimmen sein Gehen sehr gebessert, so daß der Rollstuhl allmählich verschwand.
Bei zahlreichen Gelegenheiten machte ich mir bei FDR und „Herbert” die Mühe, die Vorzüge und Fähigkeiten des anderen anzupreisen, natürlich getrennt, um sie zusammenzubringen und vor allem enger aneinander. So entwickelte sich dank der von mir gesäten Saat im Hinblick auf diese beiden Männer „aus kleinen Anfängen das Geschäft”. Später wurde Herbert Lehman FDRs „starke rechte Hand” in der New Yorker politischen Arena. Meine Bemühungen brachten für beide Männer Vorteile.
Auch meine Syndikatabteilung wuchs und entfaltete sich. Anscheinend waren die Partner mit den erreichten Erfolgen zufrieden. Um 1927 herum schloß sich Frederick Warburg der Lehmann-Gruppe an. Es wurde gleich gesagt, er wäre nur von Kuhn-Loeb „geliehen”. Wir kannten uns beide gut von Wall Street her und auch durch häufiges Treffen bei den jeweiligen Bällen in der Stadt; er war sehr beliebt, alle nannten ihn „Freddy”. Freddys würziger und köstlicher Humor war in der ganzen „Straße” bekannt, und ich freute mich sehr, daß er zu Lehman Brothers kam. Verschiedene Aufgaben wurden von ihm zusammen mit den Partnern bearbeitet.
In den Jahren 1927/28 und 29 gab es in Wall Street fortwährend aufregende Tage. Die darauf folgenden Jahre 1930-33 waren von einer strapaziösen, harten Aufbauarbeit erfüllt, die uns viel Kopfschmerzen machte. 1927/28 und 29 gab es viele Angebote in Emissionen von Obligationen und Effekten, so daß ich sehr viel zu tun hatte.
Manchmal, vor dem tatsächlichen Datum einer öffentlichen Emission, wurden unsere Angebote mit einem oder
40
zwei Punkten Aufgeld über den angebotenen Preis am Schalter auf der Basis „Wann emittierbar” verkauft. Daher war die Jagd nach Teilnahme an derartigen Ausgaben von vielen Emissionshäusern von „allerwärts” sehr aggressiv und hartnäckig. Die Zuteilung einer vernünftigen und normalen Teilhaberschaft war oft sehr schwierig. Natürlich wollten alle Händler eine Menge „schneller” Emissionen und brachten dann viele plausible Gründe vor, warum sie nicht an den „langsamen” Emissionen teilnehmen wollten.
Geschenke schaffen auf allen Wegen des Lebens insofern immer Probleme, als die Frage auftaucht, wie handelt man korrekt? Mein erstes „Geschenk” bekam ich, als wir gerade dabei waren, die gemeinsamen Gesellschaftsanteile der großen Kroger Grocery und Baking Company anzulegen. Da es eine erstklassige Firma war und der Preis richtig, entstand eine „Hausse” auf der Grundlage „wann ausgestellt”, und zwar schon mehrere Tage, bevor das Angebot erfolgte.
Eines Morgens erhielt ich durch „Eilzustellung” in meinem Büro ein langes, schweres Paket aus Ohio. Es kam von einem weltbekannten Händler, der aber nicht regelmäßig Käufer bei uns war. Das Paket enthielt einen wundervollen Satz Golfschläger. Ich ging hinunter, um Harold zu suchen und sagte: „Harold, ich habe gerade einen wundervollen Satz Golfschläger aus Ohio von soundso bekommen, sie wollen eine Menge Kroger-Anteile, was soll ich tun, sie zurückschicken?”
Harold sah mich an, grinste und sagte: „Behalte sie, laß uns aber nicht die Zahl ihrer Anteile vergrößern, gut, daß du das gesagt hast.” So behielt ich den Satz, und der Händler bekam mit einem Schlag seine Anteile. Später erhielt ich ein anderes Geschenk, das aber einen politischen Beigeschmack hatte und direkt verantwortlich für „die Schlacht im gelben Zimmer” war, im Weißen Haus
41
am Einsetzungstage des Präsidenten 1933. In einem späteren Kapitel werde ich weiter darüber schreiben. In diesem Falle war das Geschenk eine Kiste Scotch Whiskey. Es kam zu einer Zeit, als wir alle lange Zeit in der „Sahara” der Prohibition zappelten. Diese Kiste wurde mir persönlich im Weißen Haus unter den scharfen Nasen der Geheimpolizei von einem bedeutenden New Yorker Bankier zugestellt. Er kam am 4. März 1933 um die Mittagszeit mit einem Taxi zum Weißen Haus, um mich aufzusuchen. Augenscheinlich wegen seines Inhaltes erweckte das „Geschenk” großes Interesse am Platze. Ich bedankte mich bei dem Wohltäter, sagte ihm aber gleich, daß ich leider keinen politischen Einfluß ausübte, lud ihn jedoch ein, um 3.30 Uhr mit einigen Freunden zum „Gelben Zimmer” zu kommen, um sein „Geschenk” auszuprobieren, was er auch tat.
Die Aufgabe, mit der immer steigenden Anzahl der Angebote in Effekten fertig zu werden, schuf neue Probleme für die Firma. Ich wurde befördert, um die zunehmenden Lasten von den Schultern der Teilhaber, besonders von Harold und Allen, zu nehmen. Die gesamten Wertpapiere der Firma, einschließlich der Kunden - und Neuausstellungen, mußten jeden Morgen gezählt und anhand einer Kontrollkarte geprüft, dann aus dem Keller in der 15ten Broad Street unter Bewachung zum Büro gebracht werden. Abends wurden sie wieder kontrolliert und unter Bewachung zum Keller gebracht. Häufig mußte man sich um Millionen bankfähiger Wertpapiere kümmern. Sicher war die Zählung notwendig, aber langweilig.
Freddy Warburg war häufig da, um mir zu helfen. Wir haben viele Stunden zusammen tief unten im Keller in der 15ten Broad Street verbracht. Der Hauptwächter, ein vortrefflicher, großer Ire namens Cortney, hatte großen Sinn für Humor, der Freddys Humor herausforderte. Dadurch hatten wir viel zu lachen und uns zu amüsieren. Das half
42
uns über die Trockenheit der Zählung hinweg. Wir besprachen eine Menge sozialer Fragen, waren Kriegsteilnehmer usw. Freddy war ganz hingerissen von der Schallplatte „The Two Black Crows”, die damals sehr beliebt war. Der Text amüsierte ihn.
Einmal erzählte er mir eine sehr interessante Anekdote am Schluß des Ersten Weltkrieges 1918. Anscheinend stand sein Onkel Max Warburg in Hamburg in Deutschland beim Kaiser in Hohem Geheimdienst. Er hatte es fertig gebracht, daß der erste versiegelte Zug nach dem Waffenstillstand durch Deutschland fuhr und Trotzki in Rußland $ 500 000 in Gold brachte. Als ich das damals hörte, schien es mir eine Menge Gold für Trotzki, für einen einzelnen Mann. Doch damals war Rußland, was mich betrifft, weit weg.
43
Viertes Kapitel
Ein Sommer auf dem Warburg-Gut
Manchmal kann der Sommer in New York sehr heiß sein. Als ich eines Tages im Keller über die Hitze in New York schimpfte, sagte Freddy Warburg zu mir: „Warum kommst du nicht ‘rauf zu uns und mietest ,Dandruff-on-the Knob’ für den Rest des Sommers?” Als ich fragte, was das denn sei, antwortete er lachend: „Ein kleines Haus auf unserem Grundstück. Es liegt auf einem Hügel. Wie gefällt dir der Name?” „Ausgezeichnet”, sagte ich, „laß uns heute nachmittag Tennis spielen und nachher das Haus ansehen.” Nach dem Tennis besahen wir abends das Haus, und ich mietete es sofort für den Sommer. Sehr oft wurde am Spätnachmittag, noch vor dem Abendessen, viel Tennis gespielt. Manchmal gewann ich, manchmal Freddy. Wir paßten gut zueinander. Manchmal spielten wir im doubles gegen andere, wenn viele Besucher zugegen waren. Häufig habe ich Tennis mit Percy Douglas auf seinem Platz in Hastings gespielt. Manches aufregende Spiel haben wir dabei gehabt.
Ab und zu lud uns Frau Felix Warburg, Freddys Mutter, nebenbei eine sehr charmante Gastgeberin, zu ihren großen Sonntagmittag-Gesellschaften ein. Eine dieser Gesellschaften habe ich noch gut in Erinnerung: Ungefähr ein Dutzend Menschen, einschließlich einiger Vettern und Freddys Onkel Paul Warburg, waren in einem großen Raum zusammen. Onkel Paul war der Schöpfer einer Gesetzesvorlage für das Bankwesen, die 1913 kurz vor Weihnachten von Präsident Wilson unterzeichnet wurde und als die Federal Reserve Act bekannt geworden ist.
44
Felix Warburg war liebenswürdig und freundlich, ein wirklich netter Gastgeber. Sein Bruder Paul jedoch schien mir sehr viel nüchterner und hielt sich auch mehr zurück. Ich habe ihn noch gut in Erinnerung, wie er in seinem großen Stuhl abseits der allgemeinen Unterhaltung saß, bis das Mittagessen serviert wurde.
Für gewöhnlich wurde um diese Zeit etwas musiziert, und bei dieser besonderen Gelegenheit bat Mrs. Warburg einen neben ihr sitzenden Gast, einen schüchternen jungen Menschen, eine von seinen eigenen Kompositionen zu spielen. Man sah deutlich, daß er es lieber nicht tun wollte, aber in der damaligen musikalischen Welt in New York war eine Bitte von ihr, etwas zu spielen oder zu singen, dasselbe wie eine Bitte vom „Olymp” herab oder wie, wenn es hieß: „Der Präsident wünscht Sie am Telefon zu sprechen.” So setzte sich der junge Mann sofort gehorsam an das Klavier und spielte seine herrliche neue „Rhapsodie in Blue”. Es war George Gershwin.
An einem Sonntagnachmittag im Sommer 1928 spielte ich Tennis bei meinem Onkel Cornelius Agnew in der Nähe von Armonk. Wir waren sehr innig befreundet, und meine Vettern Rea, Donald und Sanford sowie deren Schwester Alice waren wie Bruder und Schwester zu mir. Wir waren ja auch zusammen aufgewachsen. In Armonk waren wir mit acht bis zehn jungen Leuten, spielten doubles und gemischt, es war immer ein schöner Nachmittag.
Gerade vor dem Abendessen kam ich nach „Dandruff-on-the-Knob” zurück und fand auf dem Kaminsims im Hause ein Telegramm aus Warm Springs in Georgia vor. Darin stand: „Einige Leute hier wünschen im Herbst meine Kandidatur als Gouverneur in New York. Wie denkst du darüber. Bitte telegraphiere, Gruß FDR.”
Nach einer kurzen Überlegung ging folgendes Telegramm an ihn nach Warm Springs ab: „Erhielt dein sehr interessantes Telegramm. Finde es eine sehr gute Idee. Bin über-
45
zeugt, du wirst gewinnen. Will alles tun, um dir und der Sache zu helfen.” Am anderen Tage kam aus Warm Springs von FDR folgendes Telegramm: „Dein Telegramm erhalten. Man sollte dich verprügeln.” Diese zweite Nachricht zeigte mir jedoch, daß er sich über die ihm zugesagte warme Unterstützung und Ermutigung gefreut hatte.
Diesen auf Freddys Familienbesitz verbrachten Sommer habe ich sehr genossen, doch das sollte nicht mehr lange dauern. Als die Blätter anfingen sich zu färben, schwoll das Dröhnen des Kampfes um den Gouverneursposten immer heftiger an.
46
Fünftes Kapitel
Tarrytowns Nachbarn
Unter einem steilen Abhang gegenüber meinem Hause auf der ändern Seite des Pocantico-Sees lag das große Landgut von John D. Rockefeller und seiner großen Familie. Ein wunderschönes Stück einer Westchester Hügellandschaft, mehrere tausend Morgen groß.
Von meinem Rasenplatz konnte ich den westlichen Teil gut übersehen und einen Blick auf den Hudson erhaschen, wie er bei Tarrytown auf seinem Weg zum Hafen von New York in den Atlantik vorbeifloß.
Unmittelbar neben mir hatte ich keine Nachbarn; die nächsten waren John und Ethel Wack sowie Ethels entzückende Mutter Mrs. Barksdale, eine Schwester von Coleman Du Pont, des Chefs der berühmten Du Pont Familie aus Wilmington. Es ist nur korrekt, wenn ich sage, daß ich 1929 nur von prominenten Nachbarn umgeben war.
Mein Haus war neu gebaut, es machte mir Spaß, es in Ordnung zu bringen und draußen zu arbeiten. Große Felsen und hohe Bäume erstreckten sich über eine viertel Meile längs der Ufer des Sees. Weit draußen auf dem See war viel Wild, Fasane, wilde Enten kamen und gingen. Im Sommer sah man Reiher in allen Größen, auch einige unternehmende Biber erschienen, bis die staatliche Naturschutzbehörde ihr Wehr zerstörte. Im frühen Herbst sah man gelegentlich Adler, vom Norden kommend und scheinbar bewegungslos, hoch ihre großen Kreise über dem Außensee ziehen. Es war eine wundervolle Landschaft.
Ich war dauernd unterwegs, um John und Ethel zu sehen.
47
Seit Jahren waren John und ich unzertrennlich. Als Jun-gens waren wir zusammen in dem gleichen Pensionat gewesen. Später, sofern wir das nötige Kleingeld zusammenhatten, gingen wir auf Entenjagd, wobei jeder Jagdausflug zu einem besonderen „Ereignis” wurde, worüber wir uns immer wieder unterhalten konnten, so daß uns mehrere dieser Ausflüge unvergeßlich geblieben sind.
Einen Ausflug dieser Art erlebten wir an einem Sonnabendmorgen in einem Moor einige Meilen von Princeton, New Jersey, entfernt. Wir kamen etwas reichlich spät, um den Morgenflug der Enten mitzuerleben. Eine Ente jedoch flog schnell vorbei, und da ich dachte, es wäre eine schnell fliegende Krickente, ließ ich sie erst fliegen und schoß dann. Als ich sie dann aufhob, sah ich zu meinem Entsetzen, daß es keine Krickente war, sondern eine Brautente, die um diese Zeit nicht geschossen werden durfte.
Der Morgenflug der Enten ist immer nur kurz und war daher schnell vorbei. Wir brachen also bald auf, um zurück zur Stadt zu fahren in der Hoffnung, doch noch einen Fasan schießen zu können. Nach einer kurzen Weile kamen wir an den Rand des Moores und vor uns lag ein großes Feld. Vor uns, etwa vierzig Meter, bewegte sich etwas im tiefen Gebüsch. Ich wurde aufmerksam. „Was ist das, John?” fragte ich, auf das Gebüsch zeigend; er schaute lange hin und sagte: „Das sieht aus wie ein großer Hahn.”
Ich ging vorsichtig weiter. Johns fachmännischer Rat war nur ein heiseres Wispern: „Pirsch ihn an, wie man es bei einem Elch tut.” Ich tat es. Als ich auf zwanzig Meter herankam, erhob ich mich und genau vor mir war ein großer Hahn, weitweg von Haus. Er sah mich, schnell machte er sich auf, dorthin, woher er kam, eine halbe Meile weg, aber er kam nicht weit.
Am Abend saßen John und ich, kühl und bequem, in dem
48
gut besuchten „französischen Restaurant” in Princeton bei einem üppigen Mahl, benannt „Foulet a la ,Moose'”, richtigem französischem Weißbrot, einer Flasche Weißwein und mit allen sonstigen Schikanen. „Pirsch heran wie an einen Elch” wurde bei uns zu einem geflügelten Wort. Ein anderer Sonnabend mit John auf Entenjagd wird ewig in meinem Gedächtnis bleiben; das war in Great South Bay, Long Island. John hatte seinen neu erworbenen Schwager Donaldson Brown aus Wolmingson zum Entenschießen mit uns nach Bellport eingeladen. Wir wollten schwarze Enten von einer Batterie aus schießen. Diese Batterie ist eine sehr unsichere und ungemütliche Vorrichtung; ähnlich wie ein flacher Badetrog vorne und hinten mit Segeltuch abgedeckt, ragt sie weit ins Wasser hinaus. Die Ecken waren mit schweren eisernen Lock-Enten niedergehalten, damit der Insasse in Höhe des Wasserspiegels war, um so gut wie möglich versteckt zu sein. Rund herum waren viele hölzerne Lockvögel angesetzt. Wenn dann ein Flug Enten vorüberzieht, braucht der Insasse nur aufzustehen und zu schießen. An rauhen und kalten Tagen, die die besten für die Jagd sind, kommt die Batterie leicht ins Schwanken und wird innen naß.
Don Brown war ein bedeutender Geschäftsmann in Wilmington. Bald darauf wurde er einer der Hauptdirektoren bei General Motors. Er nahm unsere Einladung an und wir drei kamen zur rechten Zeit in Bellport an, gingen zu dem nahen Gasthaus und zogen unsere Jagdklamotten an. Wir stiegen dann in das große Jagd- und Fischereimotorboot unseres Begleiters. Am Heck war das übliche Ruderboot vollständig beladen mit hölzernen Lockvögeln und der Batterie.
Wir fuhren ungefähr eine Meile östlich in das tiefe Wasser auf dem Entenflugweg und gingen vor Anker. Zum Mittagessen hatten wir einige belegte Brote und Kaffee in der kleinen Kabine des Bootes.
49
Für den Flug war es noch ein bißchen zu früh, aber unser Begleiter ließ uns die Batterie ungefähr fünfhundert Meter weg mit den Lockvögeln aufstellen. Da es eine Ein-Mann-Batterie war, zogen wir Strohhalme, um festzustellen, wer an der Reihe war. Don wurde der Letzte. Da das Schießen vor Sonnenuntergang am besten ist, gefiel uns das, da Don unser Gast war.
John und ich hatten Glück und dann kam Don an die Reihe. Dons Jagdausrüstung hatte ich noch nicht weiter angesehen, hatte auch nicht daran gedacht, aber ich erinnerte mich jetzt, daß er gesagt hatte, er sei selten auf Entenjagd gewesen. Unter seinem Jagdmantel trug er einen hohen, steifen Kragen und auf seinem Kopf einen schwarzen Zylinder. Taktvoll bot ich ihm meine Jagdmütze an. „Nein, danke, ich möchte meinen Hut tragen”, sagte er. Unser Begleiter oder „Kapitän”, mit dem wir häufig auf Jagd gewesen waren, war unser Freund. Er war ein richtiger Experte und daher auch ein ganz unabhängiger Charakter, mit einer ganz bestimmten Vorstellungsart. Verwundert guckte er Dons Zylinder an und wollte etwas dazu sagen, als ein Puff von mir ihn daran hinderte. Mit etwas Schwierigkeit setzten wir Don in die Batterie und fuhren etwa eine Meile seewärts, gerade weit genug, um den Flug der Enten nicht zu stören, und beobachteten. Die Nachmittagssonne ging langsam im Westen unter, es war auch beträchtlich Wind aufgekommen; das schönste Wetter!
Die einzeln fliegenden Enten, von denen ich schon beglückt war, erschienen jetzt in „Ketten” und dann kamen sie in Scharen von allen Seiten über die Bucht.
Ich sagte zu John: „Junge, Don, der hat’s gut.”
Zu meiner Überraschung sagte der Kapitän mit einer miesen Stimme: „Das kann man wohl sagen.”
Von der Batterie hörten wir keinen Schuß. Immer noch flogen Enten und noch immer kein Schuß!
50
John sah hinaus und sagte: „Verdammt!”
Ich sah dann auch schnell zur Kabinentür hinaus und hatte einen unvergeßlichen Anblick, wirklich unvergeßlich! Ich sah, wie die Enten sich Dons Batterie näherten, um dann plötzlich zu erschrecken, scharfe Ausweichmanöver machten, um dann ganz schnell vorbeizufliegen, als ob sie irgend etwas sehr Unerfreuliches witterten; das taten sie natürlich nicht, aber sie sahen etwas sehr Ungewöhnliches, um nicht zu sagen Einmaliges! In der Batterie, ungefähr ein Fuß über dem Wasserspiegel, tauchte inmitten der Lockvögel deutlich etwas ganz Schwarzes auf. Es sah aus wie ein Kanalkennzeichen, aber das war es nicht, es war Dons schwarzer Zylinder ganz deutlich über eine halbe Meile weit zu sehen.
Immer noch kein Schuß. John und ich guckten uns gegenseitig unruhig an, dann sagte er: „Kapitän, ich denke, es ist besser, wir fahren hinüber und nehmen Mr. Brown auf.” Wir taten es und teilten später unsere Enten in drei Teile.
Der „New look” für Batterieschießen war sicher an jenem Nachmittag in Bellport zum ersten Male gesehen worden; wie wichtig das Derby auch in Kentucky sein mag, die schwarzen Enten in der Great South Bay hatten eine andere Meinung davon.
John schlug vor, zur besseren Tarnung eine rote Feder auf den Zylinder zu stecken. Ich schug vor, Abercrombie & Fitch für ihre Entenjagdanzüge einen neuen Tipp zu geben zwecks einer beliebigen Ausstattung. An einer Seite meines Besitzes in Nord Tarrytown waren die Reste eines alten Steinbruchs. Ein Haufen Natursteine und Kies lagen umher, und so machten vier oder fünf Morgen einen ziemlich wüsten Eindruck. Dadurch bekam ich meine erste Verbindung zu einem der zahlreichen Mitglieder der Rockefeller-Familie, und zwar mit John D. Rockefeller jr.
51
Eines Tages suchte mich ein Mann von seinem Besitz auf und erzählte mir, er käme auf Wunsch von Rockefeller jr. Er wollte wissen, ob er Steine von dem alten Steinbruch bekommen könnte, um Wege auf seinem Gut anzulegen. Wenn ich nichts dagegen hätte, würde er soviel nehmen, wie er brauchte und als Gegendienst den Platz um den Steinbruch herum ebnen lassen. Ich erwiderte ihm, er möchte soviel Steine nehmen, wie er brauchte, um sich damit zu helfen.
Ein Haufen Steine wurde dann nach Pocantico Hills geschafft. Nach Fertigstellung der Wege erhielt ich einen sehr netten Brief von Rockefeller und als Gegenleistung wurde der alte Steinbruchplatz verschönert.
Mittlerweile hatte ich Nelson und John III kennengelernt. Letzterer war Student in Princeton. Nelson lud mich gelegentlich zum Tennis ein, was immer viel Spaß machte. Er war stets sehr begeistert und tätig.
Einmal nach dem Spiel fragte Nelson mich, ob Anna und ich einige Tage später zum Abendessen bei „Großvater” kommen wollten. Ich nahm an, wie ich mich erinnere, war es auf einen Sonnabend-Abend. Ich hatte niemals Rockefeller sen., den berühmten „John D.”, getroffen und war daher glücklich, jetzt Gelegenheit zu haben, zumal da sehr viel über ihn geschrieben worden ist. Daher freute ich mich über diese Gelegenheit.
Wir waren pünktlich und gingen bergauf zu dem „großen Haus”, hoch über einem Hügel gelegen, von wo aus man das Haus seines Sohnes und den Hudson überblicken konnte. Ungefähr ein Dutzend Menschen waren zum Essen eingeladen, und zu meiner Überraschung fand ich mich bei Tisch an der rechten Seite des alten Herrn.
Das Essen verlief sehr nett. Mr. Rockefeller war sehr lebhaft und viel gesprächiger, als ich erwartete, obwohl er damals nicht mehr ganz jung war. Er sprach sehr offen
52
und schien die Unterhaltung in seiner Nähe sehr zu genießen.
Seine Augen haben mich in höchste Verwunderung gesetzt. Sie waren durchdringend, von einer ungewöhnlichen strahlenden Bläue, man konnte sie nicht leicht vergessen. Er war ziemlich mager. Nach dem Nachtisch winkte er dem Diener, der verstand. Er verschwand, kam bald mit einigen kleinen Tafeln wieder und stellte vor jedem Gast eine kleine Tafel hin. Anscheinend war es ein Lieblingsspiel von Rockefeller. Es hieß „Numerica” und erinnerte mich etwas an „Bingo”. Das Spiel war sehr leicht und ganz interessant. Rockefeller saß am Kopfende der Tafel und seine Hausdame Mrs. Evans ihm gegenüber. Sie schien Ende der sechzig zu sein, eine sehr würdige und freundliche Dame.
Das Spiel wurde fortgesetzt. Jeder schien es zu genießen, bis Rockefeller wieder einen Wink gab, worauf die „Numerica”-Tafeln fortgetragen wurden. In diesem Augenblick - ich weiß es noch ganz genau - sagte ich zu meinem Gastgeber: „Herr Rockefeller, obwohl ich niemals ,Numerica’ gespielt habe, finde ich es ausgezeichnet.” Mit seinen durchdringenden Augen schaute er mich scharf an, wobei ein lustiges Zwinkern seine Augen erfüllte, dann lehnte er sich in seinen Stuhl zurück, räusperte sich, wie einer, der eine Rede halten will, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu lenken. Natürlich war dieses sofort der Fall. Jeder hörte auf zu sprechen. Er räusperte sich nochmals, schaute dann direkt auf Mrs. Evans und sagte mit einer etwas hohen Stimme: „Mr. Dall, ,Numerica’ ist wirklich ein schönes Spiel. Die feine Pointe habe ich von Mrs. Evans als kleiner Junge auf ihrem Schoß kennengelernt!” Dann schlug er auf seine Knie, warf seinen Kopf zurück und, nachdem er nochmals Mrs. Evans angeschaut hatte, schüttelte er sich vor Lachen.
Mrs. Evans war zuerst ganz verwirrt, dann brachen alle
53
über den Witz, den der alte Herr auf ihre Kosten gemacht hatte, in großes Gelächter aus. So endete der unvergeßliche Abend bei „Großvater”. Fraglos wird Mrs. Evans ihn noch in Erinnerung haben.
54
Sechstes Kapitel
Franklin D. Roosevelt II
Roosevelt hat niemals mit mir über seinen Vater gesprochen, und ich vermute, daß James Roosevelt starb, als FDR noch im Pensionat war.
Da ich selbst gerne alles, was in der frischen Luft geschah, tat, wie Jagen und Schießen, war ich immer an seinen früheren Projekten und Arbeiten, von denen er von Zeit zu Zeit erzählte, interessiert.
Ein Jugendfreund von FDR und intimer Hydepark-Nachbar war Edmond P. Rogers. Offenbar waren Edmond und er große Freunde, und als solche streiften sie viel auf dem Lande am Hydepark umher. Sie durchstöberten die Wälder, legten Schlingen und machten sonstige Dinge, wie Jungen es eben gerne tun. So z. B. legten sie sich eine große Sammlung von Vogeleiern an von den vielen Vögeln im dortigen Gebiet, die mit der Zeit einen großen Umfang bekam. Um nun eine Ausstellung mit ihnen machen zu können, wurden aber die Vogelnester in die Sammlung mit einbezogen, die dann auf Mr. Roosevelts Boden ausgestellt wurde. Zum Glück für die Vögel in diesem Gebiet streckte sich dann bald eine väterliche Hand schützend über sie aus. Wenn ich meine Meinung sagen darf, so glaube ich, daß das Museum of Natural History in New York City, wenn es hätte in die Zukunft sehen können oder sich hätte ein Bild machen können, wie Politik gemacht würde, sehr daran interessiert gewesen wäre, für billiges Geld die Roosevelt-Rogers-Vogeleiersammlung zu erwerben. Außer Edmond hatte FDR offenbar keine engeren
55
Freunde in Hydepark, was sehr bedauerlich war, da Jungen sich häufig gegenseitig erziehen. Ein älterer Freund von mir sagte mir einmal, daß FDR im Sport, wie beim Tennis, ein schlechter Verlierer wäre. Da er auf dem Lande lebte und in jenen Tagen nur Pferd und Wagen existierten, hatte er wenig Gelegenheit, mit anderen Jungen zu verkehren, was schlecht für ihn war. Überdies war er ein Alleinkind.
Wenn er auch viel ritt, so liebte er trotzdem weder Pferde noch Reiter; dagegen liebte er das Segeln, im Sommer auf dem Wasser zu sein, mit Segeln und Takelage und mit allem, was mit Segelbooten zusammenhing, zu hantieren. Meistens fuhr er nach der Campobelloinsel. Dort in dem gefährlichen, trügerischen Gewässer ist Segeln ein gefährlicher Sport, vor allem, wenn die Tide mit dem Wind sehr stark ist, womit man immer rechnen muß.
Eine andere jugendliche langanhaltende Liebhaberei von FDR war Briefmarkensammeln. Die Farben der Marken und die damit zusammenhängende Geographie schienen ihn sehr zu faszinieren, selbst dann noch, wenn ich ihn wie üblich besuchte; häufig fand ich ihn dann mit seinen Marken beschäftigt, sie verbessernd und diese oder jene zu den einzelnen Serien hinzufügend. Damals schon gewann seine Sammlung an Bedeutung. Bekanntlich hängt der Wert einer Marke von ihrer Seltenheit und Besonderheit ab. Hin und wieder erscheint ein Sammler mit einer großen „Seltenheit”, die auf dem Boden gefunden wurde oder aus dem Koffer eines Verstorbenen stammt. Ein derartiges Ereignis „bringt” dann die ganze Bruderschaft der Philatelisten in der ganzen Welt hoch, um zu versuchen, eine ähnliche Entdeckung zu machen. Jeder einzelne hofft immer, daß er auch eine solche „Entdeckung” machen würde. Eines Tages machte FDR von sich aus auch eine „Entdeckung”, wodurch ein großer Tumult bei den Markensammlern entstand. Man konnte förmlich die Entrüstungs-
56
schreie und neidischen Bemerkungen hören. Gewiß kann man wirklich nicht sagen, daß in jenem Augenblick alles schön und in Ordnung war. Die Ursache dieses heftigen Ausbruches wurde dadurch hervorgerufen, daß irgendein Regierungsbeamter in Washington beim Herstellen einer Platte für eine neue US-Briefmarkenausgabe versehentlich oder durch Unachtsamkeit oder sonst wie die Figur auf der Marke auf den Kopf gestellt hatte, wodurch die Platte nutzlos wurde. Als jedoch der Fehler erkannt wurde, wurde diese Abnormität mit der auf dem Kopf stehenden Figur „taktvoll” und schnellstens aus dem Papierkorb gerettet und fand sich dann in der Sammlung eines sehr prominenten Washingtoner Philatelisten wieder. Ebenfalls hatte ich herausgefunden, daß FDR sehr gerne schoß, aber ich konnte niemals von ihm richtig erfahren, welche Art Jagd er bevorzugte. Die Rogersjungen fuhren oft mit ihrem Vater auf Großwildjagd und brachten manche schöne Trophäe mit nach Hydepark. Möglich, daß FDR auf diesen Ausflügen mit ihnen ging.
Das erste Bild von Roosevelt, dessen ich mich erinnere, erschien in der Literary Digest vom 17. Juli 1920. Es war ein politisches Bild und zeigte FDR, ein wenig müde aussehend, bei einem Auto mit einem sphinxähnlichen Gesichtsausdruck. In der Hand hielt er wie zufällig ein großkalibriges Gewehr; dabei trug er einen vom Schneider gemachten zweireihigen Anzug, steifen Kragen, Schlips mit einer Nadel darin. Das war fünf Jahre, bevor ich ihn kennenlernte. Ich erinnere mich noch genau, daß ich damals dachte, warum das Gewehr in einem derartigen Aufzug? Was hatte das überhaupt mit „Schießen” zu tun? Vielleicht war es eine politische Großwildjagd? Für ihn war die „Jagd” in diesem Herbst noch nicht offen. Das Bild erschien, als Cox und Roosevelt sich vorbereiteten, in den nationalen Wahlen im November jenes Jahres gegen Harding und Coolidge zu kandidieren.
57
Der Digest sagte weiter: „Republikanische, demokratische und unabhängige Zeitungen vereinigen sich, um der Demokratischen Partei zur Wahl von Franklin D. Roosevelt als Kandidaten für den Vize-Präsidenten zu gratulieren” (S. 11). Die New York Globe schrieb: „Sollte die Demokratische Partei gewählt werden, so sind selbst die Republikaner froh, Roosevelt in Washington zu haben.” Die Sun und New York Herald (republikanisch) lobten ihn sehr. Die World (demokratisch) sagte, daß seine Wahl die Partei dort noch stärker gemacht hätte, wo Stärke gebraucht würde, und die New York Times (demokratisch) schrieb: „Es ist ein Glück für die Nation, daß jede Partei einen Kandidaten für den Vize-Präsidenten gewählt habe, der im Notfall Präsident werden könnte, ohne daß das Land irgendwelche Besorgnis zu hegen brauche.” Die „Besorgnis” für manche kam jedoch später.
Der freundliche Halbbruder von FDR lebte in der Nachbarschaft in Hydepark. Er hieß James Roosevelt. Über ihn ist nicht viel geschrieben worden, aber ich hatte immer das Gefühl, daß er eine interessante Persönlichkeit war. Er war älter als FDR. Äußerlich glich er sehr König Eduard VII. von England - dieselbe Kopfform und denselben dichten um das Kinn geschnittenen Bart. Eines Tages fragte FDR mich: „Curt, wie findest du Roseys Bart?” In vieler Hinsicht erinnerte er mich an einen Engländer. Als ich ihn kennenlernte, hatte „Onkel Rosey” sich bereits zurückgezogen. Er reiste viel umher, und es war schwierig festzustellen, was er eigentlich tat. Er war älter als FDR, aber sie hatten nicht viel Gemeinsames. Trotzdem war die Atmosphäre immer freundlich, wenn sie auch in zwei verschiedenen Welten lebten. Die jüngere Generation nannte ihn „Onkel Rosey”. Er liebte die Jagd, und wir gingen etliche Male zusammen. Ich erinnere mich noch, wie wir eines Tages zusammen in Millbrook einen wunderschönen Tag auf Fasanenjagd erlebten. Er besaß ein genau zusam-
58
menpassendes Paar handgearbeiteter englischer Grant-Schrotflinten, welche tatsächlich meinen Mund wässerig machten. Nach dem Tode von „Onkel Rosey” kam seine Witwe, Tante Betty, häufig in das „Big House”.
Im Laufe der Zeit verlor FDR das Interesse an sozialen Angelegenheiten, während dagegen sein Interesse an politischen Dingen wuchs. So gewöhnte er sich daran, mich aufzufordern, ihn zu den verschiedenen Versammlungen zu begleiten, und er wußte auch, daß er sich ganz auf mich stützen konnte und, auf meinen Arm gelehnt, ihm das Gehen die geringsten Schwierigkeiten machte, so daß er auch gut Biegungen und gelegentlich Treppen überwinden konnte. Für gewöhnlich hielt er meinen rechten Arm mit seinem linken Arm, wobei er mit seiner rechten Hand einen starken Stock mit einer breiten Gummispitze hielt, um so immer die Möglichkeit des Ausrutschens und Fallens zu vermeiden.
Ich werde nie den einen Abend vergessen, nachdem er zum Gouverneur gewählt worden war. Wir gingen zu einer Versammlung, die in einem großen Saal in New York abgehalten werden sollte. Dabei sollte FDR der Ehrenredner im Rahmen eines langen Abendprogramms sein. Der Saal als solcher war nicht günstig für ihn zum Gehen. Er hatte mich gebeten, ihn zu begleiten. Er hielt meinen Arm. Als wir nun langsam wie gewöhnlich von der Straße aus zum Rednerpult schritten, schien es, als ob heute der Teufel seine Hand im Spiel haben sollte, denn als von links mich jemand ansprach und meine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, sprach ein alter Freund ihn von rechts an, irgendwie rutschte dabei die Spitze seines Stockes auf dem glatten, gebohnerten Boden aus, so daß er stracks hinfiel. Mit etwas Hilfe bekam ich ihn schnell wieder hoch und wir gingen ruhig weiter, als ob nichts passiert wäre. Alles, was er sagte, war: „Verdammt nochmal, Curt.” Glücklicherweise hatte er sich nicht verletzt und sofort wieder gefan-
59
gen. Mir jedoch lief es kalt über den Rücken. Glatte oder gebohnerte Böden waren immer eine Gefahr für ihn. Diese Abendversammlungen dauerten meistens sehr lange. Die Heimfahrt mußte dann stets sehr sorgfältig vorbereitet werden.
Ich bin überzeugt, daß er es sehr schätzte, daß ich bei solchen Gelegenheiten „bei ihm war”. Seine beiden ältesten Söhne Jimmy und Elliot gingen damals zur Schule und zur Hochschule. Er wußte jedoch genau, daß meine Freundschaft und Treue für ihn mein persönliches Interesse an politischen Fragen überwog.
Beim Durchsehen einiger alter Schriften kam eine Notiz über eine große Abend-Versammlung in Carnegie Hall am 1. November 1930 zum Vorschein. Es handelte sich um die Wiederwahl zum Gouverneur von New York. Oben am Rand über der von ihm vorbereiteten Rede hatte er einige persönliche Worte über dieses große Ereignis an mich geschrieben. Ein Erinnerungsstück, das von mir besonders geschätzt wird.
60
Siebentes Kapitel
Eleanor Roosevelt I
Man sagt, die Feder sei mächtiger als das Schwert. Dann sollte aber auch jeder, der öffentlich zur Feder greift, doppelt vorsichtig sein. Es kommt hier noch hinzu, daß es für einen früheren Schwiegersohn besonders gefährlich ist, wenn er über seine ehemalige Schwiegermutter schreibt, vor allem dann, wenn sie Eleanor Roosevelt heißt. Sollten die Regeln der Marquise von Queensbury heute noch Gültigkeit haben, hat dann der Schreiber noch Aussicht zu überleben? Wenn die Aussicht auch noch so klein ist, ich wage die Herausforderung.
Manchmal taucht so ein hart gesottener Schreiber am Horizont auf und erklärt die Zeit für reif, das politische Schwert zu ziehen und die Späne fliegen zu lassen. Dies ist eine der seltenen Gelegenheiten für einen „Sammler”. Jedoch werde ich Offenheit, gepaart mit Freundlichkeit, üben, wenn ich diesen literarischen Weg einer Witwe beschreibe. Ich denke, dieses „Umherschlendern” meinerseits wird interessant sein und dazu beitragen, uns allen eine gesündere Zukunft zu geben.
Diese Bemerkung gilt allen denjenigen, die treue Bewunderer von Eleanor Roosevelt, der „Prima Donna” dieses Kapitels sind, aber auch denen, die ihrer verschiedenen Tätigkeit, vor allen Dingen während und auch nach der Zeit im Weißen Haus kritisch gegenüberstanden.
Als ich Eleanor Roosevelt zuerst begegnete, war sie eine schüchterne Hausfrau. Sie besaß einen scharfen Verstand, schien aber zeitweise ziemlich unsicher, was sie unter einer äußerlichen Ruhe verbarg. Auch schien sie zeitweise un-
61
ruhig, als ob sie ein breiteres Feld suchte, um ihre intellektuelle Tätigkeit mehr herauszustellen und persönlich stärker anerkannt zu werden.
Mit der Bezeichnung „Hausfrau” möchte ich sagen, daß sie ihre große Familie mit Hilfe eines Dieners und mehrerer Hausangestellten gut versorgte.
Ihr Gatte brauchte damals auf Grund der unglücklichen Attacke der Kinderlähmung, da er ohne Hilfe nicht gehen konnte, viel Unterstützung. Man kann jedoch ruhig sagen, daß Eleanor Roosevelt die ersten Jahre ihrer Ehe nicht am Kochtopf zugebracht hat. Bei jeder Familie, die aus Mann, Frau, einer Tochter und vier Söhnen besteht, gibt es Arbeit.
Wirtschaftliche Not hat nie lange an ihre Tür geklopft. Nie so lange, daß sie nicht schnell beiseitegefegt werden konnte, bis ein naher Verwandter die Situation meistern half. Eleanor Roosevelt hatte eine sanfte, freundliche und meist liebenswürdige Art; während der Jahre, die ich sie gekannt habe, haben wir niemals ein böses Wort miteinander gewechselt. Als ich sie jedoch näher kennenlernte, entdeckte ich bei ihr Gefühle einer unklaren Kritik, gemischt mit Unzufriedenheit, die sie von Zeit zu Zeit über die Lebensart und Ziele ihrer Hydepark- und Hudson Valley-Nachbarn zum Ausdruck brachte. Ich vermute, daß das die Leute waren, mit denen sie in Long Island und Hydepark aufgewachsen ist. Aus unbekannten Gründen schien mir dies ein rebellischer Gedankengang.
Als Gastgeberin beim Abendessen war Eleanor Roosevelt immer äußerst aufmerksam und anmutig. Jedem Gast gegenüber zuvorkommend, verstand sie es auch in der Unterhaltung, stets ausgleichend zu wirken und die Unterhaltung auf dem gleichen Niveau zu halten. Für jeden ihrer Gäste zeigte sie großes Interesse, obgleich manche langweilig waren. Alle, die um ihren Tisch herumsaßen, die großen und auch die weniger großen, kamen sich gleich
62
wichtig vor und fühlten sich in eine freundliche Atmosphäre versetzt, wodurch der Abend nicht nur freundlich, sondern auch ein voller Erfolg wurde.
Ich erinnere mich, daß ursprünglich weder politische Probleme noch irgendein Zwang zum Vorschein kamen, sondern daß eine warme, entspannte Atmosphäre herrschte. Wenn man sie auch kaum als photogene Schönheit bezeichnen konnte, so war sie für mich attraktiv, hatte Farbe und wirkliche Anmut. Ihr Lachen steckte förmlich an. Ihr Haar war schön und ganz ungewöhnlich. Ihre jungen Söhne, Franklin jr. und Johnny, besuchten die Tagesschule in Buckley, New York, und Jimmy und Elliot fuhren jeden Tag nach Groton hin und zurück. Ihre Tochter Anna war viel bei den New Yorker Tanzgesellschaften zu sehen und besuchte außerdem noch einen landwirtschaftlichen Kursus, speziell über „shorthorns” in Cornell, was für manchen lustigen Bruder in New York ein ernstes Problem bedeutete, da sie auf den Tanz warteten. Ithaka, wohl verborgen unter der weit und breit bekannten Ivy Leaf, lag nicht so nahe bei der Stadt wie manche andere Lehranstalt. Eleanor Roosevelt sorgte für ein sehr lebhaftes Haus.
Mit großem Vergnügen erinnere ich mich auch noch an manche Ereignisse, morgens gegen acht Uhr dreißig, wenn sie zur Schule mußten. Für Franklin jr. schien es im Winter besonders schwierig zu sein, seinen Schal, Gummischuhe usw. zu finden. Wenn es dann für Franklin jr. und Johnny Zeit zum Fortgehen wurde, entstand häufig in der Halle ein großer Aufruhr. Schranktüren wurden zugeschlagen, ärgerliche Kinderstimmen wurden laut und über diesen ganzen Spektakel ertönte immer schriller die Stimme von Mademoiselle, ihrer Gouvernante, in ihrem schweizerisch-französisch-englischen Akzent: „Fraunklaine! Fraunklaine!” Bald erschien dann auch seine Mutter, um Ruhe zu schaffen, und die verlorengegangenen
63
Wintersachen wurden zuletzt dann irgendwo gefunden. Mit einem milden elterlichen Verweis, wie z. B.: „Du mußt nicht so unkultiviert mit Mademoiselle umgehen”, und „sie müssen auf ihre Sachen besser achtgeben”, hörte man die Haustür zuschlagen. Unter der Obhut der entrüsteten und gequälten Mademoiselle schoben die beiden Jungen zur Schule, während der Rest der Familie, sichtlich erleichtert, ihr Frühstück beendete. Die beiden Jüngsten waren immer voll Leben und zu irgendeiner Dummheit aufgelegt. Ich mochte sie sehr gern.
Hin und wieder kamen dann auch amüsante und interessante Situationen vor, wie das oft bei großen Familien der Fall ist. Die Hochzeit von Eleanor Roosevelt fand in dem New Yorker Haus ihrer Kusine, Frau Henry Parish, statt, besser bekannt unter dem Namen „Kusine Susie”. Sie war eine immer noch sehr gepflegt aussehende, aber ziemlich verwöhnte vornehme Witwe ohne Kinder. Sie meinte, sie hätte ein besonderes Anrecht auf die Zuneigung von Eleanor Roosevelt und könnte vor der Schwiegermutter von Eleanor, Mrs. James Roosevelt, eine stärkere Zuneigung beanspruchen.
Mrs. Parish und Mrs. Roosevelt waren ungefähr in demselben Alter. Beide führten ein schweres Zepter in gesellschaftlichen Kreisen, allerdings in verschiedenen Gegenden. Dadurch entstand zwischen den beiden vornehmen Damen eine gewisse Rivalität. Die erstere war „Old New York” und die letztere „Old Hudson Valley”.
Eleanor Roosevelt genoß diese natürliche Rivalität zwischen den beiden Damen. Bei gelegentlichen Abendgesellschaften wartete sie mit einer gewissen Vorfreude und halb verborgenem Vergnügen, welche bissigen Bemerkungen hin und her fliegen würden, was dann auch geschah.
„Susie” würde, an Granny gewandt, eine sehr höfliche Bemerkung machen, aber mit einer „Spitze”, wie z.B.: „Sally, ich hätte wirklich nicht geglaubt, daß du eine der-
64
artige Idee gutheißen würdest.” Worauf Granny schnell erwiderte: „Warum nicht, liebe Susie? Ich kann gut verstehen, daß so etwas ein Rätsel für dich ist, aber das kommt davon, weil du die Sache nicht verstanden hast, ich gebe auch zu, es ist etwas schwer verständlich.”
Nicht lange danach erfolgte eine zweite „Salve” ähnlicher Art, bis es dann Zeit war, sich zu verabschieden.
„Vetter Henry”, der verständnisvolle Ehemann von Kusine „Susie”, tat immer, als ob er das- Säbelgerassel des Wortgefechtes bei der Abendunterhaltung nicht hörte. FDR wagte nicht, seine Frau oder mich anzusehen, aus Angst laut darüber zu lachen, was natürlich gar nicht am Platze gewesen wäre. Eleanor Roosevelt liebte so etwas, weil beide Damen offensichtlich um ihre Gunst buhlten. In der Tat ein großes Kompliment! Ihrerseits goß sie dann zur rechten Zeit diplomatisches öl in die schäumenden Wogen durch Bemerkungen wie: „Hör, Mama, es war wirklich eine schwierige Angelegenheit, und du weißt ja, Mama, daß Franklin dir gestern viel darüber erzählt hat. Wünscht noch jemand Kaffee?”
Meistens tat der Kaffee dann den guten Dienst. Später drehte sich das Gespräch um die Kinder sowie um den üblichen Klatsch über „Susies” Freunde, die „Sally” kannte oder umgekehrt. Als mit der Zeit die beiden vornehmen, älteren Duellanten das herannahende Alter stärker spürten, wurde die Feindschaft zwischen beiden sehr deutlich. Aber keine hat sich jemals ergeben. Nur ein einziges Mal hat Eleanor mit mir über ihren Vater Elliot Roosevelt gesprochen. Danach muß er sehr charmant und beliebt gewesen sein und war in der Gesellschaft eine anziehende Persönlichkeit wie ihr „Onkel Ted” (Theodore Roosevelt). Leider führte er später ein ausschweifendes Leben. Dies war der Hauptgrund, warum Eleanor nicht gerne Cocktails vor den Mahlzeiten servieren ließ.
Manchmal gab es Wein zum Abendessen. FDR trank in
65
der Regel seinen Martini mit den eingeladenen Herren oben in seinem Schlafzimmer, bevor er herunterkam und in seinem Wagen an den Tisch gerollt wurde.
Bis 1928 machte ich an den Wochenenden in Hydepark die Feststellung, daß Eleanor Roosevelt zufrieden und glücklich in ihrer reservierten Lage war. Ob es nun daher kam, daß sie sich bewußt war, daß sie sich im Hause ihrer Schwiegermutter inmitten ihrer Umgebung befand, oder daß sie es vorzog, sich mit einigen ihrer sie besuchenden Freundinnen zu entspannen, ist nicht leicht zu sagen. Allmählich aber änderte sich ihre Haltung. Häufig schauten Henry Morgenthau jr. und seine Frau Eleanor von dem nahe gelegenen Fishkill herein und blieben dann zum Mittag- oder Abendessen.
Die beiden Eleanors waren sehr befreundet. FDR mochte Henry gerne. Er hatte viel Spaß mit ihm. Manchmal versuchte er, sich bei Henrys häufigen Besuchen zu „verdrücken”, was aber mit dem Rollstuhl meistens unmöglich war.
Ab und zu wurde Mrs. James Roosevelt ein bißchen ärgerlich, wenn im letzten Augenblick vier oder fünf Personen ungeladen zum Essen erschienen. Dann konnte sie sehr laut sagen: „Eleanor, du mußt doch wissen, wie schwer es ist, noch extra für unerwartete Gäste zu sorgen!” Das stimmte natürlich. Unter den unerwarteten Gästen befanden sich meistens Henry Morgenthau jr. und Frau.
Zwei andere Freundinnen von Eleanor kamen ebenfalls häufig nach Hydepark: Miss Nancy Cook und Miss Marian Dickerman aus New York. Auf dem östlichen Teil des großen Rooseveltschen Gutes wurde um 1927 nach reiflicher Überlegung ein „Cottage” gebaut. Es sollte als Wochenendhaus für Nancy Cook und Marian Dickerman dienen, wohin Eleanor Roosevelt ebenfalls als Besuch zur Abwechslung gehen konnte. Es lag ungefähr eine Meile entfernt. Von diesem „Cottage” aus entwickelte Nancy
66
Cook das später sogenannte Val-Kil-Möbelunternehmen. Es entwickelte sich ebenfalls als großer Anziehungspunkt für formlose Wochenendzusammenkünfte, bei denen Mrs. James Roosevelt nicht Gastgeberin und auch nur selten eingeladen war.
Daher wurde das Cottage, um die Interessen abzulenken, bei zahlreichen Gelegenheiten Mittelpunkt einer streitlustigen und wetteifernden Unterhaltung.
Nancy Cook war eine zähe Person mit Bubikopf, die andauernd rauchte. Sie war in Messina, New York, geboren und hatte schon sehr früh einen Piek auf die Mellon-Familie und deren Aluminium Corporation of America, die anscheinend die Stadt beherrschte. Ich erinnere mich noch sehr gut an Nancys feindselige Haltung in dieser Hinsicht. Es bestand gar kein Zweifel, daß jene von ihr häufig wiederholten Ausdrücke einen tiefen Eindruck auf Eleanor Roosevelt machten, deren soziale Haltung und Urteile, unterstützt von Louis Howe, meines Erachtens einer neuen Wendung entgegenging.
Im Familienkreis wurde Nancy als „Charakter” bezeichnet. Mrs. James Roosevelt betrachtete sie jedoch als ein notwendiges „Übel”, eine Freundin ihrer Schwiegertochter. Nancy war sehr geschickt in der Herstellung authentischer Reproduktionen antiker Möbel, meistens frühamerikanische Entwürfe. Sie brachte außerordentlich schöne Sachen; nach meiner Meinung waren ihre Möbel viel wertvoller als ihre Ideologie. Da ich jedoch ihre ganz andere Weltanschauung achtete, blieben wir immer gute Freunde. Sie betrachtete mich auch als so etwas wie ein notwendiges „Übel”, zumal da ich doch von der verhaßten Wallstreet herkam.
Marian Dickerman war in ihrem Benehmen ganz anders. Immer korrekt und damenhaft. Sie war sehr interessiert in Erziehungsfragen für junge Mädchen, aufgeschlossen und zuvorkommend; in manchen Fragen bat sie mich um
67
meine Meinung und hörte auch freundlich zu. Niemals belästigte sie die Gastgeberin des großen Hauses. Marian gehörte zu denen, denen man gewisse Ideen und Ansichten vortragen und über die man nachher von verschiedenen Seiten her diskutieren kann. Mit Nancy war eine Diskussion nicht möglich.
Unter den drei Damen, Eleanor, Nancy und Marian war um jene Zeit Nancy die beherrschende Persönlichkeit. Komischerweise hatte sie genau dieselbe Denkungsart wie der immer gegenwärtige Louis Howe, der Eleanor Roosevelt fortgesetzt beeinflußte, als das „Wachs” noch weich war.
Meiner Ansicht nach ist es gar keine Frage, daß die Abneigung, die Eleanor später gegenüber den Mellons zeigte, von den vielen Bemerkungen und der Haltung ihrer alten Freundin Nancy Cook herrührte.
Wie ich mich noch genau erinnere, hat, als später die großartige Kunsthalle in Washington fertig war und von dem verstorbenen Andrew Mellon und seiner Familie dem amerikanischen Volke geschenkt wurde, die Rooseveltsche Regierung in Washington nur sehr wenig Notiz davon genommen. Sicher mag Nancy Cook in irgendeiner Weise damals ihre „Macht” ausgeübt haben, aber in meinen Augen hat die Regierung kleinlich gehandelt. Daß sie diesem wichtigen Geschenk so wenig Bedeutung beigemessen hat, ist wirklich bedauerlich.
Sonnabendnachmittags ritten Mama und Marian gelegentlich hinüber zum „Cottage”. Keine von den beiden Damen ritt wirklich gut, sie hatten beide Stuhlsitz. Die Pferde wurden natürlich sehr sorgfältig ausgesucht, weil sie ruhig sein und sich auch anständig benehmen mußten. Für mich als alter Schwadron-„A”-Reiter war das Reiten entschieden eine harte Arbeit. Für die Damen war es aber ohne Zweifel eine großartige Bewegung und eine schöne Abwechslung von dem täglichen Einerlei in New York.
68
Bei diesen Ritten trug Mama meist ein Tuch in leuchtenden Farben um ihr Haar und auch keinen richtigen Reitanzug. Sie glich vielmehr einem gewöhnlichen Reiter aus New York, der sich einen müden Gaul für einen langsamen Ritt im Central Park gemietet hatte.
Doch nun ist es wohl angebracht, Louis Howes Einfluß auf Eleanor Roosevelt zu betrachten und zwar, wie ich ihn sah. Schon lange vor 1920 war Louis ,ständiger Gast’ in FDRs Familie, was ich persönlich nie richtig verstehen konnte. Außerdem war ich an politischen Schiebungen nicht interessiert. Es ging mich auch nichts an.
Er wohnte in der 64ten Straße im Haus 49 E., in einem Zimmer in der oberster! Etage. Gewisse Stunden am Tage arbeitete er irgendwo, aber nicht in Wallstreet, dafür hatte er keinen Sinn. Mir war bekannt, daß er täglich mit FDR konferierte, aber noch mehr Zeit verbrachte er abends bei Mama, wo dann politische und ideologische Dinge besprochen wurden. Häufig gewann FDR durch sie Leute für gewisse Dinge.
Abend für Abend gab es nach dem Essen zwischen Mama und Louis ausgedehnte Gespräche im Vorderzimmer im dritten Stock. Gewöhnlich wurden anhand von Zeitungsartikeln oder Zeitungsausschnitten politische Fragen diskutiert oder diese studiert. Manchmal habe ich für einige Minuten ihrem vertraulichen Gespräch zugehört, aber meiner zufälligen und freundlichen Besuche schienen nicht in Louis’ Programm zu passen, daher verschwand ich bald wieder. Überdies hatte ich auch sehr früh den Eindruck, daß Louis Howe mich als eine Art „notwendigen Übels” ansah.
Seine frühere persönliche Erfahrung mit Wallstreet, aber auch sein vollständiger Mangel an Erfahrung mit Wallstreet schienen der Grund zu sein, daß unser Gespräch am Schluß immer in einem feindseligen Ton endete. Allerdings waren wir stets höflich zueinander und das blieb
69
auch so, bis ich 1933 eines Abends im Weißen Haus, in Gegenwart der Gattin des Präsidenten, meine „Abschiedsrede” an ihn hielt und ihm dabei Saures gab. Daher hatte der „Howe und Cook-Einfluß”, wie ich es nenne, eine große Wirkung auf Eleanor Roosevelt, woraus sich ihre vollkommen andere Einstellung gegenüber der Gesellschaft einschließlich Wallstreet ergab. Als sie dann selbstbewußter wurde und ihr politischer Horizont sich erweiterte, begann sie ihre eigenen persönlichen Ziele weiter zu stecken.
Eines war mir ein Rätsel, und das war ihre Einstellung zum Geld. 1928 stand ich mich in Wallstreet schon gut, wenn man bedenkt, daß ich als junger Mensch vor acht Jahren von „der Pike” auf lernen mußte. Im Frühjahr 1929 trat ich, versehen mit den besten Wünschen meiner guten Freunde, bei Lehman Brothers in die Investmentfirma O’Brien, Potter und Stafford in Buffalo, New York, als Gesellschafter in Vertretung des New Yorker Büros ein. In meinen vielen Gesprächen mit Mama wurde „Geld”, außer bei den gewöhnlichen Banktransaktionen, kaum erwähnt. Ich hatte das Empfinden, daß sie überhaupt nichts von Finanzierungen und über das, was Wallstreet als führender Kapitalmarkt des Landes vorstellte, wußte. In dieser Hinsicht stützte sie sich auf ihren Mann, wie er sich andererseits auf zuverlässige Quellen stützte. So lange es mir gut ging, schien sie ganz zufrieden zu sein, daß ich nicht der gewöhnliche Wallstreet-Typ war. Als später, 1929, die Panik in Wallstreet einsetzte, wurde ihre Haltung mir gegenüber kritischer, als ob ich persönlich dafür verantwortlich gewesen wäre. Letzten Endes muß also der „Howe und Cook”-Standpunkt für sie der richtige gewesen sein. Ein erschreckendes und ominöses Etwas von Finanz-Philosophie wurde mir eines Morgens in New York beim Frühstück durch Mama entschleiert, und zwar kurz nach dem Zusammenbruch.
70
Die Raserei der Oktoberpanik hatte sich gelegt, aber große Verluste, weit verbreitete Zerstörung und finanzielle Ruinen blieben noch übrig, um gewissenhaft in normale Zustände zurückgeführt zu werden. Anfang Sommer 1929 kam mein Schwager Jimmy zu mir. Er hätte von Granny ein schönes Geschenk für eine Europareise im nächsten Juni bekommen, ob ich tausend Dollar für ihn anlegen wollte. Damals war ich in unserem New Yorker Büro in Wallstreet 63. Jimmy fügte noch hinzu: „Ich möchte etwas Geld machen, Curt, ich will im nächsten Juni nach Europa fahren.” Ich erwiderte ihm: „Besser wäre es, du würdest die tausend Dollar langfristig bei einer Bank anlegen, um daraus Zinsen zu bekommen, oder Staatspapiere kaufen. Es ist verdammt schwer, Jimmy, mit tausend Dollar zu spekulieren!”
Jimmy bestand jedoch darauf, daß er Geld an der Börse machen wollte und glaubte, die Aktien würden nächsten Juni viel höher stehen. Ich bemerkte, die Preise könnten dann höher oder niedriger sein, außerdem möchte ich mir über ein so kleines Einschußkonto keine „Kopfschmerzen” machen, zumal da es von meinem Schwager käme. Jimmy bestand jedoch darauf. Er wüßte, daß er ein Risiko einginge. So gab ich schließlich nach und eröffnete mit den tausend Dollar ein Einschußkonto für ihn, das in Übereinstimmung mit den gewöhnlichen Marge-Vorschriften wie üblich in „the Street” gehandhabt werden sollte.
Nach vielen Überlegungen und mit dem Wunsche, besonders sorgfältig zu verfahren, kaufte ich für seine Rechnung einige Papiere von DuPont und einige von den National Dairy Products Stock. Nach mehreren Monaten kam dann die schicksalsvolle Woche, die mit dem 24. Oktober 1929 einsetzte! Sie war nicht, wie manche Finanzartikel häufig schreiben, „eine scharfe technische Reaktion, hervorgebracht durch einen wegen spekulativer Ankäufe nicht mehr aufnahmefähigen Markt”. Es war das lang vorbe-
71
reitete Großreinemachen. In Wahrheit war es das wohlüberlegte Scheren der Öffentlichkeit seitens der Weltfinanzmächte, hervorgerufen durch die plötzliche Knappheit von täglichem Geld auf dem New Yorker Geldmarkt. Ich werde diese Woche nie vergessen. Am 24. Oktober, an meinem Geburtstag, fing es an. Der Bericht von der New Yorker Aktienbörse lautete: 12 894 650 Aktienverkäufe. Am Dienstag den 29.: .16 410 030 Verkäufe. Mittwoch den 30.: 10 727 300. Am Donnerstag eröffnete die Börse nicht vor Mittag. Aufgezeichnet wurden 7 149 390 in Zahlung gegebene Papiere.
Jimmys Konto unterschied sich in nichts von den vielen tausend anderen Konten im Lande. In diesem Sturm der fallenden Preise ging es natürlich über „Bord”.
Obgleich ich nicht wußte, wie ich stand, disponierte ich am 25. Oktober 1929 von meinem beschränkten Kapital einen Betrag zu Gunsten Jimmys auf dessen Konto, um es für ihn wenigstens für eine kurze Zeit zu halten, in der Hoffnung, daß der Markt sich erholen würde. An jenem betreffenden Tage waren fünfhundert Dollar eine Menge Geld für mich. Der Markt erholte sich nicht. Stattdessen kam die Depression. Die Aktienkurse sanken weiter.
Eines Montagmorgens im November (um die Geschichte mit Eleanor Roosevelt über Finanzen weiter zu erzählen), saß ich in New York mit Mama beim Frühstück. Jimmy war vor zwei Tagen von Cambridge, New York, gekommen, war aber schon wieder in der Schule und Mama und ich hatten uns über einige Nachrichten aus der Morgenzeitung unterhalten.
Ich war gerade im Begriff aufzustehen, um meiner täglichen Arbeit nachzugehen, als Mama ihre Kaffeetasse hinsetzte und sagte: „Curtj ich habe gerade mit Jimmy gesprochen.” Hier wurde ihre Stimme um einen Ton höher, in einer gewissen bekannten Art, was mir sagte, daß sie sich mit etwas Ungewöhnlichem beschäftigte. „Ja”, fuhr
72
sie fort, „ich habe gerade mit Jimmy gesprochen, er sagte mir, du hättest seine tausend Dollar, die er dir damals zum Spekulieren gegeben hat, verloren.”
„Ja”, antwortete ich, „zu meinem Bedauern hat er es verloren, und die Kurse sacken weiter. Mama”, fuhr ich fort, „ich habe nicht für ihn spekuliert, sondern nur das getan, worauf er bestand. Er wünschte an der Börse zu spielen in der Hoffnung, etwas Geld zu machen. Ich hatte einige Papiere von zwei führenden Stammaktien gegen Sicherheitsleistung gekauft, aber die Panik hat sein Konto demoliert!”
„Schön”, sagte sie und setzte ihre Tasse hin, „du wußtest bestimmt, daß er die Absicht hatte, nächsten Juni nach Europa zu fahren, daher bin ich der Meinung, du solltest ihm das Geld wiedergeben!” Im ersten Augenblick war ich verblüfft. Sie sagte nicht: „Ich denke unter diesen Umständen sollten wir alle etwas tun, um ihm das Geld zu erstatten.” In diesem Falle wäre ich sofort bereit gewesen. Nicht im entferntesten hat sie so etwas gesagt! Es war wirklich plump: „Ich finde, daß du ihm sein Geld wiedergeben solltest.” Endlich, nach einer unangenehmen, langen Pause, sagte ich: „Meinst du wirklich, daß ich ihm die tausend Dollar wiedergeben soll?” „Ja”, erwiderte sie bestimmt, „der Meinung bin ich!”
Nach einer langen Pause, in der ich nicht gerade an Jimmy, sondern an vieles andere dachte, sagte ich: „Gut, Mama, ich werde es tun!”
Dieses Gespräch hat mich ganz aus der Fassung gebracht, und zwar nicht nur wegen der tausend Dollar, sondern auch wegen des überraschenden Gedankenganges und des vollkommenen Mangels, die laufende finanzielle Lage zu begreifen oder überhaupt zu erkennen, was geschehen war. Fraglos war ich bei Mama der Mann, der 1929 die Panik verursacht hatte. Diese starke Möglichkeit war niemals richtig in die Öffentlichkeit gedrungen.
73
Kurz darauf schickte ich einen Brief an Jimmy, an seine Club-Adresse - der Fly Club in Cambridge - und teilte ihm mit, daß seine Mutter mich gebeten hätte, ihm die tausend Dollar vor seiner Versetzung zurückzugeben, und daß ich dieses einleiten würde.
Jimmys Antwort liegt vor mir, einer alten Akte entnommen. Ein möglicher Vorbote einer überaus überraschenden Finanzphilosophie, die sich bald in dem knospenden New Deal enthüllte. Der Brief trägt den Poststempel Brook-lyne, Mass. 24. Dezember 1P. M. 1929 und ist auf dem Briefpapier des „Fly Clubs” geschrieben.
„Lieber Curt! Dein feiner Brief ist zu lange unbeantwortet geblieben. Ich hoffe aber, Du weißt, wie ich ihn geschätzt habe. Was die finanzielle Sache angeht - natürlich werden die tausend Dollar im kommenden Frühjahr mir sehr nützlich sein; ich möchte aber, daß Du weißt, daß ich mir bewußt bin, ,niemand wird von Aktien bevorzugt’, und wenn ich auch nichts davon verstehe, und wenn das Geld im April nicht hier ist, so weiß ich bestimmt, es ist nicht Deine Schuld. Überdies möchte ich, daß, wenn ich in Zukunft mal Geld zum Investieren habe, Du bereit bist, es für mich anzulegen.”
Persönlich hatte ich einen ungefähren Verlust von tausend Dollar auf Grund der Zusage an Mama infolge ihrer spitz vorgetragenen Bitte. Daher gab ich dem Kassierer unserer Firma den Auftrag, Jimmy „sein Geld” zu schicken.
In allen diesen Jahren haben viele fähige Schreiberlinge viele Bände über jene Dame geschrieben, die ich zuerst als Frau Roosevelt kennenlernte und die später weithin als Eleanor Roosevelt bekannt wurde. Es könnte daher so aussehen, als ob mein Hinweis auf Eleanor Roosevelt über Finanzen von einigen so angesehen werden könnte, als ob er ein „journalistischer Treffer” darstellen sollte. Ich habe über dieses Thema nie wieder mit ihr gesprochen und habe auch keine Ahnung, was Jimmy vor jener überraschenden
74
Frühstücksunterhaltung berichtet hat. Obgleich später erzählt wurde, daß Jimmy und sein Teilhaber John Sargent in kurzer Zeit sich sehr gut im Versicherungsgeschäft machten, habe ich niemals von Jimmy über geschäftliche Dinge gehört. Aus mehreren besonderen Gründen hat Mama nie bei mir ein „Beteiligungskonto” angelegt. Jimmy ging ins Ausland.
75
Achtes Kapitel
Eleanor Roosevelt II
Das Innere des Gouverneur-Wohnhauses erschien kalt und unfreundlich. Ich habe mich dort nie wohl gefühlt. Es hätte besser zu Wallstreet gepaßt, denn dort war die Atmosphäre genau so kalt und unfreundlich. Trotzdem verstand es Eleanor Roosevelt, die Gattin des neuen Gouverneurs, mit geschmackvollen und freundlich aussehenden Dekorationen dem Ganzen Wärme zu geben. Einige Veränderungen mußten vorgenommen werden, damit Präsident Roosevelt mit seinem Rollstuhl in einem Lift hinauf- und hinunterfahren konnte, was von äußerster Wichtigkeit war. Gouverneur Alfred E. Smith sowie Frau Smith nebst Schwiegersohn und Tochter, die Warners, haben alles nur Erdenkliche für den Umzug getan, wobei sie noch tüchtig durch Emily Smith-Warner und ihren Gatten unterstützt wurden.
AI Smith mit seiner tiefen Stimme, seiner Selbstsicherheit und seiner unentwegt brennenden Zigarre sowie mit seinem derben, jedoch herzlichen Wesen hat mich immer von neuem gefesselt. Wenn auch unsere Begegnungen stets sehr kurz waren, so erwiesen sie sich doch immer als interessant. Gouverneur Smith hatte einen harten Weg hinter sich. Er stammte aus der Fulton Street Fish Market, jenem Teil von New York City, der die Eingangstür oder aber auch die Hintertür zu Wallstreet darstellte, je nachdem, wie man es nennen will. Gelegentlich stank Wallstreet nach Fisch. Manchmal aber auch rochen die Fischjungens nach Wallstreet. Deswegen auch mein Interesse für den Gouverneur Al Smith.
76
Ich traf Gouverneur Smith nur selten, lediglich an den Abenden der Demokratischen Partei, wenn Roosevelt mich bat, ihn zu begleiten. Und das tat ich gern, schon allein wegen der verschiedenartigen Stufen, zumal da das Hinauf- und Hinuntergehen vom Rednerpult uns vor unserer Ankunft unbekannt und für FDR schlecht geeignet war. Wiederholt war auch Herbert Lehman dort anzutreffen und ein oder zweimal Rascob. Ebenfalls waren die demokratischen Führer von Bronx und Brooklyn meistens dort.
Rascob, von Wilmington, Delaware, machte auf mich den Eindruck eines Abseitsstehenden, mit einem Gesicht wie ein Schreckgespenst. In der Demokratischen Partei war er überaus tätig, und zwar an führender Stelle. Die meisten politischen Gespräche spiegelten die stimmenfangenden Ansichten der Leute wider, die in der Demokratischen Partei die Reden vorbereiteten. Sie folgten damit einem bekannten Vorbild. Ich erinnere mich noch einer Gelegenheit, bei der geplant war, daß Al Smith im Hause von Frau James Roosevelt im Hydepark einem privaten politischen Zusammentreffen beiwohnen sollte. Ein besonderes, reichlich amüsantes Problem entstand, das einigen der politisch gebildeten Gemüter Sorge bereitete. Es handelte sich nicht etwa darum, welche Punkte zur Diskussion standen, sondern um das Problem, was Al Smith mit seiner abgekauten Zigarre machen und ob er vielleicht auch nach jenem so viel gebrauchten Messingspucknapf verlangen würde, jenem berühmten Inventar der „streitbaren” politischen Tätigkeiten des 19. Jhs., das nicht einmal in dem Privatbüro von J. P. Morgan sen. fehlte. Jenes besondere messingne Ausstattungsstück konnte indessen so leicht nicht herbeigeschafft werden, es sei denn vielleicht aus dem Gewächshaus von Sara Delano Roosevelt. Immerhin, die Planer hatten vorauszudenken, um für die notwendige Bequemlichkeit eines Gouverneurs bei wich-
77
tigen politischen Zusammenkünften zu sorgen. Der gute, alte Tom Lynch von Poughkeepsie löste geschickt das Problem, indem er eines dieser glitzernden Messingdinger für einige Zeit auslieh und nach Hydepark schickte.
Die demokratische Politik konnte so ohne „Verkehrsstockung” seitens der „Old-Hudson-Valley-Aristokraten”, die bereitwillig das Haus für die Zusammenkunft bereitstellten, ihren Weg weitergehen. Tom Lynch ließ sich nicht von dem ihm noch unbekannten trügerischen „Leih- und Pacht”-Begriff blenden. Das kam erst später. Daher gab er rechtzeitig das Messingprunkstück an den Verleiher zurück. Das war frühere amerikanische Diplomatie, wie sie besser nicht sein konnte!
In Albany und auch anderweitig entfaltete sich der einflußreiche Kreis von Eleanor Roosevelt immer mehr. Das goldene Staatssiegel von New York auf den Briefbogen, das ihr Gatte für Staatskorrespondenz benutzte, war sehr eindrucksvoll! Die pflichtschuldige Reaktion darauf konnte man nicht als inkonsequent bezeichnen. Hatten sich die Befürchtungen von Eleanor Roosevelt in den früheren Jahren, daß ihre Oyster-Bay-Verwandten es „wirklich geschafft” hätten, nicht bestätigt? Waren sie und ihr Gatte doch nicht in Vergessenheit geraten. Größere und hellere Zukunftshoffnungen erschienen am Horizont.
Selbst die Panik von 1929 erschien in einem akademischen Licht in der nun vor ihnen liegenden glücklichen Zukunft. Eine Panik oder gar Depression konnte natürlich niemals wiederkommen. Sicher, im Sommer 1932 waren die hellen, neuen Tage gerade „rund um die Ecke herum”, und in dieser Hinsicht besuchten jene Leute, die diese „Ecke” kontrollierten, FDR und instruierten Louis Howe. Es kam darauf an, das richtige Bild zu zeigen, dann war Zeit für die Jubeljahre. Während Mama vor Albany beim Verlassen ihres Stadthauses am Morgen eine normal gefüllte Aktentasche trug, war diese jetzt zehnmal so dick.
78
Unglücklicherweise war für mich der „Horizont” in Wallstreet nicht so hell und klar und breitete sich auch nicht in demselben Maße aus. Die Arbeit dort wurde nicht von einem Zauber umgeben, nichts fiel vom Himmel. Bei gelegentlichen Wochenendbesuchen in Hydepark erkannte man die „neue Richtung” in der Politik ganz augenscheinlich. Fraglos konnte die fähige Frau des neuen Gouverneurs wertvolle Verbindungen handhaben und sich auch gut mit inoffiziellen Pflichten befassen. Sie tat nur dieses eine, und zwar mit größtem Geschick. Ihrer Schwiegermutter entging diese Entwicklung nicht. Doch sie konnte nicht gegen den starken politischen Strom anschwimmen und gegen die immer weiter zunehmenden Anforderungen. Ihr Interesse galt in erster Linie ihrem Sohn und ihren Enkelkindern.
Die Mutter des neuen Gouverneurs verzichtete unauffällig auf manche ihrer eigenen privaten Gefühle, um mit ganzem Herzen an dem neuen Spiel teilzunehmen, in dem ihre Schwiegertochter mitten auf der Bühne eine Hauptrolle spielte. Mit dem Kommen des neuen Tages verblaßte die frühere Bedeutung des Hauses Hydepark mit allem, was es enthielt. Die Politik trat allmählich immer stärker in Erscheinung, um schließlich zur unanfechtbaren Göttin zu werden. Im Laufe der Zeit trat auch die Familie immer mehr zurück und verlor ebenfalls an Bedeutung.
Die Jahre der von Eleanor Roosevelt genossenen sozialistischen Schulung durch Louis Howe, Nancy Cook und andere begannen ihre Früchte zu tragen. Die demokratischen Politiker, die nach einem „Sündenbock” suchten, zeigten mit ihren Fingern auf Präsident Herbert Hoover. Der Börsen-Krach war natürlich seine Schuld. Er war der Sündenbock, auf keinen Fall aber waren die Eine-Welt-Bankiers mit ihrer Kreditkürzung und ihren Blankoverkäufen, die durch eine sehr gut belohnte „Frechheit” verursacht waren, die Schuldigen.
79
Mitte 1929 hatten die Welt-Finanzleute sich ausgerechnet, daß es Zeit wäre, 1932 einen Wechsel in der Regierung vorzunehmen. Sie achteten darauf, daß die Erholung von dem „Krach” bis nach der Amtseinsetzung ihres Kandidaten Präsident Franklin D. Roosevelt 1933 aufgeschoben würde, um dann den größtmöglichen finanziellen und politischen Profit einheimsen zu können.
Selbst vielen Dilettanten wurde es klar, daß die „Kutscher” der demokratischen Politfahrzeuge nicht mit Präsident Hoover zusammenzuarbeiten wünschten, um so manche Bank Ende 1932 und Anfang 1933 vor dem Konkurs bewahren zu können. Sie wollten diese finanzielle Schlamperei noch auf die Spitze treiben und zunächst am 4. März eine vorteilhafte politische Aktion starten und dann den Eingeweihten die größten Profite zukommen lassen, indem sie alle wünschenswerten „Stücke” zu allerniedrigsten Preisen kauften. Viele Menschen hatten jedoch das Empfinden, daß Präsident Hoover starke Parteianstrengungen zugunsten jener Bürger unternahm, deren Aktien sich in der Hand „unzuverlässiger Banken” befanden. Er wurde deshalb von der nachfolgenden demokratischen Regierung und ihren finanziellen Hintermännern abgelehnt und begegnete hier einem engstirnigen politischen Opportunismus.
Zurückgekehrt zum Osten nach einer erfolgreichen demokratischen Tagung, las ich, daß der designierte Präsident Roosevelt und seine Gattin die Reise unterbrochen hätten, um in Massachusetts dem alten Oberst E. Mandell House einen Besuch abzustatten. Er war bekanntlich der frühere enge Berater des Präsidenten Woodrow Wilson. Es war für mich von äußerstem Interesse, die Namen derer zu erfahren, die bei Oberst House waren und was sich dort ereignet hatte. Hatte House an Howe eine Frage gerichtet oder Howe an House? Das scheint deshalb wichtig, weil wahrscheinlich beide Männer gleichzeitig anwesend waren
80
und eine Zeitlang und im Auftrag derselben Mächte dafür Sorge zu tragen hatten, daß die richtige „Munition” den künftigen „großen Kanonen” überbracht wurde, um sie auf der politischen Bühne entsprechend zu verwenden.
1929 begann Roosevelt sich mehr auf seine Gattin zu verlassen und darauf, ihr zu helfen, zumal da der Drang der Geschäfte sich auf zwei verschiedenen Gebieten vergrößerte: Erstens war sie seine fähige Genossin und zum Resonanzboden in politischen Fragen geworden; zweitens half sie ihm sehr bei der Auswahl der zahlreichen Besucher, denn es gab viele, die nur seine Zeit und Gesundheit vergeudeten, während sie ihm nur geringe Vorteile boten. Es besteht wohl keine Frage, daß Eleanor Roosevelt die Rolle, die Frau Edith Galt Wilson in den letzten Jahren ihres Gatten bei Präsident Wilson spielte, überbot. Diese parallele Situation würde zu einer interessanten vergleichenden Studie Anlaß geben. Ein auffallender und aufschlußreicher Unterschied bestand allerdings. Frau Wilson verstand sehr wohl das internationale Programm, doch ihre Ansicht darüber war recht unklar und sie hat daher wohl kaum ihren Gatten beeinflußt. Eleanor Roosevelt dagegen förderte ein solches Programm in vieler Hinsicht, und zwar aus egoistischen Gründen. Der Weg vieler bedeutender Persönlichkeiten, die den Präsidenten zu sprechen wünschten, führte nämlich über seine Gattin oder Louis Howe und später über Grace Tully.
Fräulein Margarite Le Hand und Grace Tully waren jedoch vornehme und sehr fähige Damen, eine wahrhafte Ergänzung zur Spitze des Sekretariates im Weißen Haus. In zahlreichen Fällen arbeiteten sie natürlich eng mit dem Präsidenten zusammen. Harry Hopkins hatte man inzwischen sorgfältig „dressiert”. Er wurde dann zur rechten Zeit der Exekutivgruppe des Weißen Hauses beigegeben für den Fall, daß Louis Howes Gesundheit nachließ.
81
Nach 1933 sah ich meine frühere Schwiegermutter nur selten. Mehr und mehr bildete sie den Inhalt von Schlagzeilen in der Presse. Nur gelegentlich wechselten wir Briefe. Eine der letzten Begegnungen, die ich mit ihr hatte, war ein kurzes Zusammentreffen in New York City, das, was mich betraf, nicht ohne amüsante Streiflichter war.
Wenn ich mich recht erinnere, war dies im Winter 1934. Angeblich hatte Franklin jr. über mich zu jemand anderem eine unfreundliche Bemerkung gemacht, die mir zu Ohren gekommen war, die aber weder richtig noch aber auch berechtigt war. Obgleich ich bezweifelte, daß Franklin jr. so etwas gesagt hätte, wollte ich ein für allemal Schluß mit derartigen unrichtigen Behauptungen über mich machen. Seine Mutter schien mir mit ihrer mütterlichen Autorität und der dortigen Atmosphäre die richtige Person, die Sache wirkungsvoll in die Hand zu nehmen. Demgemäß rief ich ihre Sekretärin an und bat um eine Unterredung in New York, um ihr die Sache zu erzählen und sie um Unterstützung zu bitten.
Die Unterredung sollte einige Tage später morgens um 9 Uhr in ihrem Apartement in New York stattfinden. Ich kam zur angegebenen Zeit in ihre Wohnung am Washington-Platz und war überrascht, dort Harry Hooker, einen bekannten New Yorker Rechtsanwalt und engen Freund von FDR, in dem kleinen Foyer vorzufinden. Wir hatten immer zueinander in einem freundschaftlichen Verhältnis gestanden. Er hatte meine Scheidungsschrift vorbereitet, die Roosevelt lesen und begutachten sollte. Aus diesem Grunde wurden wir Freunde. Wir unterhielten uns vergnügt miteinander, bis kurz darauf Frau Eleanor Roosevelt eintrat und uns freundlichst begrüßte. Ich erwiderte ihren Gruß genau so zuvorkommend. Dann wandte ich mich Harry zu und sagte: „Harry, du warst vor mir hier, geh’ zuerst, ich kann warten.”
Bei dieser Bemerkung geriet Harry in Verlegenheit, eben-
82
so Eleanor Roosevelt, was mich ein wenig überraschte, da plötzlich die ganze Situation zwischen uns äußerst peinlich zu werden begann. Harry suchte die Situation zu retten, indem er sagte: „Curt, ich bin nur auf einen Sprung hereingekommen, um möglicherweise Eleanor helfen zu können in der Angelegenheit, die du im Sinne hast.” Wobei meine frühere Mama ganz schnell hinzufügte: „Ja, Curt, ich habe Harry gebeten, für einen Augenblick hereinzukommen, und hoffe, daß er uns helfen kann.” Ich sah, wie ihre Hände dabei zitterten, als sie an der Tür stand. Sofort erwiderte ich: „Sicherlich brauchen wir Harry in dieser Sache garnicht zu bemühen. Alles, was ich wollte, ist nur, dich zu bitten, Franklin jr. zu verwarnen, unwahre Behauptungen über mich aufzustellen, was er getan hat.” Sie atmete, sichtlich erleichtert, auf und sagte: „Das werde ich bestimmt tun! Willst du nicht hereinkommen, Curt?” „Nein”, sagte ich, „vielen Dank, ich bin sicher, du hast heute noch dein übliches anstrengendes Programm zu erledigen, daher möchte ich jetzt gehen.” Beiden sagte ich ein herzliches „auf Wiedersehen” und ging fort.
Auf meinem Weg zur Stadt grübelte ich in der Untergrundbahn darüber nach, warum die Frau des Präsidenten es wohl für notwendig hielt, einen Anwalt zur Hand zu haben und das ausgerechnet bei mir. Offenbar hatten sich bereits anderweitig mit einigen anderen Anverwandten „kritische Situationen” entwickelt. Auf jeden Fall hatte ich mit meinem kurzen Besuch Erfolg.
In den darauf folgenden Jahren erkannte ich, daß Eleanor Roosevelts politische Ideologie sich ganz augenscheinlich ständig weiter nach links entwickelte. Im Gegensatz dazu neigte meine nach der konservativen Seite hin.
Der trügerische betonte Klang von Pearl Harbor, die prosowjetischen Friedensbestrebungen am Schluß des 2. Weltkrieges, die Weigerung General Eisenhowers gegenüber General Patton, der ein exaktes militärisches Ziel errei-
83
chen wollte, nämlich Berlin zu nehmen, Eisenhowers unerhört grausames Zwangswohnraumbeschaffungs-Programm, die Berlinkorridor-Anordnung, dann die Verschickung unserer US-Geldplatten, Papier und Tinte an die Sowjets, damit diese uns berauben und auf Harry Hopkins Veranlassung rupfen konnten, und schließlich die tragische Sache des Gouverneurs Earle, den Zweiten Weltkrieg nicht eher zu beenden (was später behandelt wird), alle diese Dinge schienen mir nicht richtig zu sein und haben mein Gemüt sehr beunruhigt.
Andererseits hatte Joe Stalin mit Hilfe seiner Verbündeten und Handlanger auf beiden Seiten des Atlantik vollen Erfolg, „diese schmutzige Wäsche” von FDR auszunutzen und zu mißbrauchen, d. h. also auch unser Land und mich. Merkwürdigerweise hatte es Stalin nicht einmal schwer, das zu tun. Die Ergebnisse waren genau das, was einige Berater (Council on Foreign Relations) und auch andere Leute wollten. Die Pläne wurden Wirklichkeit und ein unerwarteter Glücksfall für die Sowjets.
Ich bin überzeugt, daß in die oben erwähnten Ereignisse Eleanor Roosevelt stark verwickelt war. Es ist mehr als zweifelhaft, ob sie ihren Einfluß dahin ausübte, ihnen entgegenzutreten oder sie zur Entfaltung zu bringen.
Ich bin Harry Hopkins nie begegnet, aber sicher, daß er ein vollkommen höriger Agent für die internationalistische Führungsspitze war, die ihn mit der Absicht ins Weiße Haus brachte, seine „Pflicht” ganz in der Nähe des Präsidenten zu erfüllen.
Eleanor Roosevelts Wissen über die „südlichen” rassischen Beziehungen waren sehr oberflächlich. Sie betrachtete die Sache mehr vom politischen Standpunkt aus. Es war ihrerseits gewiß eine kluge, wenn auch bedauerliche Stimmfangangelegenheit, der natürlich bei weit verbreiteten kommunistischen Gruppen und links eingestellten Zeitungen lauthals Beifall gezollt wurde.
84
Die aus dieser politischen Safari entstandenen beunruhigenden Wirkungen und aufrührerischen Folgen dürfen auf keinen Fall unterschätzt werden.
In diesem allgemeinen politischen Sektor ist wohl ein Wort über die NAACP angebracht. Diese Organisation wurde geplant und ins Werk gesetzt sozusagen als eine Gestaltung eines hochtönenden politischen Umbruchs. Sie wurde hauptsächlich von einigen Internationalisten finanziert und verwaltet, die offenbar gewillt waren, die Rassenspannungen sogar bis zur Gefährdung der bürgerlichen Ordnung auszubeuten. Die NAACP ist wichtigen Finanzierungen gegenüber immer zugänglich gewesen und zu einer „solchen Stellung” emporgestiegen, daß sie nun ein sehr wertvolles Juwel in der Krone der sozialistisch-kommunistischen Streitkräfte darstellt. Glücklicherweise haben die meisten unserer farbigen Bürger ein tiefes Mißtrauen gegenüber dem von den Führern in der NAACP gezeigten Egoismus; fraglos ist dieses Gefühl gut begründet. Das Recht, das von allen Rassen und Religionen geschätzt wird, nämlich in erster Linie danach zu trachten, das Leben und die Freiheit zu genießen und nach Glück zu streben, hat gewiß Wert. Das Wort Trennung gleicht einem zweischneidigen Schwert, das nach beiden Seiten schneidet. Sowohl die Majoritäten als auch die Minoritäten lieben es, auf zahlreichen Gebieten zu trennen. Eine Tatsache, die nur zu gut bekannt ist.
Die Worte gleich und Gleichheit werden häufig sehr fahrlässig gebraucht und scheinen die Lieblingsausdrücke der Bildmacher und ihrer Zeitungsartikelschreiber bei zahlreichen Gelegenheiten zu sein. Nirgendwo auf Erden existiert indessen Gleichheit mit Ausnahme des göttlichen Wertes für jede menschliche Seele. Gleichheit ist eine Fabel. Nirgendwo in der Natur besteht sie, vielleicht nur in den von Qualm gefüllten Räumen gerade vor den Wahlen. Doch sind das nichts als Worte, die uns grausame, fal-
85
sche Bilder vorgaukeln und die die meisten von uns verwirren und betrügen.
Aus diesen Betrachtungen heraus ist es leicht zu verstehen, daß Eleanor Roosevelt und der Verfasser dieses Buches, ihr früherer Schwiegersohn, mit der Zeit zu Ansichten gelangten, die, durch ein politisches Teleskop gesehen, sich weit voneinander unterschieden. Ich anerkenne, daß beide Seiten eines Teleskops in ihrem entsprechenden Bereich von Nutzen sind. Wenn ich mir aber die Liberalen so ansehe, habe ich auch festgestellt, daß sie nicht mit einem Übermaß an geistiger oder weitschauender Geschmeidigkeit gesegnet sind.
Eine gute Eigenschaft von Eleanor Roosevelt, die ich immer an ihr bewundert habe, war ihre grenzenlose Treue zu ihren fünf Kindern. Ganz einerlei, was geschehen war oder was vorging, sie war immer da und gab ihnen ihre volle Unterstützung.
Mir aber scheint die Treue zum Vaterland, zu unserer konstitutionellen Republik ebenso wichtig wie die Treue zur Familie. Ich habe mich oft gefragt, ob das große Interesse, das Eleanor Roosevelt an diesen so zweideutig geschaffenen Vereinten Nationen zeigte, nicht allmählich ihre viel wichtigeren Pflichten gegenüber ihrem Vaterlande überschattete.
Es war schwer für mich, damit fertig zu werden, daß Eleanor Roosevelt, der ich in vielen Jahren so nahe gestanden hatte, bewußt eine führende Rolle in der internationalen UNO-Gemeinschaft spielen wollte. Im Grunde ist die UNO nichts anderes als eine internationale Banken-Vereinigung, die von einer kleinen Gruppe nach Profit und Macht strebenden „Eine-Welt-Revolutionären” geschaffen ist, nur um ihren Hunger nach Geld und Macht zu stillen.
Augenscheinlich sind die wirklichen Ziele der Führer dieser Eine-Welt-Regierung und die ihnen stets nahestehen-
86
den Bankiers sehr abwegig. Dank der Schaffung und Einrichtung der im Privatbesitz befindlichen Federal Reserve Bank haben sie jetzt die volle Kontrolle über das Geld- und Kreditwesen der Vereinigten Staaten erreicht. Ihr jüngster Plan ist es, den geistigen Hintergrund aller Volker zu entwurzeln und allmählich zu vernichten. Ursprünglich war das Christentum ihr erstes Ziel, dann das Judentum und zum Schluß die anderen Religionen. Es ist absolut notwendig für sie, dieses trübe Programm durchzuführen, und zwar, wenn irgend möglich, noch bevor sie ihre gottlose Macht erlangt haben, um ihr Ziel zu erreichen, nur einige wenige zu bereichern, aus uns, den vielen aber, ihre Werkzeuge zu machen.
Wenn man das Wort Frieden hört oder liest, das so häufig von den führenden Männern der Vereinten Nationen für ihre politischen Zwecke in den Mund genommen wird, so fragt man sich: Wessen Friede? Jede Regierung und jeder Mensch haben ihre eigene Deutung für dieses Wort. Häufig ist es nur ein verschwommenes Bild, das benützt wird, um geschickt irrezuführen und zu verwirren.
Hinsichtlich der Bedeutung von Eleanor Roosevelts Beitrag zum Fortschritt oder Niedergang ihres Landes scheint es mir doch so, daß eine Person allein diese Aufgabe nicht bewältigen kann. Ich habe das Empfinden, daß nach 1932 ihre politischen und ideologischen Verwicklungen im wachsenden Maße immer ungesunder wurden. Ich bedaure, sagen zu müssen, daß ihr Bestreben zusammen mit dem ihres Gatten in starkem Maße das Eine-Welt-Programm unterstützte, das seiner Bedeutung nach von den unzuverlässigen Sowjets, die heute das russische Volk beherrschen, veranlaßt wurde. Ihr führender erster Mann Nikita Chruschtschow besaß die Überheblichkeit, uns einmal zuzurufen: „Wir werden euch begraben!” Es ist natürlich leicht für ihn, so etwas zu sagen, aber er ist im Irrtum. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
87
Ich kann einfach nicht verstehen, warum die Ziele des international-sozialistisch-kommunistischen Programms Eleanor Roosevelt in so starkem Maße angezogen haben, daß sie ihnen die stärkste Unterstützung gewährte, es sei denn, es wäre ein wirklich lukratives Geschäft gewesen. Im großen ganzen gesehen, waren die durch ihr Auftreten erreichten Erfolge eigennützig. Auf die wahren Interessen ihres Vaterlandes nahm sie keine Rücksicht.
Zweifellos werden einige unter den ersten Männern des Außenpolitischen Rates oder ihre sorgfältig zurechtgemachten Beauftragten mit mir über den Wert ihrer Bemühungen streiten. Ich nehme jedoch an, daß ihre Stellungnahme zu dieser zarten Angelegenheit, falls sie überhaupt erfolgt, der Erwähnung wert sein dürfte.
88
Neuntes Kapitel
Chicagoer Konvention und Senator Huey Long
Ich beschloß, der nächsten Versammlung der Demokraten in Chicago beizuwohnen, um zu schauen und zu prüfen, ob ich mit etwas Takt Roosevelt zur Aufstellung für die Wahl verhelfen könnte. Ich erzählte Louis Howe, daß ich auf meine Kosten dorthin gehen wolle, und daß, wenn ich ihm irgendwie helfen könnte, er es mich wissen lassen sollte. Er sah mich schweigend ganz groß an, in der wohlbekannten Geste völliger Ungläubigkeit. FDR war noch in New York.
Bei meiner Ankunft in Chicago hatte ich das Empfinden, als ob ich an einer Versammlung der Emissionsbanken teilnähme und nicht an einer politischen Versammlung. Ich war mir vollkommen selbst überlassen, ohne jede Verantwortung für irgend jemanden. Es war interessant und auch aufregend. Dann traf ich mit Jim Farley zusammen, sagte ihm, wo ich abgestiegen sei, und daß ich ihm gerne zu jedem Dienst zur Verfügung stünde, was es auch immer sei. Jim war genau so großartig wie fleißig; er dankte mir herzlich. Dann fing die Versammlung an.
Als ich so durch die Hauptgeschäftsstelle schlenderte, traf ich zufällig einen meiner an einer Emissionsbank tätigen Freunde, Tom K. Smith, z. Z. Vize-Präsident der Boatman Bank in St. Louis in Missouri. Er schien sich über die politischen „Grundregeln” und über seine eigene Rolle nicht ganz klar zu sein. Da ich es auch nicht war, waren wir beide heilfroh, uns zu treffen.
„Was machst du hier, Curtis”, fragte er. „Für meinen Schwiegervater FDR die Werbetrommel rühren oder es
89
wenigstens versuchen”, sagte ich. „Was machst du denn hier, Tom?”
„Ich bin hier mit Tom Pendergast und seiner Missouri-Delegation. Wir sind für Senator Rankin”, erwiderte er. „Wen hast du genannt, Tom?” fragte ich. „Rankin, Senator Rankin. Hinter ihm steht die Pendergast-Organisation. Er ist ein Einheimischer. Wir sind der Meinung, daß er gute Aussichten hat, gewählt zu werden.” In diesem Augenblick ging es mir wie eine Erleuchtung durch den Kopf und in Erinnerung an Louis’ Augenaufschlag, der mich ein bißchen störte, entschied ich mich, die Karten auf den Tisch zu legen.
„Was sagst du, Tom? Wofür hat Rankin eine Chance?” Er sah mich dabei ganz erstaunt an. „Nun, natürlich für die Ernennung zum Präsidenten!”
Ich gedachte, ihn zu bluffen. „Tom”, sagte ich, „du bist doch Bankier, sei nicht so dumm, Rankin hat nicht die geringsten Aussichten; Roosevelt gewinnt, daran ist nicht zu tippen. Wo ist deine Missouri-Delegation jetzt?”
„Sie haben eine große Versammlung in der Zentrale, ich muß jetzt bald dort hingehen.”
„Tom, wenn du dort hingehst, sage Pendergast, daß ich ihn genau in einer halben Stunde aufsuchen werde.” Ich sah auf meine Uhr. Er sah ziemlich unglücklich aus und sagte: „Tu das bitte nicht, Curtis, sie werden dich gar nicht gerne dort sehen. Überdies sind sie sehr zäh. Man könnte dich einfach hinausdrängen. Tue es nicht, bitte!”
„Tom”, sagte ich, „in einer halben Stunde bin ich da.” Er ging sofort weg, gänzlich aus der Fassung gebracht. Kurz darauf nahm ich ein Taxi und fuhr zu der von der Missouri-Delegation abgehaltenen wichtigen Versammlung, wartete dort zehn Minuten, und genau auf die Minute ging ich den langen Korridor entlang, an dessen Ende der Versammlungsraum war. Dort, die Tür versperrend, stand ein großer, stämmiger Mann. Man konnte sofort sehen,
90
daß er nicht viel Federlesen mit einem machen würde. Argwöhnisch und eindringlich sah er mich an. „Was wollen Sie!” fuhr er mich an. Liebenswürdig erwiderte ich: „Mein Name ist Curtis Dall. Ich komme von der Roosevelt-Delegation von der demokratischen Zentrale und möchte gerne ganz kurz Herrn Tom Pendergast sprechen. Herr Tom Smith ist in der Versammlung und ist über mein Kommen unterrichtet.”
Der Mann zögerte einen Augenblick, öffnete die Tür ein wenig und sprach zu jemanden, der gerade bei der Tür stand. Durch den Schlitz konnte ich sehen, daß viele Leute dort versammelt waren und daß jemand zu ihnen sprach. Nach weiterem Geflüster hinter der teilweise geöffneten Tür wurde diese etwas weiter aufgemacht, und ich sah ganz in der Nähe Tom Smith blasses und aufgeregtes Gesicht. Ein Mann trat brüsk vor und fragte mich: „Was wollen Sie?” Mit seiner rauhen Stimme brüllte er mich an: „Ich bin Pendergast!”
„Herr Pendergast”, sagte ich, „Herr Pendergast, ich komme von der Roosevelt-Delegation und bin heute früh herübergekommen, um Ihnen zu sagen, Sie täten klug daran, wenn Sie sich Roosevelt anschließen würden - tun Sie es sofort!”
Wütend starrte er mich an. „Junger Mann, wenn ich Ihren politischen Rat haben will, werde ich Sie schon fragen!” Die Tür wurde darauf kurz zugeschlagen, und der Wächter zeigte mit seinem Daumen in einer nicht mißzuverstehenden Art, daß ich verschwinden sollte, was ich auch tat, wobei ich mir überlegte, was sich daraus ergeben könnte. Immerhin, es war eben eine Spekulation und selbstverständlich schickte ich diese Botschaft an „Garcia”. Wie furchtbar erschrocken Tom aussah! Louis Howe würde nicht im Traume daran gedacht haben. Mit einem Taxi fuhr ich zu meinem Hotel zurück, nahm meine Briefe, kaufte eine Zeitung, sah flüchtig auf die Schlagzeilen und
91
wollte auf mein Zimmer. Ich hatte vor, mit einem alten Bankfreund zu Abend zu essen.
Gerade als ich mein Zimmer betrat, schrillte das Telefon. Tom Smith meldete sich. Er schien furchtbar aufgeregt zu sein. „Curtis, nach deinem Fortgang hat sich hier alles überschlagen. Unsere Delegation ist im Begriff, von Rankin zu Roosevelt überzugehen. Tom Pendergast bat mich, dir und Gouverneur Roosevelt für deinen rechtzeitigen Besuch zu danken und bittet zu entschuldigen, daß er ein wenig kurz zu dir war. Gleichzeitig möchte er auch wissen, wo er mit Louis Howe oder Jim Farley Verbindung aufnehmen kann.”
Ich unterrichtete ihn entsprechend und sagte: „Tom, das ist wirklich ausgezeichnet, aber bitte, vergiß nicht, Herrn Pendergast zu sagen, er solle Louis Howe hinsichtlich Missouri unterrichten, daß ich sie rechtzeitig drängen würde, zur Partei FDRs zu stoßen. Missouri ist ein Liebling von FDR. Vergiß nicht, Tom, das Wort ‚rechtzeitig’ zu gebrauchen.”
„Selbstverständlich tue ich das, Curtis. Es war wirklich blendend, daß ich dich getroffen habe. Ich werde dich morgen aufsuchen und vergiß nicht, bei mir hereinzuschauen, wenn du in St. Louis bist.” So kam Missouri „rechtzeitig” zu FDR.
Fraglos erlebte Tom eine turbulente halbe Stunde nach meinem Fortgehen von Tom Pendergast, aber er wurde auch für seinen eifrigen und rechtzeitigen politischen Scharfsinn belohnt. Es dauerte nicht sehr lange, bis Tom Vorsitzender der Boatsman Bank wurde und dann Präsident des Aufsichtsrates. In späteren Jahren habe ich mich oft gefragt, ob nicht zufällig ein gewisser vielversprechender Missouri-Politiker mit Namen Harry S. Truman damals auch in der „Rankin-Delegation” gewesen war. Ich hatte niemals das Vergnügen, ihn zu sprechen oder zu treffen.
92
Als die aufregende Versammlung zu Ende ging, FDR den Sieg davon getragen und die Ernennung angenommen hatte, packte ich meine Sachen und fuhr von Chicago nach New Orleans, um meine Geschäftsreise fortzusetzen. Im Zug ging ich sofort in den Speisewagen, um der ihm zuströmenden Menge vorauszusein. Nach dieser Versammlungstätigkeit war ich ziemlich abgespannt und froh, allein zu sein. So bestellte ich mir ein schönes Steak, suchte mich zu entspannen mit der Absicht, früh ins Bett zu gehen. Als der Kellner mir nach dem Essen die Rechnung brachte, dachte ich, er hätte sich geirrt, denn sie betrug 17 Dollar. Ich sagte: „Herr Ober, diese Rechnung …” In diesem Augenblick ertönte lautes Gelächter von dem Tisch hinter mir auf der anderen Seite des Wagens, an welchem vier Männer saßen. Es waren Huey Long mit einem Freund und Joe Messina, seine persönliche Leibwache und noch ein Herr. Huey winkte mir zu und sagte: „Ist alles in Ordnung, Curt, vielen Dank! Heute abend essen wir alle Steaks, meins ist ausgezeichnet, gerade richtig!”
Der hatte wirklich Nerven. Fraglos hatten sie einen Witz auf meine Kosten gemacht, das war sicher. Mir kam die ganze Sache drollig vor, und so bezahlte ich die Rechnung. Dann, als einer der Männer fortging, setzte ich mich neben Huey und bestellte nochmals Eiscreme, diesmal war Huey an der Reihe. Wir unterhielten uns über dieses und jenes bei der Versammlung und über andere Dinge. Er fragte mich, wo man mich in New Orleans erreichen könnte. Ich sagte ihm, durch einen Klassenkameraden, Willis Wilmot, in der Hibernia-Bank. Er sagte, er wolle mir zu Ehren dort ein Frühstück geben, was er dann auch tatsächlich bei Antoine getan hat.
Ein Frühstück in New Orleans bei Antoine macht Spaß, zumal da das Essen immer ausgezeichnet ist. Die Austern von Bayou Cook und ebenfalls die Lynhaven-Austern von Norfolk sind wirklich das „höchste aller Gefühle”; leider
93
sind beide jetzt nur noch eine Erinnerung aus der Vergangenheit.
Am Schluß des Frühstücks sagte Huey: „Gurt, wir müssen von diesem Beisammensein ein Bild für mein Buch haben. Ich möchte ein Buch haben, um immer mit den Jungens in Washington Schritt halten zu können.” Jemand überreichte ihm ein Buch.
Plötzlich zog er aus seiner Tasche einen kantigen Priem eines harten Kautabaks und bot ihn mir an mit den Worten: „Nimm doch einen Priem, Curt.” „Danke”, sagte ich, und als ich gerade im Begriff war, den Priem entzweizubrechen, machte sein auf dem Sprung stehender Fotograf einen Schnappschuß von uns. Das Ganze war ein amüsantes Schauspiel. Ich bin überzeugt, es war Wasser auf seine politische Mühle.
Huey Long war der schnellste Denker, den ich je getroffen habe, und immer in Tätigkeit. Mir gegenüber erschien er stets sehr freundlich. Eine äußerst dynamische Persönlichkeit. Häufig, wenn er sprach und gestikulierte, fielen einzelne Haarlocken über seine Stirn. Dann strich er sanft darüber hin. Nichts konnte ihn aus der Ruhe bringen.
Oft denke ich darüber nach, was wohl im Hinblick auf die demokratisch verbürgte Gesetzgebung geschehen wäre, wenn er nicht in Lousiana durch linksstehende Elemente ermordet worden wäre, da die obwaltenden Umstände dem amerikanischen Publikum immer klarer werden. Fraglos wurde Huey Long für einige Vielwisser in der demokratischen Administration in Washington eine wirklich drohende und politische Gefahr. Er hätte für sie sehr unbequem werden können, wenn er nicht durch einen geplanten Mord beiseitegeschoben worden wäre.
Einige Einzelheiten über Hueys Ermordung wurden kürzlich in der Presse und auch sonstwie behandelt, aber andere damit zusammenhängende Fragen wurden nicht beachtet und bleiben im Dunkeln. In diesem Zusammenhang
94
tauchen zwischen dem Tode Huey Long und dem des kürzlich verstorbenen Präsidenten Kennedy dem Anschein nach sehr ähnliche Züge auf. Manche haben gleichfalls das Gefühl, daß auch im Warren-Report Einzelheiten kaum berührt worden sind. Mit Huey Long verlor der Senat eines seiner hervorragendsten Mitglieder. In Antoines berühmten „Roten Zimmer” in New Orleans hängt das Bild von Huey Long und Curtis Dall, wie sie freundschaftlich miteinander „Tabak kauen”.
95
Zehntes Kapitel
„Professor” Felix Frankfurter
Die Haushaltsrechnungen der Mutter Roosevelts in Hydepark, New York, waren durch seinen großen politischen Erfolg in den Novemberwahlen 1932 bestimmt nicht kleiner geworden. Am Wochenende, besonders sonntags, kamen eine Menge Leute. Man würde ihnen nicht gerecht werden, wenn man sagen wollte, daß es sich um verschiedene Typen handelte.
Auf jeden Fall boten diejenigen, die in der Mittagszeit um den großen Tisch herumsaßen, eine interessante Gesellschaft. Allerdings wollte es nie in meinen Kopf hineingehen, warum sie kamen, und ob sie in das immer größer werdende politische „Mosaik” - wenn überhaupt - hineinpaßten. Sie gehörten einer anderen Welt an. Meine Aufmerksamkeit galt in erster Linie den Bemühungen, die damals über Wallstreet hängende Depression zu beheben und die Verluste auszugleichen, die durch die geplante plötzliche Verkürzung an täglichem Geld in Wallstreet im Herbst 1929 entstanden waren und die von dem unwissenden Publikum als „Panik” bezeichnet worden war. Das war an und für sich eine gute Kennzeichnung, aber nicht ganz die richtige.
Wenn ich damals die Gelegenheit gehabt hätte, als politischer Anfänger ohne Hilfe die grundlegenden politischen Spielregeln zu erlernen, wäre ich fraglos zusammen mit einigen anderen Neulingen in ungefähr sechs Monaten so etwas wie ein politischer „Experte” geworden. Jedoch war die Zeit zu kurz, um einen Amateur wie mich auszubilden. Ich war daher zufrieden, aus meiner politischen Nische
96
heraus in jeder nur möglichen Weise FDRs politisches Programm fördern und ihm behilflich sein zu können. Natürlich mußte ich bei jeder Zusammenkunft erraten, wer von den Gästen „wichtig” war, wer „relativ unwichtig” war und wer „ganz unwichtig” war.
Es war ein großer Sprung von der Wallstreet-Atmosphäre bis zu der, die über der neu angetretenen Regierung schwebte. Letztere war beladen mit neuen unversuchten Theorien. Eine neue Pastete - keine alten Krusten! Überall im ganzen Lande machten viele Banken bankrott, und dabei war nichts Theoretisches. Wallstreet war nervös und bis zum äußersten gespannt.
Eines Sonntagnachmittags im Dezember 1932 hatten sich wie gewöhnlich eine ganze Menge interessanter Leute um den Mittagstisch in Hydepark versammelt. Unter ihnen befand sich auch Professor Felix Frankfurter, der von der Harvard Universität zu einer Konferenz mit FDR gekommen war. Meiner Erinnerung nach saß er an der rechten Seite von Mama. Daraus erkannte ich, daß er „wichtig” war. Gewöhnlich saßen die beiden wichtigsten Persönlichkeiten ihr zur Seite. Bei dem zukünftigen Präsidenten und seiner Mutter saßen die darauf folgenden wichtigen Persönlichkeiten.
Danach hielt Roosevelt zahlreiche private Sitzungen in seinem Büro am anderen Ende der Halle ab, die oft fahrplangemäß den ganzen Nachmittag über dauerten. Als ich an diesem Sonntag um vier Uhr dreißig Hydepark verlassen wollte, um nach New York City zu fahren, sagte Mama zu mir: „Curt, Professor Frankfurter fährt auch nach New York zurück, bitte paß im Zug gut auf ihn auf.” Ich erwiderte, daß es mir ein Vergnügen sein würde, worauf wir beide uns verabschiedeten, um nach Poughkeepsie zu gehen und von dort mit dem Zug nach New York zu fahren.
Bis dahin hatte ich gerade vier Worte mit dem „Professor”
97
gewechselt und zwar, als ich ihm vorgestellt wurde. Jedoch etwas gab mir dabei zu denken, und ich kam immer wieder in Gedanken darauf zurück: Aus welchem Grunde unternahm ein Universitätsprofessor von Harvard eine so weite Reise von Cambridge, Massachusetts nach Hydepark, nur um FDR zu dieser Zeit zu besuchen. Handelte es sich dabei um ein neues Bildungsprogramm in Harvard? War es ein rein gesellschaftlicher Besuch oder wollte Frankfurter etwas für sich haben? Viele Besucher kamen aus rein persönlichen Gründen. Was wollte er also?
In Poughkeepsie stiegen wir in den Zug. Der Professor setzte sich an den rechten Fensterplatz und betrachtete ganz lange den Hudson, als wir nach New York fuhren. An jenem Nachmittag sah der Hudson kalt und unfreundlich aus, und die ganze Landschaft war genau so winterlich und kalt.
Ich schaute erst eine Zeitlang in die Zeitung, um die letzten Nachrichten zu erfahren. Frankfurter schien in Gedanken verloren zu sein und sah immer aus dem Fenster. Augenscheinlich war er nicht im geringsten an meiner Person interessiert. In Wirklichkeit war ich auch nicht an ihm interessiert. So fuhren wir weiter nach New York. Als wir kurz vor Harmon waren, wurde mir plötzlich bewußt, daß mein Zeitungslesen nicht dazu beitrug, FDRs Programm zu fördern. Ebenfalls erinnerte ich mich an Mamas Bitte, auf den Professor im Zug „gut” aufzupassen. Gewiß hatte ich gehört, daß er ein ganz großes juristisches Wissen haben sollte, daß er auch mächtig unterstützt wurde, aber damals wußte ich nichts über seine ideologischen Ansichten oder über seine politischen Ziele.
Als ich so über diese Situation grübelte und mich fragte, was ich tun sollte, schoß mir plötzlich ein Gedanke durch den Kopf. Ein alter Schulfreund, James Landis, war 1916 in einer Klasse mit mir in Mercersburg. Sein Spitzname war „Chink”. Er hatte nur Einsen. Obgleich „Chink” im
98
Herbst des Jahres 1920 mit meiner Klasse in Princeton anfing, verließ er uns aus irgendeinem Grunde schon nach einem Jahr, kam dann aber wieder. Er wurde mit der Klasse von 1921 promoviert. Ich wußte, daß er später in der Harvard Law School sehr aktiv war. Tatsächlich wurde er bald zum Dekan ernannt. Fraglos eine hervorragende Stellung.
So nahm ich mir nun vor, das Gespräch mit dem Professor über „Chink” Landis zu eröffnen in der Hoffnung, durch eine leichte Unterhaltung die ziemlich langweilige Eisenbahnfahrt zu beleben. Ich wußte damals noch nicht, daß Frankfurter und Landis 1928 zusammen viel über das Thema „The Business of the Supreme Court” geschrieben hatten und daß dadurch „Chink” sozusagen zum Kollegen des Professors wurde.
Ebensowenig wußte ich, daß der Professor zur rechten Zeit folgendes gesagt hatte: „Die wirklich Regierenden in Washington sind unsichtbar und üben ihre Macht hinter den Kulissen aus.” Diese erschreckende Bemerkung erinnert einen an eine frei wiedergegebene Bemerkung von Benjamin Disraeli in seinem Roman „Coningsby” (1844). Hier heißt es: „Du siehst, mein lieber Coningsby, die Welt wird von ganz anderen Personen regiert, als die Leute glauben, die nicht hinter den Kulissen stehen.”
Weiterhin hatte ich nicht gelesen, daß „Felix” seinen ersten großen Ausflug in das Feld umstürzlerischer Tätigkeit bereits 1917 unternommen hatte in seiner Eigenschaft als Sekretär und Rechtsbeistand in Präsident Wilsons Vermittlungskommission. Er war es, der sich für die Freilassung von Tom Mooney eingesetzt hatte, der zusammen mit W. K. Billings überführt und zu einer Gefängnisstrafe in San Quentin, Californien, verurteilt wurde, weil er in die San Francisco Preparedness Day Parade am 22. Juli 1916 Bomben geworfen hatte, wobei zehn Menschen getötet und fünfzig verletzt wurden. Hinzu kommt noch,
99
daß ich mich auch nicht erinnerte, gelesen zu haben, daß Frankfurters Eitelkeit ihn veranlaßt hatte, mit dem früheren Präsidenten Theodore Roosevelt einen polemischen Briefwechsel zu führen. Roosevelts Brief wurde zusammen mit der Antwort von Frankfurter von Senator Walsh von Massachusetts in dem Congressional Record vom 12. Mai 1930 veröffentlicht, gerade zweieinhalb Jahre vor dieser Eisenbahnfahrt. Theodore Roosevelts Brief an Frankfurter vom 19. Dezember 1917 enthielt folgende Feststellung: „Sie haben … eine Haltung gezeigt, die, wie mir scheint, im wesentlichen die Trotzkis und der ändern bolschewistischen Führer in Rußland ist; diese Haltung könnte für unser Land unheilschwanger sein.”
Rückblickend sind diese Bemerkungen zum mindesten aufschlußreich. Sei es, wie es will, als ich nun anfing, mit Frankfurter das Thema Landis in aller Unschuld zu besprechen, bin ich wirklich ins „Fettnäpfchen” hineingetreten, aber richtig mit beiden Füßen. Das fing so an: „Ich glaube, Professor Frankfurter, wir haben an der Harvard Law School einen gemeinsamen Freund.”
Mit Mühe raffte er sich aus seinen tiefen Gedanken auf und sagte: „Wer ist das, Herr Dall?”
„ ,Chink’ Landis”, sagte ich.
„O”, sagte er, „kennen Sie James?” Offenbar war ich doch im Augenblick in seiner Achtung gestiegen, denn er wurde gleich lebhafter und interessierter.
„Ja”, erwiderte ich, „ich kenne ihn, wir sind von unserer Schulzeit her Freunde. Ebenfalls waren wir Füchse in Princeton.”
„So”, sagte er, „seit der Schulzeit. Das ist allerdings interessant.” „ ,Chink'”, fügte ich hinzu, „hatte immer die besten Noten in der Schule und auf der Universität und doch möchte ich ihn nicht als Streber bezeichnen, er hatte große Fähigkeiten.”
Frankfurter sah mich jetzt ganz scharf an. „Wie denken
100
Sie heute von James?” fragte er. Ich fand an dieser Frage nichts Ungewöhnliches. Natürlich dachte ich mir auch nichts dabei, um etwa besonders vorsichtig sein zu müssen. Trotzdem, diese Frage hatte es in sich und war absichtlich. „Ach”, sagte ich, „Herr Professor, ich habe ,Chink’ seit Jahren nicht mehr gesehen, da ich aber weiß, wie tüchtig er ist, möchte ich wohl sagen, daß er in allem, was er unternimmt, Erfolg haben wird. Meiner Meinung nach sind indessen einige seiner Anschauungen, d. h. seiner politischen Anschauungen, etwas zu weit links; ich höre ab und zu von ihm durch meinen Schwager Jimmy, und …” Hier hörte ich auf, und zwar ziemlich erstaunt.
Das Gesicht des Professors wurde von Zorn und Überraschung durch meine beiläufige Bemerkung knallrot. Er machte auch keinen Versuch, seinen Zorn zu verbergen, sondern glotzte mich an. Unsere Unterhaltung war natürlich abrupt beendet. Stille herrschte.
Über diese unerwartete Veränderung der Dinge war ich natürlich sehr bestürzt und dachte nach, welche meiner Worte eine so ungünstige und heftige Reaktion in dem Kopf der so wohlbekannten Harvard-„Gesetzes-Leuchte” hervorgerufen haben könnte. Als diese Stille immer ungemütlicher wurde, wurde ich nun auch meinerseits wild, denn sein so zur Schau gestelltes Temperament erschien mir reichlich ungebührlich.
Erst nach einem Jahr, während dessen ich dem „politischen Circus” Frankfurters den Rücken gekehrt hatte, fing es bei mir an zu dämmern, warum es sich für den Harvard-Professor lohnte, seine Zeit zu opfern, um im Jahre 1932 an zwei Wochenenden Pilgerfahrten von Cambridge nach Hydepark zu unternehmen.
Um noch einmal auf diese unglückliche Eisenbahnfahrt zu kommen: Als wir an der Grand-Central-Station ankamen und auf dem Bahnsteig standen, sagte ich so freundlich wie möglich: „Gute Nacht, Herr Professor Frankfurter!” Kalt
101
erwiderte er: „Gute Nacht, Herr Dall!” Und wir fuhren in verschiedenen Richtungen.
Eines wurde mir dabei vollkommen klar, wäre ich Student in seinem Kurs gewesen, so hätte ich nie mein Examen bestanden.
Meine Aufgabe, im Zug „auf ihn aufzupassen”, hatte sich also wirklich als erfolglos erwiesen. Indessen hatte ich das sichere Gefühl, daß seine Bemühungen, „nach mir zu schauen”, entschieden erfolgreicher ausgefallen wären. „Der Professor”, später Richter Frankfurter, entfaltete sich sehr bald, um der zweitmächtigste politische Mann im Lande zu werden. Meiner Meinung nach hielt Bernard Baruch den ersten Platz inne, obgleich man darüber verschiedener Meinung sein könnte. Baruch finanzierte als erster Mann die Propaganda und die Unkosten, während Frankfurter direkt oder auch unter der Hand die wichtigsten Regierungsämter vergab. Was Geld und Macht angeht, so waren sie zweifellos aus demselben Holz geschnitzte Zwillinge. Ich kann wohl verstehen, daß seine Äußerungen und Aktionen bei Roosevelt häufig geistige Verdauungsstörungen hervorriefen.
Einer meiner Nachbarn, ein Freund von mir, der in Har-vard bei Professor Frankfurter Jura studiert hatte, ging eines Sommers mit einigen Studienfreunden nach Abschluß ihres Studiums in Cambridge ins Ausland, wobei ihnen Frankfurter mit einer freundlichen Gebärde einen Einführungsbrief an seinen guten Freund Harold Laski in London mitgab. Wie ich später hörte, empfing Laski diese jungen amerikanischen Juristen sehr freundlich und unterhielt sich mit ihnen sehr freimütig über viele Probleme. Wie gutgläubige junge Leute es häufig tun, so stellten auch sie an Laski einige recht plumpe Fragen, die er anscheinend ohne Zögern beantwortete.
Unter anderem fragten sie ihn: „Sind Sie Kommunist, Herr Laski?”
102
„Wieso, ja, ich bin Kommunist.”
„Wie lange schon, Herr Laski?”
„Ach, schon eine ziemliche Zeit.”
„Ist Ihr Freund in Cambridge, Professor Felix Frankfurter, auch Kommunist, Herr Laski ?”
Eine längere Pause folgte: „Sie fragen, ob Felix Kommunist ist?”
„Ja, wir fragen Sie danach.”
Laski: „Nun, ich möchte nicht gerade sagen, daß Felix Kommunist ist, aber wir sind sehr gute Freunde. Wir unterhalten uns miteinander mindestens einmal jede Woche über das Transatlantik-Telefon.”
Natürlich hat diese Unterhaltung die jungen amerikanischen Touristen sehr beeindruckt und sie zu erstem Nachdenken angeregt. 1933 bot FDR Professor Frankfurter das Amt eines Oberstaatsanwalts der Vereinigten Staaten für das New Deal an, was er prompt ablehnte. Der Professor trug sich mit bedeutend wichtigeren Dingen in seinen Gedanken und hatte nicht die Absicht, eine Stellung zu übernehmen, die seiner Aktivität Beschränkungen auferlegen würde. So hatte ich in späteren Tagen den Eindruck, daß das, was mir an jenem denkwürdigen Sonntagnachmittag passierte, keine Eisenbahnfahrt war, sondern eher „eine Schlittenfahrt”.
Professor Frankfurter schritt vorwärts! Ebenso seine immer größer werdende Gruppe, die er sorgfältig auswählte und dann in Washington unterbrachte. Diese Gruppe um Roosevelt entwickelte sich zu einem sehr machtvollen politischen Netzwerk, das sich über mehrere Gebiete ausbreitete. Ihre Nachfolger machen es heute genau so.
103
Elftes Kapitel
Herrn Baruchs Besuch
Schon lange vor dem Ersten Weltkrieg war Bernard Baruch in Wallstreet eine wichtige Persönlichkeit. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde er ein Titan! Bis 1914 hatten sich in Bernard Baruch zwei ungewöhnliche Eigenschaften entwickelt: Erstens diejenige eines fähigen Finanziers, eines Mannes mit einem wachen und weitschauenden Blick. Zweitens gehörte er zu denen, die das Vertrauen bedeutender Weltpolitiker und Weltfinanzmächte gewonnen hatten. Diese Kombination von Talenten war ein „Blickfang” für die Weltfinanzmächte und jene Männer der Hohen Politik, die die Weltpolitik machen, sie liehen ihm ihr Ohr. Jene Männer also, die tatsächlich schon im voraus die Kandidaten für den Präsidenten- und Vizepräsidentenposten sowohl für die Republikaner wie auch für die Demokraten vorbereiten und wählen.
Wenn vielleicht mancher Leser über meine Äußerungen entsetzt sein sollte, so habe ich volles Verständnis für ihn, denn mir ging es genau so, als ich zum ersten Male diese Situation erfaßte. Dann erst begann ich, mich mit diesen Fragen ernsthaft zu beschäftigen, denn sie werden weder auf den höheren Schulen noch auf den Universitäten behandelt. Nur durch intensives Forschen gewinnt man die Erkenntnisse und indem man die einzelnen Stücke wie ein Mosaik zusammenlegt.
Vor dem Ersten Weltkrieg soll „Barney” Baruch über eine Million Dollar wert gewesen sein. Nach Schluß des Ersten Weltkrieges sagte man, er sei an die zweihundert Millionen Dollar wert, angemessen für einen Titanen!
104
Er wurde häufig als der richtige „Laufbursche” zwischen den Persönlichkeiten der Weltfinanz und denen der Weltpolitik beschrieben. Mich dünkt diese Beschreibung sehr passend. Er hatte wirklich gute „Beine”, da er als junger Mensch ein ausgezeichneter Boxer gewesen war, und gute Beine sind für einen Boxer das Wesentlichste. Während des Ersten Weltkrieges war Bernard Baruch meistens in Washington, wo er der Wilson-Regierung wichtige Dienste leistete. Als bestellter Vorsitzender des Ausschusses für die Kriegsindustrie war er über alle wichtigen Kaufaufträge für Munition und Kriegsmaterial aus Frankreich, England und anderen Ländern unterrichtet. Als es dem Oberrichter Brandeis und Wilson 1917 endlich gelang, unser Land in den Krieg hineinzumanövrieren, erweiterten sich seine finanziellen Möglichkeiten in starkem Maße. „Kriegsaufträge” machen kleine Gesellschaften groß und größere Gesellschaften noch größer! Kein Zweifel, daß Baruch von seiner außergewöhnlich günstigen Stellung aus leicht auf ein breites, ergiebiges, wirtschaftliches und leicht auszubeutendes „Tal” hinunterschauen konnte. Es wurde ebenfalls rechtzeitig ausgebeutet.
Um 1939 herum gab er langsam die Rolle eines Finanzpolitikers auf und legte sich unauffällig die Robe „eines älteren Staatsmannes” als Ratgeber des Präsidenten um. Er genoß es, diese machtvolle Robe zu tragen und trug sie viele Jahre mit großer Würde. Wallstreet aber betrachtete ihn nicht mehr als Titanen. Dort war er bereits zu einer legendären Figur geworden.
Als ich eines Morgens in der 49 East 65sten Straße von Mama hörte, daß Baruch am Spätnachmittag Franklin einen zwanglosen Besuch abstatten wollte, nahm ich mir sofort vor, anwesend zu sein, um hierbei ein paar Worte mit dem berühmten Gast wechseln zu können; es war Anfang Januar 1933.
Persönlich hatte ich mich immer im Hintergrund gehalten,
105
um die Bedeutung Roosevelts zu betonen. Hatte ich doch das Empfinden, daß sich das für mich als seinen Schwiegersohn in Wallstreet gehörte. Der Gedanke einer kurzen Unterredung mit Bernard Baruch schien mir ganz richtig zu sein. Für einen Jüngling wie mich in Wallstreet war es fast furchterregend.
Den Partnern in der Firma sagte ich nichts davon, nur, daß ich beabsichtige, am Nachmittag etwas früher zu gehen, da ich eine Verabredung hätte, was ja auch tatsächlich stimmte.
Nachdem ich mich zu Hause umgezogen hatte, fand ich mich wie zufällig um halbsechs in der getäfelten Bibliothek auf der zweiten Etage wieder. Ich tat, als ob ich lesen wollte. In Wirklichkeit aber horchte ich auf die Klingel an der Haustür. Bald klingelte es, und der Diener Reynolds meldete „Herrn Baruch”. Bei seinem Eintritt begrüßte ich ihn, stellte mich vor und bat ihn in dem größten Sessel Platz zu nehmen, was er tat.
Nun war er da, in einem dunkelblauen Anzug mit der entsprechenden Krawatte, dem grauen Haar, dem gefurchten Gesicht, dabei argwöhnisch um sich blickend. Fraglos war er ein gut aussehender Mann. Als ich ihn so betrachtete mit seinem langen rechten Arm, schoß es mir so durch den Kopf, daß er als Boxer verheerend gewirkt haben mußte. Wir blickten einander aufmerksam an, dann sagte er: „Wie ich höre, Herr Dall, arbeiten Sie in Wallstreet?” Ich erwiderte: „Sehr richtig, Herr Baruch. In den vergangenen Jahren ist es dort sehr stürmisch zugegangen.”
„Das hörte ich”, sagte er, „aber es sieht schon besser aus und ich glaube, daß es bald wieder behoben sein wird.”
„Es freut mich, das von Ihnen zu hören, Herr Baruch. Es gibt mir neuen Mut.”
Dann fragte er: „Was machen Sie in Wallstreet, Herr Dall?”
„Zur Zeit bin ich meistens im Börsensaal für Goodbody
106
& Company. Nach Schluß der Börse arbeite ich im Büro. Ich weiß, daß Sie mit meinen Freunden in der Firma Lehman Brothers, für die ich ebenfalls gearbeitet habe, gut bekannt sind!”
„Das stimmt, Herr Dall”, sagte er, „ich kenne die meisten Gesellschafter von Lehman Brothers. Ein feiner Konzern.” Ich hatte das Gefühl, daß das Eis zwischen uns soweit gebrochen war, daß ich ein ernsteres Wort sprechen konnte, um von dieser legendären Gestalt jenseits von Wallstreet Ball Park einen Hinweis oder Rat zu meinem Nutzen zu bekommen. Kurz entschlossen schoß ich los: „Was halten Sie eigentlich von einem Kauf der Aktien der National Dairy Company, Herr Baruch?” (Mein Guter Freund Harold Lehman war damals im Vorstand.)
Er schaute mich scharf an und sagte dann mit einem vergnügten väterlichen Lächeln: „Eine gute Firma, auch sehr gut geleitet, die mit der Zeit Erfolg haben müßte.” Ich war mir klar, daß ich vorbeigeschossen hatte und startete daher einen neuen Versuch. „Was halten Sie denn von einem Aktienkauf von DUPont, Herr Baruch?” Wieder dasselbe väterliche Lächeln und dieselbe nichtssagende Antwort: „Eine sehr gute Gesellschaft, sehr verschiedenartig gelagert. Eine ausgezeichnete Organisation, müßte als Anlagekapital weiterhin sehr gut sein.”
Seine beiden so schön zurechtgeschneiderten Antworten machten mich ganz klein. Mit dem Empfinden, daß ich ebenso gut mit einem erfahrenen Marktberichterstatter für „Wer ist diese Firma”, passend für die Leute jenseits des Hudson, hätte sprechen können, lehnte ich mich in meinen Stuhl zurück.
So beschränkte ich mich auf die Angelegenheiten in Wall-Street und erinnere mich jetzt, daß er mich aufmerksam anzuschauen schien, allerdings nicht mehr mit so einem ausgeprägten Lächeln. Nach einer Pause sagte er ruhig: „Herr Dall, ich habe Vertrauen zu Silber.”
107
Im Augenblick war ich baff! Vollständig verblüfft, konnte ich nur sagen: „Wirklich, Herr Baruch?”
„Ja”, sagte er, “tatsächlich. Ich besitze 5/16 der gesamten sichtbaren Silbervorräte in der Welt.” Ich raffte mich auf, sozusagen um Luft zu schnappen, und brachte nur noch fertig, zu sagen: „Das ist wirklich eine ganze Menge Silber, Herr Baruch.”
In seiner stark ausgeprägten Tonart sagte er: „Ja, das ist wirklich eine ganze Menge Silber, Herr Dall.”
Bevor ich nun meine ganz konfus gewordenen Gedanken „über Silber” wieder sammeln konnte, kam Reynolds ins Zimmer mit der Meldung: „Herr Baruch, der Chef erwartet Sie oben. Er macht schon einen Drink zurecht.” Wir standen beide auf und verabschiedeten uns herzlich mit einem Händedruck. Während Reynolds die Tür aufhielt, stieg Baruch in den Fahrstuhl, um nach oben zu Roosevelt zu fahren, wo sicherlich bereits ein ausgezeichneter Martini in dem gut bekannten, kleinen Schüttler für den vornehmen Gast zurechtgemacht wurde.
Als Baruch fortgegangen war, setzte ich mich prompt wieder hin, um über diese schnelle und unerwartete Wendung nachzudenken. Silber! Was zum Teufel meinte er damit? Was wußte ich überhaupt von „Silber”? Im Grunde genommen überhaupt nichts außer, daß es mit zehn Prozent Marge gekauft werden konnte. Na, sann ich stillschweigend, so sehr habe ich mich ja nicht blamiert. Ich hätte noch mehr wissen können, wenn ich die Finanzberichte in einem der Nachmittagsblätter gelesen hätte.
Wie wenig ich in Wirklichkeit von unserm Gespräch verstanden hatte, zeigte sich darin, daß ich am nächsten Tag alles vergessen hatte. Einige Monate später brachte die Presse jedoch vollkommen überraschend Berichte über Silber, aber in einer ziemlich nebensächlichen Art und Weise, und zwar am Wochenende, als die Finanzbörse schon geschlossen war. Um sozusagen den westlichen Staaten mit
108
ihren Silberbergwerken eine freundliche politische Geste zu erweisen, ermächtigte der Kongreß das US-Schatzamt, den Preis für Silber, den es am freien Markt zu zahlen hätte, zu verdoppeln. Unsere Presse begrüßte diesen Antrag aufs wärmste. Für andere Länder aber, wie z. B. China, war für die Geschäftsleute und Bauern diese Erhöhung ein harter Schlag, denn sie bekamen dadurch in Wirklichkeit für ihre Produkte nur die Hälfte. Diese plötzliche Preissteigerung bedeutete dort und auch in ändern Ländern eine große Härte.
Wenn ich an meine Unterredung mit Baruch zurückdenke, so weiß ich jetzt, daß es der beste „Tip” war, den ich je bekommen habe und auch bekommen werde.
Als Jahre später in der Presse stand, daß Sir Winston Churchill in den Staaten sei, und daß er zunächst Baruch in New York besucht hätte, bevor er in Staatsangelegenheiten das Weiße Haus aufsuchte, war ich garnicht überrascht. Die wichtigsten Sachen kommen immer zuerst. Ebenfalls war ich nicht im mindesten überrascht, daß Baruch mit der Zeit das bestbekannte Symbol der Weltfinanzmächte wurde. Selbst wenn er auf einer Bank in einem öffentlichen Park saß und Tauben fütterte und dabei Ratschläge erteilte, waren seine Bemerkungen dazu angetan, die Politik der Regierung bereits lange im voraus zu bestimmen. Seine Worte spiegelten eine große Finanzmacht wider, eine sowohl sichtbare wie unsichtbare. Sie bedeuteten eine Macht von einer derartigen Größe und einem Umfang, dem man selten begegnet und wie sie sich auch wohl kein Amerikaner erträumt hat.
109
Zwölftes Kapitel
Der Tag der Amtseinsetzung Roosevelts
Der 4. März 1933 wurde pünktlich eingeleitet, kalt und klar. Jener von allen möglichen Ereignissen angefüllte Tag begann mit einem Kirchgang zu der in der Nähe gelegenen St. Johns Episcopal Kirche. Um halbelf Uhr hatten wir uns am Haupteingang des Weißen Hauses versammelt. Die ganze Sache schien mir etwas unwirklich, wie in einem Kino.
Nachdem abgezählt worden war und alle in den Wagen Platz gefunden hatten, fuhr die Kavalkade langsam aus der Toreinfahrt hinaus. An der Spitze der gewählte Präsident, umgeben von der Geheimpolizei. Alle machten einen ganz feierlichen Eindruck und sahen dementsprechend aus. Die Atmosphäre war gespannt, wodurch die Bedeutung dieses Ereignisses noch deutlicher wurde. Es sollte sich an diesem Tage ja auch viel abspielen.
Ich saß im dritten Wagen links auf einem Klappsitz. Als wir, von Norden kommend und immer unter Begleitung, uns der Vorderseite der Kirche näherten, wurde plötzlich gehalten. Ich war ganz nahe am Bürgersteig, genau gegenüber der Feuerleiter am Südende des Lafayette-Hotels. Keiner im Wagen hatte bis dahin auch nur ein Wort gesagt.
Plötzlich rief jemand mit lauter Stimme: „He, Curtis, was machst du da so vornehm angezogen und das schon so früh?”
Ganz erschrocken schaute ich in die Richtung, aus der diese klangvolle Stimme kam. Ein merkwürdiger Anblick bot sich mir, der schnell die herrschende Spannung löste. Auf
110
der Feuerleiter des Hotels, in Höhe des dritten Stocks, stand ein Mann im Abendanzug, Zylinder und Stock, hoch elegant. Es war Freddy Peabody. Noch zwölf Stunden vorher war ich mit ihm und seiner Frau auf einer der vielen Gesellschaften in Washington gewesen, die zu Ehren der Einweihung des kommenden Präsidenten gegeben wurden. Offenbar war Freddy der Meinung, daß für ihn die Nacht zu kurz gewesen sei, und er hatte daher die Feier auf seine Weise weiter ausgedehnt. Ich lächelte, winkte ihm zu und sagte nicht zu laut: „He, Freddy!” Worauf er seinen Zylinder abnahm, sich verbeugte und dann voller Begeisterung, mit Hut und Stock über seinem Kopf, mir zuwinkte. Für den Augenblick fürchtete ich, er würde die Balance verlieren und herunterfallen; das geschah glücklicherweise nicht, aber das ganze Schauspiel paßte so ganz und gar nicht zu unserer Stimmung im Wagen, sodaß wir alle in ein erlösendes Lachen ausbrachen.
Obwohl Freddy sonst immer das Aussehen und die Haltung eines distinguierten Staatsanwaltes hatte, war es doch in diesem Augenblick ganz das Gegenteil.
Bald fuhren wir weiter südlich die 16te Straße entlang und betraten still die Kirche. Nach dem Gottesdienst begaben sich die meisten von uns zum Capitol, wohin auch die riesige, froh gestimmte Menge Volkes zog, die aus dem ganzen Lande nach Washington gekommen war, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen, die den Beginn der neuen Regierung einweihen sollten. Der neue Präsident fuhr indessen erst später zum Capitol, da er noch die letzten Vorschläge entgegennahm im Hinblick auf seine Antrittsrede. Hatte sich doch die Lage bei den Banken weiter verschlechtert.
Indessen schien es mir so, als zöge sich alles in die Länge. Ungeduldig erwartete ich den Augenblick, in dem er nun wirklich Präsident werden würde. Ich war stolz auf seine große Leistung. Präsident Hoover sah ich nur einen kur-
111
zen Augenblick. Er machte einen sehr müden und abgespannten Eindruck, als ob er froh darüber wäre, wenn die Formalitäten endlich beendet sein würden und er sich zurückziehen könnte. „Der König ist tot, es lebe der König!” Diese altbekannten Worte kamen mir deutlich zum Bewußtsein.
Endlich waren die Zeremonien beendet. Bei der Rückkehr - ins Weiße Haus zeigte sich ein fürchterliches Durcheinander. Doch dank der Fähigkeiten der Gattin des Präsidenten und mit Unterstützung ihres Personals wurde bald Ordnung geschaffen, so daß Vorbereitungen für die riesige Teegesellschaft im Weißen Haus getroffen werden konnten, die für Nachmittag um vier Uhr vorgesehen war. Selbst in normalen Zeiten war das immer eine ganz große Sache. In der Zwischenzeit holten sich einige von uns stillschweigend belegte Brote und Kaffee aus der Kaffeeküche anstelle eines Mittagessens.
Beim Eingang links oben im Weißen Haus lag das Gelbe Zimmer, in dem ich einquartiert war. Ein großes Eckzimmer mit schöner Aussicht. Entschieden eindrucksvoll.
Um die bereits erwähnte Zeit erschien ein Freund von mir an der Tür des Weißen Hauses mit einer Kiste feinen Scotch-Whiskys als „Geschenk” für mich. Da die Prohibition immer noch herumspukte, war dieses wirklich ein Geschenk. Ich ging hinunter, bedankte mich bei ihm und schlug vor, er und seine Freunde sollten um halbvier Uhr kurz hereinkommen, um ihn zu probieren. Er sagte zu und ging. Unter sorgfältiger Überwachung wurde das Geschenk dann vorsichtig in mein Zimmer gebracht.
Als ich aus dem Vorderfenster schaute, sah ich Formationen von Soldaten die Pennsylvania-Avenue entlang marschieren. Ich entschloß mich daher, hinunterzugehen, um mir dieses große Schauspiel anzusehen. Von allen Seiten kamen die Truppen, um an der Parade teilzunehmen. Begleitet von Sisty, einer ziemlich ängstlichen jungen
112
Dame von etwa fünf Jahren, ging ich hinunter. „Buz” konnte seinen Mantel nicht finden. Es war viel kälter geworden und der Märzwind zeigte sich mit seinen unangenehmen Begleiterscheinungen.
Seit dem frühen Morgen hatte sich so viel ereignet, daß man kaum mit allem Schritt halten konnte. Bald kam ich an die Tribüne, die für die vielen schaulustigen Menschen aufgestellt war. Im Parademarsch zogen die Soldaten vorbei. Es war ein Anblick, der mich hell begeisterte, zumal da die Militärkapellen großartig spielten.
Um warm zu werden, gingen wir weiter bis zu der Mitte der Tribüne. Plötzlich schoß mir ein Gedanke durch den Kopf: Wer vertrat denn eigentlich den Präsidenten oder das Weiße Haus, um die Parade abzunehmen? Ich hatte nichts weiter darüber gehört, aber nahm an, daß Jimmy oder Elliot ihren Vater vertreten würden. Das wäre ganz verständlich gewesen, denn an einem so kalten Tage würden die Beinschienen des Präsidenten kalt geblieben sein, so daß er, warm eingepackt, dort hätte sitzen müssen, was er im Hinblick auf den anstrengenden Tag wahrscheinlich nicht gewünscht hätte. Als wir uns nun dem Abschnitt näherten, der mit „amtlich” bezeichnet war, bekam ich einen Schreck; nur ein einziger Militär schien dort zu stehen, ein Soldat, in einen dicken Mantel gehüllt, der beim Vorbeimarsch jeder neuen Einheit aufstand und dankte. Es war General Douglas MacArthur.
Er war ganz allein. Seine Gesichtszüge erschienen mir sehr ernst. Auch niemand aus dem Weißen Haus war dabei. Man merkte augenscheinlich, daß dieser Mangel an Aufmerksamkeit den General beleidigt hatte. Irgend jemand war dann plötzlich erschienen, aber da war auch schon die Große Parade vorbei. General MacArthur war der einzige amerikanische General, bei dem die Russen es nicht wagten, ihn irgendwie einzuwickeln. Im Gegensatz zu dem, was so viele als „Nicht-Sieg”-Politik bezeichneten, vertrat
113
er für die Vereinigten Staaten eine Sieg-Politik. Um halb-vier Uhr kamen dann auch mehrere Freunde von mir ins Gelbe Zimmer im Weißen Haus. Ich hatte den ersten Pförtner gebeten, jeden, der mich sprechen wollte, zu mir ins Gelbe Zimmer zu bringen. So begann jenes Ereignis, das in die „Geschichte des Weißen Hauses” als die „Schlacht im Gelben Zimmer” hätte eingehen können.
Wie bereits erwähnt, blies ein sehr scharfer Märzwind. Außerdem hatten einige von den jungen Leuten, wie man in Texas sagte, den „Schlangenbiß” bekommen. Diese „armen Opfer” suchten nach einem geeigneten Hausmittel, um den „Schmerz” zu lindern und dieses besonders bei einer so günstigen Gelegenheit. So rief ich denn nach unten und bat um Sodawasser, Eis und Gläser, die ich sofort erhielt. Der Geber der Kiste war sofort zur Hand, erbot sich mutig, freiwillig die erste Probe vorzunehmen und zu trinken, um sicher zu gehen, daß alles in Ordnung war. Das tat er dann auch und alle Anwesenden merkten an seiner Miene, daß nichts fehlte. Der Inhalt der ersten aus der Kiste gegriffenen Flasche hielt für die acht bis zehn Leute nicht lange an. Bald kam auch eine andere Gruppe Freunde, die ihrerseits wieder Freunde mitbrachten und der Märzwind draußen pfiff so scharf.
Ich bat um mehr Eis, Gläser und Sodawasser. Inzwischen waren wir ungefähr fünfundzwanzig Mann, die alle probierten. Die Schüchternen wurden von mir extra aufgefordert und höflich gebeten, noch einmal zu probieren, um ganz sicher zu gehen, daß der Test auch ordentlich durchgeführt wurde.
Schon sehr bald waren es die Freunde meiner Freunde, die heraufgeschickt wurden; komischerweise mußte sich das unten herumgesprochen haben, daß es für alle, die ins Weiße Haus kamen, nur korrekt war, erst einmal nach mir zu fragen. Sei es, wie es sei, jedenfalls schwoll das Sickern der Freunde zu einem Strom an. Jeder schien sich über
114
diese besondere Gelegenheit im Gelben Zimmer zu freuen. Ich versuchte, die Zahl meiner Freunde zu zählen, gab es aber bei sechzig auf. Tabletts und Gläser kamen ständig nach oben, und die Kiste der Freunde schien bald die Schlacht zu verlieren. Um im Fußball-Jargon zu sprechen: In der letzten Viertelstunde verlor sie an Zeit. Doch immer neue Gesichter tauchten an der Tür mit erwartungsvollen Blicken auf. Freunde von Freunden meiner Freunde!
Ich sah nach meiner Uhr. Es war viertel nach vier Uhr. In diesem Augenblick erschien der Zeremonienmeister. Er war ein großer, gut aussehender Farbiger, der sehr stramm und mit viel Würde in seiner eindrucksvollen Livree auftrat. In seinen behandschuhten Händen trug er ein großes Silbertablett, auf dem ein kleiner weißer Umschlag lag. Er kam auf mich zu, hielt mir das Tablett hin und sagte sehr steif: „Herr Dall, ich habe eine Botschaft für Sie.” Ich dankte ihm und nahm den kleinen Brief, der die bekannten Schriftzüge meiner Schwiegermutter Eleanor Roosevelt trug, entgegen. Sie schrieb mir: „Lieber Curt, hör’ bitte auf, weiterhin so großzügig zu spendieren. Es ist mir unter diesen Umständen nicht möglich, den Weißen-Haus-Tee servieren zu lassen.” (Die Hervorhebungen sind von mir.) Nachdem es mir endlich gelungen war, die Aufmerksamkeit der Gäste im Gelben Zimmer zu finden, sagte ich: „Meine Damen und Herren, ich habe mich furchtbar gefreut, Sie alle hier bei mir zu sehen. Die Feier ist aber jetzt zu Ende und wir sind alle eingeladen, unten eine Tasse Tee zu trinken!”
So endete die „Schlacht im Gelben Zimmer” mit einem durchschlagenden Teesieg.
An diesem Tag der Einweihung geschahen viele Dinge.
115
Dreizehntes Kapitel
Ein Frühstück mit Henry
Kurz nach den Einweihungsfeierlichkeiten ging ich zum Wochenende nach Washington ins Weiße Haus. Daß ich von Wallstreet kam, war für mich in jener politischen Arena von vornherein ein Nachteil. Hinzu kam, daß ich noch bei Prof. Frankfurter im Liberalismus-Kursus durchgefallen war. Nach diesen beiden Schlägen konnte ich eigentlich nur noch einen Schlag bekommen.
Für das Wochenende hatte ich keine besondere Einladung erhalten. Ich war „unwichtig”, stand niemals mehr auf Louis’ Gästeliste. Da ich nun aber doch neugierig war, was dort los war, entschloß ich mich hinzugehen.
Das Weiße Haus ist ein sehr großer Amtssitz, von dem in Wirklichkeit nur wenige Leute wissen, was dort eigentlich los ist, vielleicht vier oder fünf, die sich noch zu Lebzeiten zurückzogen. Von den übrigen hat es den Anschein, als ob sie von den Passatwinden der Macht weitergetragen werden, die die Atmosphäre dort durchdringt. Gelegentlich erfolgt eine passende Empfehlung gegenüber dieser verwirrten, unwissenden Gestalt, kurz der Steuerzahler genannt. Gelegentlich wird auch ein Kongreß aus Zweckmäßigkeitsgründen zusammengerufen. Natürlich stellt er dann ein volkstümliches Gepräge zur Schau und erfüllt, von dem übermäßig entwickelten Exekutiv-Department aus gesehen, seinen Zweck.
Mein erster Fehler auf diesem Ausflug geschah prompt nach meiner Ankunft im Weißen Haus. Ich dachte, es wäre ganz nett, einige Freunde zu besuchen, die auf der anderen Seite des Potomacs in Virginia wohnten. So bat
116
ich denn einen Fahrer der vor dem Weißen Haus ständig haltenden Wagen, mich eben zu der Wohnung meines Freundes zu fahren. Als ich ungefähr nach einer Stunde zurückkam, wurde ich von der Gattin des Präsidenten getadelt, ich solle nicht das Geld der Steuerzahler vergeuden. Ich hätte ein Taxi nehmen sollen. Zweifellos war dieses ein wohlgemeinter Rat, den ich beachtete. Vielleicht hätten aber auch andere, wie z. B. Harry Hopkins, zur rechten Zeit darauf hingewiesen werden sollen.
Über die Verschwendung der Gelder der Steuerzahler seitens späterer Bewohner des Weißen Hauses habe ich häufig nachgedacht. Wie war es möglich, daß Harry Hopkins, den man dort hingesetzt hatte, um seine Zeit zu vergeuden, es fertiggebracht hat, so erfolgreich und in einer Art zu operieren, bei der der vertrauensvolle Steuerzahler ganz vergessen wurde. Natürlich war das kein Zufall. Mit Hilfe der „Ratgeber” des Weißen Hauses, dem Briefpapier und den langen Fernsprechleitungen des Weißen Hauses hat er es fertiggebracht, gegen Ende des Krieges von uns selbst dringend benötigtes Kriegsmaterial im Werte von weit über sechs Milliarden Dollar an Joe Stalin und seine bolschewistischen Genossen zu „verleihen”! Für dieses saubere Geschäft erhielten weder die Vereinigten Staaten noch Hopkins von den Sowjets je ein Wort des Dankes. War Harry nur Stalins Laufbursche? Aus Major Jordans aufschlußreichem Buch („Aus Major Jordans Tagebuch”) geht hervor, daß durch Vermittlung von Harry Hopkins äußerst seltenes Uran, schweres Wasser, große Mengen dünner Kupferdrähte und viele andere wichtige Artikel den Sowjets geschickt wurden. Weiterhin schickte Harry Hopkins, mit Hilfe von Henry Morgenthau jr. und seinem engsten Mitarbeiter Harry Dexter White, den Sowjets mehrere mit Druckplatten beladene Flugzeuge, Spezialpapier und Spezialtinte zur Herstellung von Geld in unserer eigenen Währung. Klingt das nicht unglaublich?
117
Der Versand der Geldplatten, die einen ungeheuren Wert darstellten, erfolgte nach Sowjetrußland per Luftfracht, und zwar von einer für diesen Zweck ganz groß geschaffenen Anlage in Great Falls, Montana. Man darf darüber nicht diskutieren, welche tatsächlichen Mengen von diesem „Militärgeld” bis jetzt gedruckt worden sind, denn es ist ein politisches Geheimnis, das nur den Leuten aus bestimmten Kreisen vorbehalten, dem amerikanischen Bürger aber vorenthalten ist! Man darf auch nicht danach fragen, wieviel Bürogebäude, Hotels und wertvolle Stücke großen Besitzes bei uns und auch in anderen Ländern von Unbekannten mit diesem „Militärgeld” erworben worden sind.
Wieviele ausgesuchte „schäbige” Flüchtlinge sind in die Staaten gekommen mit ganzen Bündeln von Währung, schön verpackt in abgenutzten, zerrissenen Koffern oder mit einem großen Kreditbrief in ihrer Brieftasche, womöglich von einer Schweizer Bank mit einer Kontonummer versehen. Wenn sie dann hier sind, fangen sie ein Geschäft an und es geht ihnen offensichtlich gut. Anscheinend hatte dieses unglaubliche „Hopkins-Morgenthau-White-Geldplattengeschäft” die Zustimmung der höchsten Beamten des Weißen Hauses gefunden.
Zur weiteren Darstellung gebe ich folgendes an: „6 Spook-money Haunts U. S. Treasury” (From American Mercury, Juni 1957: „Ein Geldgespenst geistert im Schatzamt herum”, Auszüge aus der neu gedruckten Economic Liberty, Oakland, Californien). „Henry Morgenthau jr., Sekretär des Schatzamtes, zusammen mit Harry Dexter White, Unterstaatssekretär, und Harold Glasser, alle in verantwortlicher Stellung im Schatzamt, übergaben der russischen Regierung fix und fertig Gelddruckplatten sowie Flugzeuge, beladen mit einer Spezialtinte und vier Flugzeugen mit Spezialpapier, um unser Geld in Ostdeutschland drucken lassen zu können und den russischen Solda-
118
ten für zwei Jahre den Sold auszahlen zu können. Millionen dieses Geldes sind von den Flüchtlingen nach den Staaten gebracht, um Geschäfte damit zu machen. Wie uns gesagt worden ist, wird diese Geldbewegung nach den Staaten auf neunzehn Milliarden Dollar geschätzt. Davon kommen, drei Milliarden aus Canada, eine Milliarde und achthundert Millionen von Schweizer Banken.”
Um nun auf meine Washington-Wochenendgeschichte zurückzukommen: Am Abend ging Roosevelt fort, um an einem wichtigen Essen und an einem Diskussionsabend teilzunehmen. Seine Frau und seine Tochter mußten ebenfalls einem großen politischen Essen für demokratische Damen beiwohnen. Vorher hatten Roosevelt und ich eine sehr nette zwanglose Unterredung miteinander. Er sagte mir: „Curt, dieses Washington-Programm fängt an, mich todmüde zu machen.”
Anscheinend hatte „Mama”, die Gattin des Präsidenten, es fertig gebracht, daß Henry Morgenthau jr. mich diesen Abend ganz allein ins Shoreham-Hotel zum Diner einlud. Ich wurde durch diese Einladung sehr überrascht und hielt sie für das, was ich dachte, für eine, freundliche Geste. Henry und ich vertrugen uns immer gut. Ich betrachtete ihn als meinen Freund.
Sein Vater, von uns allen immer freundschaftlich „Onkel Henry” genannt, sprach sehr selten - so schien es mir wenigstens die wenigen Male, die ich ihn traf - aber er hatte das Aussehen und Benehmen eines Mannes, der genau wußte, was er wollte, und auch das zu bekommen verstand, was er wollte. Seine Frau war eine ziemlich ruhige und entzückende Dame.
Offenbar hatte „Onkel Henry” sich seinen politischen Start erkauft und auch dafür bezahlt; das war zu einer Zeit, als Woodrow Wilson, ein Kandidat für die Präsidentschaft, durch einige machtvolle Berater im demokratischen Hauptquartier im lower New York und anderen
119
Quartieren im Sommer 1912 zurecht gemacht wurde. Man behauptet, „Onkel Henry” habe zehntausend Dollar für die Unterstützung der demokratischen Sache gegeben. Als Gegenleistung für diese Parteitreue belohnte ihn Präsident Wilson dementsprechend mit dem Botschafterposten in der Türkei.
Als Spekulant in Grundstücken in New York sowie in anderen spekulativen Wagnissen hatte „Onkel Henry” großen Erfolg. Einen tollen Erfolg hatte er dadurch, daß er den größeren Besitz des Levi P. Morton Estate in der Bronx bekam. Dank seiner politischen und finanziellen Tätigkeit kam er in engen Kontakt mit Franklin D. Roosevelt.
Aus verläßlicher Quelle hörte ich seinerzeit, daß er Roosevelt beraten und dahingehend ermutigt hätte, Aktienkäufe zu tätigen, die ihm von seiner Familie angeboten worden waren, zweifellos zu herabgesetzten Preisen. Mir wurde ebenfalls erzählt, daß eine von „Onkel Henry” ganz besonders angebotene Investierung vollkommen querging, wobei Roosevelt als unglücklicher Kapitalgeber viel Geld verloren hat.
Nun kommt der interessanteste Punkt im Hinblick auf das, was später geschah. Mir wurde erzählt, daß „Onkel Henry” Roosevelts Anteile vollständig übernahm, aber - und das war wirklich ein Aber - Roosevelt seinerseits zustimmte und versprach, für künftige politische Vorschläge von „Onkel Henry”, die er im Interesse und für das Weiterkommen seines Sohnes Henry auf den dornenreichen Lebenspfaden machen würde, zugänglich zu sein. So wurden die beiderseitigen Interessen von Roosevelt und „Onkel Henry” aus dem von „Onkel Henry” eingeleiteten schweren finanziellen Verlust „ausgeglichen”. Dieser Handel erfolgte im Jahre 1929. Etliche Jahre später wurde ein „Vorschlag” von „Onkel Henry” gemacht. Es war ein zwingender Vorschlag. Er weist ganz deutlich
120
darauf hin, warum für Henry jr. so schnell ein „Posten” in Washington gefunden wurde. Dieser Posten entpuppte sich als Minister des Schatzamtes.
Ein Freund von mir hörte 1929, wie „Onkel Henry” in einem Fahrstuhl in New York City bemerkte: „Es ist furchtbar mit Henry. Ich habe doch nun alles für ihn getan, was ich konnte, aber er versteht überhaupt nichts vom Geschäft.” Versteht sich, denn der Schatzamtsminister brauchte nichts vom Geschäft zu verstehen. Er hatte lediglich Anordnungen entgegenzunehmen.
Henry Morgenthau sen. war ein überzeugter Anti-Zionist. Oft stieß er in aggressiver Form mit verschiedenen mächtigen und reichen Pro-Zionisten, hier und im Ausland, zusammen. Man erzählte von ihm, daß er gesagt habe: „Zionismus ist der erstaunlichste Irrtum in der jüdischen Geschichte. Er ist im Prinzip falsch und kann nicht verwirklicht werden. Wirtschaftlich gesehen, ist er ungesund, außerdem grotesk in der Politik und steril in seinen geistigen Idealen” (What Price Israel, Alfred M. Lilienthal, S. 175).
Damals hatte ich keine Ahnung von dem ungeheuren Zwiespalt zwischen Pro- und Anti-Zionisten und von dem großen Einfluß, den die Welt-Zionistenbewegung auf die amerikanische Außenpolitik ausübte. Im Laufe der Zeit las ich über die Welt-Zionistenbewegung und ihren wichtigen, wenn auch verborgenen Einfluß auf das Leben und die Zukunft aller Amerikaner. Dieses Thema ist in der Tat außerordentlich lebenswichtig. Leider wird es gegenwärtig nur wenig von den meisten Amerikanern verstanden, zumal da es im politischen Raum absichtlich im Dunkeln gehalten wird.
Von „Henry jr.” sagte man, daß er nicht an seinen Vater heranreichen könne. Als ich ihn kennenlernte, schien er mir immer sehr empfindlich zu sein. Er schloß sich sozusagen an andere Leute an. Es hieß, er sei Farmer und züchte
121
Äpfel auf seiner Farm in Fishkill, New York, nicht weit von Hydepark. Roosevelt liebte es, harmlose kleine Witze mit Henry zu machen, natürlich auf Henrys Kosten. Natürlich lauerte der alte, realistische „kalte Rechner” Henry sen. bei wichtigen Dingen im Hintergrund.
An jenem besonderen Märzabend in Washington 1933 hatte ich das Empfinden, daß Henry jr. herumtappte, um in dem politischen Wirbel etwas für sich zu ergattern. Ich hatte eigentlich etwas Mitleid mit ihm, und mein Gefühl sagte mir, daß auf irgendeine Weise eine „Stelle” für Henry geschaffen werden müsse. Doch wie wenig wußte ich damals über das Wirken der Weltfinanz hinter den Kulissen von New York!
Nachdem ich mich zum Essen umgezogen hatte, nahm ich ein Taxi zum Shoreham-Hotel. Zu meiner Überraschung bewohnte Henry dort eine ganze Flucht von Zimmern, groß genug, um „Caesar zu übertrumpfen”. Ich wußte, daß viele Menschen große Schwierigkeiten haben, in den überfüllten Hotels ein oder zwei Zimmer zu bekommen. Wir speisten beide allein in seinem Eßzimmer. Das Essen war gut, die Gesellschaft langweilig. Ich fragte mich im stillen, warum ich überhaupt nach Washington in dieser Woche gekommen war. Nach dem Essen sprachen wir eine Zeitlang über dies und das. Wie ich mich noch erinnere, fragte Henry mich bei dieser Gelgenheit in einem etwas kläglichen Ton, ob ich ihm nicht einige Vorschläge für eventuelle Verbesserungen im Sinne der Regierung machen könnte, die für das Verwaltungsprogramm von Nutzen sein würden. Daß mir hier eine „Falle” gestellt werden sollte, wäre mir nicht im mindesten in den Sinn gekommen. „Du weißt, Henry”, sagte ich, „von Politik habe ich keine Ahnung. Und ich will auch nichts für mich persönlich. Ich kann dir nur Vorschläge auf dem finanziellen Sektor machen, wenn dir das irgendwie helfen kann.”
Er schien dadurch etwas ermuntert und sagte: „Was ist
122
das denn für einer?” „Mein Vorschlag”, erwiderte ich, „steht in Verbindung mit einer breiteren Verteilung und somit der wachsenden Ausbreitung des Waren-Kommissions-Geschäfts der Regierung, und zwar hauptsächlich in Baumwolle, um die Beteiligung von mehreren größeren Firmen zu ermöglichen. Wie ich gehört habe, hat eine Firma - ich glaube Harris und Vose - angeblich während der Hoover-Regierung den größten Teil des Baumwolle-Kommissionsgeschäftes der Regierung in Händen gehabt. Ich finde, man sollte das mehr verteilen und mindestens ein halbes Dutzend großer, finanziell guter Firmen einschalten.”
Henry wurde noch munterer und sagte: „Wen würdest du vorschlagen?” wobei er sich einen Block Papier und einen Bleistift von seinem Schreibtisch holte. Nach einigem Nachdenken erwiderte ich: „Thompson, McKinnon, E. A. Pierce, Hornblower und Weeks, Harris Upham, Bache & Co.” Ich erwähnte noch ein oder zwei andere Firmen, ließ aber absichtlich die Namen von Fenner, Beane und Ungerleider, bei denen ich Teilhaber war, fort. Zu meiner großen Überraschung schrieb Henry sich jeden Namen sorgfältig auf seinen Papierblock, riß die Seite ab, steckte sie in die Tasche und warf den Block auf den Schreibtisch. Bald darauf bedankte ich mich bei Henry für seine Gastfreundschaft und verließ um halbneun Uhr das Hotel, um zum Weißen Haus zu gehen. Ich hatte es so eingerichtet, daß ich in dieser Nacht in Lincolns Zimmer und in seinem Bett schlafen konnte. Ich kann nur sagen, welche Ehrfurcht ich empfand. Ein großartiges Ereignis für mich, in der Gegenwart (obwohl weit fort) dieses großen Amerikaners zu sein. Es war ein sehr langes Bett.
Einige Tage später unterhielten Anna und ich uns in New York City. Bald in Unterhaltung begriffen, sagte sie sinngemäß: „Curt, heute morgen saß ich nach dem Frühstück bei Pa (in Washington) auf seinem Bett, während er die
123
Zeitung las und seinen Kaffee zu Ende trank. Wir hatten viel Spaß bei der Unterhaltung auch über Besuche. Mein Gott, was war ich erschrocken, als ich hörte, was du gesagt hast!” Ich war bei ihrer Bemerkung nicht weniger erschrocken und sagte: „Was habe ich denn gesagt?” „Nun, Henry (Morgenthau jr.) besuchte Pa nach dem Frühstück. Er fing an, über dich zu sprechen und zog dann ein Stück Papier aus der Tasche und sagte: ,Franklin, wir müssen vorsichtiger mit Curt sein - viel, viel vorsichtiger! Eines Abends haben wir beide zusammen in meinem Hotel gegessen, wobei er mir diese Liste von Investierungs-Banken und Fondsmaklern gab, von denen er wünschte, daß ihnen das Regierungswarengeschäft übertragen würde. Ich dachte mir, du solltest so etwas wissen!’ Dann zerriß Henry das Papier und warf die Stücke in einen leeren Papierkorb.” Daß er das Wort „wir” gebrauchte, war wirklich überraschend. Ich war tatsächlich platt.
Natürlich hatte Anna nur das gehört, was Henry an jenem Morgen behauptet hatte; über unsere Unterhaltung bei dem Essen im Shoreham wußte sie überhaupt nichts, genau so wenig wie über Henrys klagend vorgebrachte Frage an mich und über meinen Versuch, ihm zu helfen. Ich zweifle, ob Henry heute noch die leiseste Ahnung davon hat, daß ich dank diesem ungewöhnlichen Ereignis über die kleine „Szene”, die mit „Franklin” in seinem Schlafzimmer im Weißen Haus auf meine Kosten über die Bühne ging, vollkommen im Bilde war. Ich war natürlich erschüttert und wütend, sagte aber nur: „Verdammt noch mal!”
Was für ein guter Freund! Was der wohl mit mir vorhat? Zur rechten Zeit erhielt Morgenthau jr. von Roosevelt die passende „Stelle”, für die seine Finanz-Erfahrung allerdings in keiner Weise ausreichte, die Stelle als Minister des Schatzamtes. Einige bedeutende Bankiers hier und im Ausland waren indessen der Meinung, daß Henrys Uner-
124
fahrenheit in diesem Zusammenhang seine außerordentliche Qualifikation für diesen Posten bedeute. War er doch nunmehr für manchen notwendig gebrauchten „Rat” empfänglich. Und selbstverständlich wurde dieser diesbezügliche „Rat” gern erteilt.
Schon sehr bald wurde Harry Dexter White, Morgenthaus vertrauter Genösse und die emsige rechte Hand im Schatzamt, für ihn „ausgegraben”. Wer hat diesen Schritt veranlaßt? Roosevelt sicher nicht. Ging er von Baruch oder Henrys Vater oder irgendeinem ausländischen Banken-Konzern aus? Für jene wurde Harry Dexter White ein nützlicher Lieferjunge, aber nicht für uns. Seine katastrophalen finanziellen Manipulationen, die in erster Linie darauf zielten, die Finanzmächte zu bereichern, wurden allerdings von wachen Amerikanern weit eher erkannt als seine berichtete Beisetzung in New England nach einem Herzinfarkt, die merkwürdigerweise an dem Morgen geschah, an dem seine überfällige Entlarvung vor dem Kongreß untersucht werden sollte.
Ich habe mich oft gefragt, ob Morgenthau zufällig den Präsidenten an seinem Bett aufgesucht und ihm gesagt hat: „Franklin, wir müssen mit Harry Dexter White sehr vorsichtig sein.”
Er hätte es tun sollen. Auch habe ich häufig darüber nachgedacht, ob Henry Morgenthau jr. jemals unsere Unterhaltung beim Essen im Shoreham in sein ziemlich umfangreiches Tagebuch eingetragen hat. Wer gab ihm bloß den Tip, mich in diese Falle zu locken? Könnte es vielleicht Felix Frankfurter oder Louis Howe gewesen sein, die ihm klar gemacht haben, daß ich kein richtiger „Liberalist” sei, und daß ich deshalb im Wege stehen, ja vielleicht sogar gefährlich werden könnte? Oder war der „Befehl” an Henry von meiner Schwiegermutter gegeben, so daß er genug Mut fassen konnte, der „Operation Schlittenfahrt” den notwendigen Anstoß zu geben?
125
Auf jeden Fall entpuppten sich Henry Morgenthau jr. und Harry Dexter White in unserem Schatzamt als ein äußerst feines Gespann. Mit einer großartigen „Keckheit” zeigte sich Henry als Finanzgröße. Für die mächtigen New Yorker Banken und Übersee-Bankkonzerne hätte sich dieses nicht besser auswirken können. Mit viel Erfolg verstanden sie es, auf Henry und seine engen Mitarbeiter zu schauen, um schmutzige Geschäfte durchführen zu können. Diese Situation brachte für einen längeren Zeitabschnitt den Verlust des größten Teils unserer Goldreserven in Fort Knox mit sich. Geplant war dies schon vor dem 4. März 1933. Die ins Leben gerufene Gesetzgebung für das neue Gold-Programm wurde Roosevelt zur Unterzeichnung rechtzeitig vorgelegt, so daß den Amerikanern kein Gold mehr zur Verfügung stand. Die Europäer dagegen konnten mit Unterstützung durch ihre Banken über Gold verfügen. Mit Hilfe des größten Teils unserer mitarbeitenden Presse wurde dem amerikanischen Volke auf diese Weise durch verschiedene propagandistische Ergüsse klar gemacht, daß der eventuell gewünschte Besitz oder Erwerb von Gold ganz unmodern und eine ganz altmodische wirtschaftliche Phantasie sei.
Nachdem Morgenthau sich im Shoreham-Hotel so schäbig benommen hatte, brauchte er sicher keine Vorschläge mehr von mir in finanziellen Fragen. Ganz unverkennbar war er jetzt auf der nationalen Bühne erschienen, eine Situation, die sowohl ernste als auch humoristische Ausblicke bot.
Einige aufklärende Ausblicke über Morgenthaus noch in der Schwebe befindliche Beförderung in das hohe Amt können gut wie folgt skizziert werden: Als ich kürzlich mit meinen Freunden Norman Dodd und seiner Gattin in ihrem Heim in New York einen sehr vergnügten Abend verlebte, sprachen wir über alte Zeiten. Norman ist ein gut bekannter Wirtschaftler in New York. Aus irgend-
126
einem Grunde kamen wir im Laufe der Unterhaltung auf Henry Morgenthau jr. zu sprechen. Ich erzählte Norman die nicht gerade sehr begeisterten Äußerungen, die Robert Lehman eines Tages in New York mir gegenüber gemacht hatte, als wir über die Ernennung Henrys zum Minister des Schatzamtes sprachen. Im Laufe der Zeit schrieb mir Norman die folgende passende Antwort zu jener Äußerung, nachdem er an einem interessanten Frühstück im Weißen Haus teilgenommen hatte: „Nach einem Interview im Hause Ihrer Schwiegermutter (Frau Franklin D. Roosevelt) zur Teestunde, das durch einen beiderseitigen Freund zustande kam, und bei dem ich meine These dem Sinne nach anführte, daß die Verhältnisse, denen sich der Präsident gegenübersah, von Menschenhand gemacht worden seien. Darauf wurde ich zum Frühstück im Weißen Haus Ende Mai 1933 eingeladen. Selbstverständlich nahm ich die Einladung an und fand mich sehr bald in einem kleinen Eßzimmer Ihrer Schwiegermutter gegenüber. Anwesend waren Fräulein Le Hand, Henry Wallace und Henry Morgenthau (jr.). Unmittelbar darauf bat mich Frau Roosevelt, noch einmal vorzutragen, was ich in New York erzählt hatte. Ich tat es, und zwar mit dem Hintergedanken, daß die Zeit jetzt gekommen wäre, die Architekten, die die oben erwähnten Zustände geschaffen hätten, zu enthüllen, und daß sie im öffentlichen Interesse durch die ausübende Macht der Regierung beschränkt würden.
Sofort befand ich mich in einer heftigen Argumentation mit Morgenthau jr. - das war noch vor seiner Ernennung zum Minister des Schatzamtes - im Hinblick auf die Auswirkungen auf das öffentliche Interesse der Finanzen, wie es bis jetzt ausgeübt wurde, wie auch auf die ganze Wirtschaftslage. Während dieser Argumentation vergaßen wir ganz das Frühstück. Alle anderen Anwesenden schwiegen. Nach schätzungsweise dreißig Minuten erklärte Morgen-
127
thau jr: ,Herr Dodd, in Wirklichkeit weiß ich tatsächlich nichts von dieser Sache, über die wir eben diskutiert haben. Ich bin in Washington unter Befehl und ich beabsichtige, das Beste zu tun, was ich kann.’ Offen gesagt, über seine Bereitwilligkeit, mir gegenüber eine derartige Feststellung zu treffen, war ich erschüttert, indessen entschuldigte ich dies, da ich von Frau Roosevelt eingeführt worden war und es nichts schaden könnte, eine Bemerkung zu machen, wie er sie wünschte.
Wie Sie sich wohl denken können, gewann diese Bemerkung sehr an Bedeutung, als er dann auf den Posten im Schatzamt erhoben wurde. Mittlerweile hatte Wallace sein Frühstück beendet, so daß er an unserer Unterhaltung teilnehmen konnte. Es schmeichelte mir, ihn sagen zu hören, daß er mit mir vollkommen übereinstimme und daß er meinen Standpunkt ganz und gar verstehe und hoffe, daß meine Bemühungen unter den soliden, einflußreichen und wohlwollenden Geschäftsleuten von Erfolg begleitet sein würden. Andererseits bezweifelte er, ob ich Erfolg haben könnte, da seiner Meinung nach die Opposition sich im ganzen als zu stark erweisen würde. Er schloß mit der Bemerkung: Infolge der Stärke der Opposition müßte die Aufgabe, sie zu zügeln, von der Regierung als eine Notwendigkeit in Angriff genommen werden. Wann und ob dies überhaupt durchgeführt werden würde, es würde das Ende der Vereinigten Staaten bedeuten. Hiermit schloß unser Frühstück. Wallace und Morgenthau gingen zu ihren Büros.
Als anmutige Gastgeberin lud mich Frau Roosevelt zu einer kleinen Unterhaltung in einem oben gelegenen Wohnzimmer ein, wo sie sich ausgiebig für meinen Besuch bedankte. Ich faßte das als einen diplomatischen Akt auf und verabschiedete mich nach einer halben Stunde. Es ist mir ganz unmöglich, dieses Erlebnis zu vergessen. Es ist auch meine feste Absicht, gerade im Hinblick auf die nach-
128
folgenden Ereignisse, es immer im Gedächtnis zu behalten, vor allem das, was Morgenthau enthüllte” (Hervorhebung vom Verfasser des Briefes).
Im Hinblick auf Dodds aufklärende und überraschende Mitteilungen über Morgenthau jr. habe ich mir stets eine passende Gelegenheit gewünscht, um letzterem folgende Fragen vorzulegen: Auf „wessen Befehl” war er in Washington und für wen wollte er stets sein Bestes tun? Im Geiste stellte ich mir vor, wie Morgenthau erst einmal seine Muskeln gegen mich straffen würde. Fraglos hatte er „auf Befehl gehandelt”! Vielleicht hatte er zu jener Zeit auch so etwas wie eine Vision und beschloß, danach zu handeln. Vielleicht erblickte er in dieser Vision eine imaginäre zukünftige Versammlung, auf der an seinen beiden Seiten zwei Harrys saßen - White und Hopkins - und auf einem Stuhl an jenem Konferenztisch nahm auch Curtis Dall teil.
Gesprochen wurde dabei über eine Sache von größter Wichtigkeit, über „US-Geld-Platten für Sowjetrußland”! Wie sollte nun der Plan aussehen, nach dem die Vereinigten Staaten, noch selbst nach Kriegsschluß eine „Kriegs-Notstandsmacht”, eine ausgesuchte Gruppe Europäer zusammen mit vielen ihrer guten Freunde bei uns sehr reich machen sollten? Ein derartiger Plan müßte natürlich so ausfallen, daß der amerikanische Steuerzahler nicht dahinterkäme, wie sein Vermögen immer mehr entwertet würde, und wie es damit, unter lautem Protestgeschrei, zu einem schweren Angriff auf das US-Schatzamt kommen würde. Dieser auf hoher Ebene ausgeklügelte „Geldplatten-Plan” war fraglos ein Grund, die Staaten in den Zweiten Weltkrieg hineinzumanövrieren, während der größte Teil der amerikanischen Bürger das Gegenteil wollte. Es war ein schlauer Plan, für den Steuerzahler ein kostspieliger.
Diese imaginäre Konferenz wurde schließlich eröffnet.
129
Henry hörte Harry Dexter Whites ausdrucksvoller und ausgeprägter Darstellung zugunsten des Geldplattengeschäftes zu, wobei er die Zustimmung des Ministers des Schatzamtes verlangte, die sofort gegeben und unterstützt wurde durch Harry Hopkins zweimaliges Beifallsnicken. Dann war die geisterhafte Stimme von Curtis Dall ganz deutlich zu hören: „Herr Minister, ich bedaure sagen zu müssen, daß der Ihnen gerade vorgelegte Plan von Herrn White trotz Gutheißung Ihrerseits und Unterstützung von Herrn Hopkins verfassungswidrig und damit höchst fragwürdig ist. Die Geldplatten, Papier und Tinte der Vereinigten Staaten dürfen niemals aus unserem Land hinauskommen. Sie dürfen niemals nach Sowjetrußland geliefert werden. In begrenzten Mengen dürfen wir „Militärgeld” herausgeben, aber auch dann nur unter sorgfältiger Aufsicht.”
Die Vision verschwand dann, aber die Worte von Curtis Dall mögen doch vielleicht in Henry Morgenthaus Gedächtnis haften geblieben sein.
130
Vierzehntes Kapitel
Meine Abschiedsrede an das Weiße Haus
Nach dem Einsetzungstage legten sich langsam die böigen Märzwinde in Washington. Bald kamen dann die Kirschblüten und vom Kapitol eine Fülle neuer Gesetze.
Infolge des Schließens der Banken und ihrer darauffolgenden Wiedereröffnung unter beschränkten Bedingungen kamen viele ernsthafte Probleme auf, die für jedermann von äußerster Wichtigkeit waren. Der Hauptfaktor in dieser allumfassenden Situation war das Gold als Grundlage einer soliden Währung und des Kredites. Wenn die ganze „Bankfrage” noch vor März 1933 zusammen mit Hoovers ersuchter Mitarbeit von der neuen Regierung eingeleitet worden wäre, hätte man mehr Zeit gespart und hätten viele Banken überlebt.
Immer wieder wurde die Reconstruction Finance Corporation um dringende Hilfe gebeten. Manchen Banken konnte überhaupt nicht mehr geholfen werden. Andere wiederum brauchten nur eine angemessene Unterstützung, um sich bis zur Rückkehr zu normalen Zeiten über Wasser zu halten. Häufig schloß sich eine schwächere Bank mit einer stärkeren zusammen, wodurch sich letztere die Gelegenheit zu einer interessanten Expansion bot. Dabei darf man aber auch nicht die Profitmöglichkeiten übersehen, die sich aus rechtzeitigen Verkäufen der schwächeren Stamm-Bank-Aktien auf dem freien Markt durch „eingeweihte Kreise” schon vor der öffentlichen Bekanntmachung der Verschmelzung ergaben. Nachdem das New Deal ungefähr einen Monat in Kraft war, suchte mich ein sehr guter Freund von mir, Willis Wilmot aus New Orleans, in Wa-
131
shington in wichtigen Bankgeschäften auf. Seine Familienbank hatte Schwierigkeiten.
Ohne weitere Förmlichkeit wurde er am Oster-Sonntagabend zum Essen im Weißen Haus eingeladen. Die Gattin des Präsidenten zeigte sich der Lage gewachsen, indem sie Rühreier in einer Warmpfanne zubereitete.
Nach dem Essen sagte Roosevelt: „Wollt ihr nicht zu mir nach oben kommen und eine Zigarre rauchen, wobei wir uns zwanglos unterhalten können? Vor halbneun habe ich keine weiteren Verabredungen, dann kommt nämlich Sumner Welles, um seine Ernennung zum Gesandten in Kuba entgegenzunehmen.”
Wir gingen nach oben in sein ovales Herrenzimmer. Roosevelt schien ganz gelöst und begann sofort: „Curt, wir müssen irgend etwas tun, um das Preisniveau zu heben, sonst kann sich das Land nicht erholen.” Dann wies er auf verschiedene Möglichkeiten hin, wie das seiner Ansicht nach vielleicht durchgeführt werden könnte, unter anderem auch auf Erhöhung des Goldpreises, wobei er aber zu Willis und mir sagte, daß er absolut dagegen sei und es auch unter keinen Umständen tun würde.
Am Schluß des langen vertraulichen Gespräches hatten wir beide das bestimmte Gefühl, daß das Preisniveau wohl gehoben werden würde, jedoch nicht durch Erhöhung des Goldpreises, denn dann würde unsere Währung geschwächt werden.
Man muß sich einmal meine wirklich große Überraschung vorstellen, als ich einige Tage später in der Zeitung las, daß wir ziemlich weit von der Goldwährung abgegangen wären. Es schien mir kaum glaublich, doch noch unglaublicher klang mir die allerdings unbestätigte Geschichte, daß einmal in der Woche der Präsident mit Jesse Jones und Henry Morgenthau jr. zusammenkomme, um für die kommende Woche den Goldpreis festzusetzen, einmal durch Knobeln.
132
Es dauerte ungefähr ein Jahr, bis der Preis für Gold schließlich von zwanzig Dollar je Unze auf fünfunddreißig Dollar je Unze angestiegen war. Dann blieb er stehen. Für einige internationale Banken war dieses Goldgeschäft kein „schlechtes” Geschäft.
Mit Ausnahme einiger weniger Fälle wurde den Amerikanern das Gold durch „inspirierte Gesetze” weggenommen, den Ausländern jedoch durch ihre Banken zur Verfügung gestellt. Roosevelt rief dieses besondere Gesetz nicht ins Leben. Es wurde von „oben” befohlen.
Die Roosevelt-Berater (der Rat für Auswärtige Angelegenheiten) hatten, unterstützt durch ihre hochgradigen Freunde im Ausschuß der Federal Reserve Bank, wirklich gut „geraten”. Wenn man auf den Strudel, den diese neue Gesetzgebung in dem Kongreß-Trichter verursacht hat, hinweist und auf die Schnelligkeit, mit der das Gesetz über die Bühne ging, erkennt man ganz deutlich, daß die Grundlage dafür schon seit vielen Monaten von größeren Gruppen in New York vorbereitet worden war. Einige von diesen Persönlichkeiten wurden die wirklichen Autoritäten oder „Experten” auf Gebieten wie dem Bankwesen, Arbeit, Landwirtschaft, Steuern usw. Die Schlüsselfiguren des Hauses und des Senats wurden rechtzeitig in Kenntnis gesetzt und unterrichtet, so daß das Gesetz in erstaunlich kurzer Zeit verabschiedet werden konnte. Während der Monate vor der Wahl im Jahre 1932 führte ich in Wallstreet förmlich ein „Wortgefecht” und argumentierte mit vielen republikanischen Freunden über die verschiedenen Vorzüge der demokratischen und republikanischen Kandidaten. Meine Argumente zugunsten von Roosevelt waren natürlich persönlicher Art und kamen aus dem Gefühl der Treue zu ihm.
Ich glaube jedoch, daß die meisten aufgeschlossenen Leute erkannten, daß das demokratische Programm von 1932 als solches gut war. Nach mehreren Monaten allerdings
133
wurde mir bewußt, daß das für die Wähler 1932 vorbereitete demokratische „Programm” eigentlich nur dazu diente, gelesen und nach Zählung der Stimmen vergessen zu werden.
Anstatt das dem Volke vorgestellte Regierungsprogramm durchzuführen, tauchte plötzlich ein sogenannter „Hirn-Trust” auf: eine kleine Gruppe von Männern, durchweg sehr stattliche Persönlichkeiten, die der Regierung bestimmte politische Ideen der Berater für die allgemeine Gesetzgebung vortrugen. Unter diesen Männern befanden sich führende Persönlichkeiten um Roosevelt, verschiedene Bankiers und andere Internationalisten. Die Mitglieder dieses Hirn-Trustes arbeiteten mit einem ausgesprochen feinen Spürsinn, häufig in einer übertriebenen Art professionaler Herablassung. Das Ganze wurde von viel Pfeifenrauchen begleitet. Diese Atmosphäre dauerte ihre Zeit. Mir scheint die Bezeichnung „Hirn-Trust” vielseitig, farbenreich und ein ganz theatralisches, kluges und malerisches „Ablenkungsmanöver”. Es diente dazu, die öffentliche Aufmerksamkeit von einigen mächtigen pro-zionistischen Beratern Roosevelts, die emsig hinter den Kulissen arbeiteten, abzulenken. Sicher wurde noch eine ganze Anzahl der gewöhnlichen Anordnungen und anderer Geschäfte von Jim Farley in der üblichen Art und Weise, wie es sich für eine neue Regierung gehört, gut bearbeitet. Jedoch waren für besonders ausgesuchte Kabinettsposten sowie für die Berater des Weißen Hauses Mitglieder des Hirn-Trustes diese wertvollen Männer die anerkannten Lehrmeister der Berater auf der strategischen Ebene. Es verlangte von ihnen, daß sie eine starke Betonung auf „objektive Ideologie” legten, angefüllt mit mannigfaltigen Wunschträumen, die sie aus ihren sozialistischen Schriften über eine noch garnicht erprobte sozialistische Ein-Welt-Idee herausphantasiert hatten.
Persönlich gesehen, ist es mir äußerst widerwärtig, mich
134
gezwungen zu fühlen, den Council on Foreign Relation (CFR) zu zeigen, wie er wirklich ist, und zwar, weil ich Freunde und Bekannte habe, die sowohl Mitglieder und auch in den regionalen Zweigstellen sind. Auf Grund von Unterhaltungen mit einigen von ihnen scheinen sie hauptsächlich aus dem Grunde Mitglieder geworden zu sein, weil sie sich einbildeten, eine höhere soziale Stellung zu erreichen, um nicht hinter den reichen Müllers oder Meyers zurückzubleiben. Mag auch sein, weil die Mitglieder ein oder zweimal im Jahr zusammenkommen und dann bei einem großen Essen mit den Oberbonzen Schulter an Schulter zusammensitzen oder sich händeschüttelnd vor ihnen verbeugen und ihre Namen dann sorgfältig eingraviert auf dem Programm finden. Oder aber sie haben sich eingebildet, sie könnten wertvolle Verbindungen zu den höchsten Rechtsanwalt-Firmen finden oder gar ein dickes geschäftliches Bankkonto aufmachen oder aber ein dickes Bündel Hypotheken oder eine Lebensversicherung in der Cocktailstunde oder beim Kaffeetrinken an ein Clubmitglied verkaufen.
Vielleicht auch könnten sie dort einigen ausgesuchten Treuhändern begegnen, die in den großen steuerfreien Anstalten sitzen oder zu verschiedenen Präsidenten des Ivy League College, die sicher dort sein werden, „wie geht’s” sagen, oder aber sie hoffen, sorgfältig gewählte Worte zu hören, wie und wo die UNO den „Frieden” durch einen neuen Krieg erhalten kann, um einige unterentwickelte Länder oder Gruppen „an das Licht” des Tages treten zu lassen, natürlich ausgestattet mit einer neu manipulierten UNO-Währung.
Vielleicht können sie auch einmal mit dem Kopf nicken, um einem neuen CFR-Mitglied ihre „Zustimmung” zu geben, eine vakant gewordene Stelle am Obersten Gerichtshof einzunehmen, oder aber auch um eine wichtige protestantische Diözese mit einem CFR gewählten politi-
135
schen Quadratschädel, der aus einem runden Kragen heraussieht, neu zu besetzen, oder aber einem vorgeschlagenen Namen für einen neuen Sekretär des Schatzamtes zuzustimmen. Möglich, daß sie dieses alles können! Doch wissen in Wirklichkeit nur ganz wenige Mitglieder des CFR über die weittragenden Pläne der kleinen obersten Führungsgruppe Bescheid. Wenn man die Auswirkungen aller untergeordneten Bereiche bedenkt, kann man wohl sagen, daß über neunzig Prozent aller Mitglieder überhaupt nicht wissen, wer „oben die erste Geige spielt”. Pausenlos wird fortwährend gespielt, wobei von der CFR keine Zeit verloren wird, unseren rechtmäßig gewählten Beamten das Tanzen nach dieser Melodie beizubringen.
Aus dieser Tatsache geht ganz klar hervor, daß wir keine vom Volke aus konstituierte Regierung haben, sondern eine spitzfindige Diktatur von Wenigen. Es ist eine internationale, in Dunkel gehüllte Diktatur, aufgebaut auf der Grundlage vieler verwirrter und benebelter Postensucher, die natürlich nach außen hin für das unwissend gehaltene Volk eine in jeder Weise distinguierte Fassade zeigt.
Fraglos hätte auch ich mir einen gemütlichen und bequemen Sitz vor Jahren auf einem Bankett ergattern können, aber das unbedingte Wissen, daß unsere konstitutionelle Republik etwas unendlich Kostbares ist und beschützt werden muß und nicht ausgebeutet werden darf, überragte bei mir alle anderen Überlegungen. Es dauerte seine Zeit, bis die wirklichen Ziele der CFR und die der führenden Gouverneure der Federal Reserve Bank Board mir vollkommen bewußt wurden. Im Grund heißt es nur: „Geld gegen Volk” und „Geld” gewinnt. Trotzdem wird, auf lange Sicht gesehen, das Volk über dieses minderwertige Ein-Welt-Finanzprogramm, das jetzt durch die abgerichteten Hörigen und Werkzeuge der FCR und der europäischen Gegenspieler bei den Banken erfüllt werden soll, triumphieren.
136
Um noch einmal auf die Erhöhung des Goldpreises je Unze zurückzukommen, so habe ich das Empfinden, daß der -Präsident an jenem Abend zu Willis und mir ganz ehrlich sprach. Seine CFR-Bankberater müssen ihm befohlen haben, den Goldpreis zu erhöhen, eine lange vorher von ihnen geplante Angelegenheit, bei der man jetzt nur noch auf den richtigen Augenblick wartete, um dieses äußerst profitable, aber drastische Stück Gesetzgebung durchzuführen, sobald die politische Bühne richtig besetzt war und die neuen Schauspieler ihre Rollen gut gelernt hatten.
Eines ist dabei gewiß: Den machtvollen Goldbesitzern hier und im Ausland ist durch diese US-Gesetzgebung kein schwerer Schaden zugefügt worden, im Gegenteil, zur richtigen Zeit haben sie einen mächtigen Profit eingesteckt. Über diese Sache könnte noch viel Genaues geschrieben werden, aber es ist kaum wahrscheinlich, daß diese Möglichkeit besteht.
Das Solide oder der Wert des Geldes, vor allem, daß es immer in der Menge zur Verfügung steht, die notwendig ist, um die wirtschaftlichen Bedürfnisse einer stets wachsenden Bevölkerung zu befriedigen, und zwar ohne geheime Währungs- und Kreditmanipulationen (Ausbreitung oder Verknappung des Kredites für Profit), ist für alle von ausschlaggebender Bedeutung.
So manchem Demokraten, der in der Landespresse über Gold las, befiel der erste Schreck über das New Deal und dabei auch die dunkle Ahnung, daß in ganz unmißverständlichen Worten neue „Schmierenkomödianten” im Spiel eingesetzt worden waren, die die im Parteiprogramm sorgfältig festgelegten Ziele vollkommen außer-achtließen. Natürlich betrachteten manche Republikaner im Hinblick auf die ganze Angelegenheit diese Sache mit scheelsüchtigen Augen und sagten zu mir: „Das habe ich ja gesagt, konnte man etwas anderes erwarten?” Dieses
137
Empfinden hatte natürlich in erster Linie der Durchschnittsbürger, nicht etwa die wenigen hochgestellten Republikaner, die damals wie auch heute in den Beiratsgruppen, die sowohl die Demokratische wie auch die Republikanische Partei überwachen, wohl behütet sind. Da ich in der letzten Zeit nur selten zum Weißen Haus gekommen war, hatte ich die rätselhafte Gestalt Louis Howes auch kaum gesehen. Natürlich war er da, weil er sein Operationsfeld von Albany nach Washington D. C. verlegt hatte. Während seines Aufenthaltes in New York City vom Wahltag im November bis zum 4. März, in der sogenannten „Saure Gurkenzeit”, hatte er seine Zeit nicht vergeudet.
Doch ganz zufällig und nur mit einem Seitenblick hatte ich zweimal gesehen, wie Louis eine kleine Gruppe Männer empfing, sie unter seine Fittiche nahm und in ein ziemlich unauffälliges Nebenzimmer geleitete, um dort eine Konferenz abzuhalten. Als ich eines Morgens nach dem Frühstück nach oben ging, sah ich mehrere Männer, von einem Diener des Weißen Hauses geführt, in jenes Nebenzimmer gehen, wo Louis bereits wartete, um sie zu begrüßen. Die Männer schienen durch die Umgebung ziemlich eingeschüchtert zu sein und trippelten hinter dem Diener her, wobei sie weder nach links noch nach rechts schauten. Einige von ihnen schienen einen zehn Tage alten Bart zu tragen und im ganzen gesehen boten sie für morgendliche Gäste im Weißen Haus einen überaus ungewöhnlichen Anblick.
Als sie dann Louis sahen, schienen sie erlöst zu sein und wurden von ihm beim Betreten des Zimmers herzlich begrüßt. Dann wurde die Tür zugemacht. Ich fragte den Diener, wer die Männer seien. Er wußte es aber auch nicht, nur daß Herr Howe um neun Uhr Gäste erwartete, die ja auch pünktlich gekommen waren. Diese kurze, kleine Szene sowie das verstohlene Benehmen der Besu-
138
eher wie überhaupt ihre ganze Erscheinung schienen mir zu jener Stunde im Weißen Haus sehr unpassend.
Als ich an jenem Morgen Louis nur kurz von weitem sah, war ich mir noch gar nicht bewußt, daß meine „Abschiedsrede” im Weißen Haus nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. Manchmal kann man ja das „Wetter” nicht voraussagen, und dann bricht ohne jede Warnung plötzlich ein Sturm los.
Abends um einhalbzehn Uhr beschloß ich, früh schlafenzugehen, blieb aber in der Mitte auf dem zweiten Stock vor einem großen Zimmer stehen, um, wenn ich nicht irre, Mama gute Nacht zu sagen. Sie saß dort in einer Unterhaltung mit Louis. Der Präsident nahm an einem Diner teil. Der ganze zweite Stock schien gänzlich leer zu sein. Ich war immer der Meinung, es sei Louis’ großes Verdienst gewesen, daß durch seine wirksamen politischen Bemühungen Roosevelt Präsident wurde. Tatsächlich schien es mir immer zweifelhaft, ob er ohne das anhaltende Bestreben von Louis vor anderen dieses Ziel erreicht hätte. Daher hatte ich Louis am Einführungstag zu seinem Erfolg herzlich gratuliert, worüber er sich freute, aber auch überrascht zu sein schien.
Auf jeden Fall fing die letzte kurze Unterhaltung zwischen uns Dreien an jenem Abend über unwichtige Dinge sehr ruhig und normal an. Dann sprach ich mit Mama über einige berichtete öffentliche Feststellungen, die Jesse Jones kürzlich in Verbindung mit der Bankenlage gemacht hatte, wobei ich ihr einen aufbauenden Gedanken vorschlug, der in New York wohl gut aufgenommen werden würde.
Aus einem mir völlig unbekannten Grunde mischte sich Louis bei diesem Punkt unverschämterweise in unser Gespräch ein, indem er bemerkte, daß meine Gedanken sich so richtig nach Wallstreet anhörten. Die Art und Weise, wie er das sagte, empörte mich. Die Brücke für uns alle in
139
Wallstreet war vom Oktober 1929 bis März 1933 zum Überqueren sehr lang geworden. Die neuen Politiker und ihre feilen Parteigänger hatten anscheinend wenig Verwendung für irgendjemanden oder für irgendwas in Wallstreet. Ich war wirklich über Louis’ Bemerkung empört und erhob mich, um mich zu verabschieden.
Wir standen alle drei am Eingang des großen Zimmers, und indem ich Louis starr in die Augen blickte, sagte ich: „Louis, wer waren jene Männer oder soll ich lieber sagen Individuen, die heute morgen so früh dich besuchten? Hast du die Absicht, ihnen einige gute Posten zu besorgen? Woher kommen sie?”
Es entstand eine Pause. Louis’ zwergähnliches Gesicht wurde ganz rot, nahm einen ärgerlichen Ausdruck an und begann zu zucken. Er stierte mich an und wie aus der Pistole geschossen kam es zurück: „Es wäre besser für dich, Curtis, wenn du hier darüber nicht sprechen würdest.” Indem ich meine Gedanken zusammennahm, dachte ich: „So sieht das also aus.” Dann ging ich erst so richtig hoch und sagte: „Seit wann bildest du einen Ein-Mann-Ausschuß, um mir zu sagen, was ich hier sagen und tun darf? Seit wann? Paß lieber auf dich selber auf! Damit du es nur weißt, ein jeder von deinen morgendlichen Gästen sah aus, als ob er direkt von Sowjet-Rußland gekommen wäre!” Louis schwankte und sah aus, als ob er eine Herzattacke bekommen würde. Auch Mama war bei meinen Worten ganz blaß. Meine Frage wurde von Louis nicht beantwortet. Die Stille wurde richtig unheimlich. Es wurde weiter kein Wort gesprochen. Das war im März 1933. Jetzt wußten wir „es”!
Meine treffende „Abschiedsrede” an Louis und auch an Mama wurde unglücklicherweise weder im Fernsehen noch auf der Platte, sie wurde aber doch im Gedächtnis von drei Leuten festgehalten! Im Licht der nachfolgenden Ereignisse gesehen, war es tatsächlich eine scharfe Bemer-
140
kung, von der ich weiß, daß Mama und Louis sie nie vergessen werden.
Jetzt als ein nicht mehr amateurpolitischer „Berater” und Kommentator ohne Portefeuille sagte ich in diesem Augenblick „gute Nacht” und zog mich zurück. Das war das letzte Mal, daß ich Louis sah.
141
Fünfzehntes Kapitel
Sara Delano Roosevelt
Mit großer Freude und mit so vielen glücklichen Erinnerungen denke ich an die Zeiten zurück, die ich im Hause und in der Gesellschaft jener entzückenden Dame Sara Delano Roosevelt verbringen durfte; denn sie war im wahren Sinne des Wortes entzückend.
Wie häufig habe ich in den literarischen Bemühungen so mancher Menschen festgestellt, daß sie versuchten, bei dem Leser ein gewisses Bild von ihr zu geben; dort wurde sie dann als eine überhebliche und herrische Person dargestellt, die nur „Leute der guten Gesellschaft” liebte. Die in dieser Hinsicht von einigen politisch angehauchten Schreiberlingen verfaßten Phrasen sind längst überholt und dienen nur ihrem eigenen Zweck. Das diesermaßen entschleierte Bild ist verzerrt. Oft habe ich über die dahinter liegenden Gründe nachgedacht, warum wohl die verschiedenen Versuche gemacht worden sind, ein falsches Bild aufrechtzuerhalten. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, daß sie hauptsächlich dazu dienten, die auf lange Sicht geplanten politischen und ideologischen Ziele ihrer Schwiegertochter zu fördern. Es ist meine Absicht, dieses falsche Bild in diesem Kapitel zu zerstören, wie Al Smith es so treffend sagt: „Nun laßt uns erst mal die Akten einsehen!”
Kein Kapitel in diesem Buch macht mir wohl mehr Freude als dieses. Von dieser prachtvollen Frau ging eine Erhabenheit im Familienkreis und im Hause aus, die einen beseelten Hintergrund darstellte, daß der ihr folgenden Generation, aber auch denen, die nur kurz mit ihr zusammen
142
am Kamin gesessen hatten, immer wieder die Kraft gab, mit starkem Vertrauen in die Welt hinauszugehen. So mütterlich war ihre Erscheinung.
Daß sich die Laufbahn dabei verschieden gestaltete, bei einigen besonders hervorragend, bei anderen verschieden, ruft den widerhallenden Beifall für diese eine Persönlichkeit hervor, die eine derartige Lage ermöglichte. Ihre Zuverlässigkeit und ihr Einfluß waren unanfechtbar. Daher sollte auch die von mir zu ihrer Verteidigung begeistert vorgetragene laudatio von dem Gesichtspunkt aus betrachtet werden, daß er von einem ihr ganz nahestehenden, vollkommen unpolitischen Bewunderer kommt. Sara Delan, Frau James Roosevelt, die Mutter des Präsidenten Franklin D. Roosevelt, stammte aus der guten alten Delano-Familie aus Newberg, New York, im Herzen der Landschaft am Hudson, tapfere Leute, die sich schon ganz früh für die Entwicklung des Landes einsetzten. Sie heiratete James Roosevelt vom Hydepark, einen soliden, geachteten, nicht mehr ganz jungen Bürger. Offenbar wußte James Roosevelt von den Förderungen und Verschmelzungen der Eisenbahn und beteiligte sich Ende des 19. Jahrhunderts daran. Er war sowohl mit den Vanderbilts wie auch mit den Astors verwandt; in seiner konservativen Art muß er ein ausgezeichneter Geschäftsmann gewesen sein. Er führte das Leben eines Landedelmannes. Der mit mir verwandte Zweig der Delano-Familie waren zuerst seefahrende Leute aus Fair Haven in Connecticut. Von Fair Haven aus trieben sie Handel mit dem Fernen Osten. Zu derselben Zeit betrieb auch einer meiner Vorfahren, Alijah Austin, gleichfalls das Geschäft mit dem Fernen Osten, jedoch von einem Platz nahe bei New Haven in Connecticut.
Einen interessanten Einblick dieser früheren, tapferen und aufregenden amerikanischen Tätigkeit gewinnt man aus dem Buch meiner Ururgroßmutter Mary Austin Holley,
143
einer sehr schönen Biographie von Rebecca Smith Lee. In ihr heißt es: „Das Jahr 1793 war für Elijah Austin ein glückliches. Die Landungen aus Westindien und Europa waren vielfach gewinnbringend; aber als man dann endlich hörte, daß sein Segler aus Canton beim Leuchtturm (New Haven) stand, war alles andere vergessen. Als es an jenem Tage langsam in den Hafen einsegelte, war Geschichte gemacht worden. Ein jeder, der nur konnte, Mann, Frau und Kind in der Stadt, waren am Ufer, um zu sehen, wie es sich ruhig seinem Landungsplatz näherte. Der Rumpf war schwarz und die Segel geflickt, aber stolz flatterten die Fahnen im Winde… die amerikanische Flagge, mit denselben dreizehn Sternen und Streifen, die sie trug, als sie fortsegelten und darunter Elijahs Hausflagge.
Während des Winters und Frühlings war Elijah Austin eifrig an der Gründung einer Gesellschaft beteiligt, um größere Schiffe für den Chinahandel zu bauen. Da das erfolgreiche Kanton-Experiment seine Idee gewesen war, stürzte er sich mit seinem ganzen Vermögen auf dieses neue Projekt und lieh Geld, wo er nur konnte: bei seinem Schwiegervater und bei Timothy Phelps, von seinen Mühlen- und Bierverwandten und von anderen. Der Kiel des neuen Schiffes wurde unter der Leitung seines zukünftigen Kapitäns, Daniel Greene, in Hartford gelegt. Das ganze Projekt würde bis achtundvierzigtausend Dollar kosten, alles aus den Taschen der Leute aus Connecticut. Die Atmosphäre war mit großen Hoffnungen erfüllt. Um sich die Vorteile für den neuen Handel zu sichern, gründeten zwanzig oder noch mehr prominente Männer die Handelskammer in New Haven. Unter ihnen natürlich Elijah wie auch viele seiner Verwandten.”
Auf jeden Fall waren die Austins und die Delanos mit zahlreichen anderen in ihrer Tätigkeit zu Wasser und zu Lande die Pioniere New Englands, die das junge New
144
England aufbauten und entwickelten, wobei sie immer als führende Persönlichkeiten des freien Unternehmertums in der ersten Reihe standen.
Die Delano-Familie war groß und wurde offenbar immer durch eine Tatsache zusammengehalten, die ich stets sehr geachtet und bewundert habe, durch die Familientreue.
Nicht lange nach der Heirat Sara Delanos mit James Roosevelt wurde ihr Haus in Hydepark vergrößert. Ein neuer Flügel wurde angebaut, was viel zu Erleichterungen und zur Architektur beitrug. Wann „Onkel Rosy” den angrenzenden Platz kaufte, weiß ich nicht. Er war kleiner, aber sehr anziehend.
Wenn man Frau Roosevelts großes Haus betritt, so ist man über den Umfang des großen Zimmers an der linken Seite, zu dem man einige Stufen tiefer gelangt, überrascht. Das Familienleben spielt sich zum größten Teil in der nach Osten liegenden Ecke des Zimmers ab. Über dem viel im Herbst und Winter benutzten großen Kamin hing ein Bild von Isaak Roosevelt. Es zeigte einen im Stil des späten 18. Jh.s gekleideten, ziemlich „mürrisch” aussehenden alten Herrn, der immer auf der Hut zu sein schien. Ich hatte stets das Gefühl, daß er mich bei jedem Geschäft übervorteilen würde. Als ich einmal über das Porträt mit Roosevelt sprach, sagte dieser breit lächelnd: „Meinst du nicht, Curt, daß, bevor wir mit dem reden, wir erst noch mal unsern Schlips zurechtrücken müssen, was?” Ich stimmte zu.
Die meisten von uns können unsere Familien viele Generationen zurückverfolgen, aber wenn einer von uns selbst „rückwärts” geht, wird die Sache verdammt kompliziert. Wie ich gehört habe, war die Familie von Franklin Roosevelt englischer, holländischer, jüdischer und französischer Abstammung. Ich habe eigentlich niemals besonders darüber nachgedacht, außer, daß sie eine sehr solide amerikanische Abstammung hatten. Die Delanos neigten als Fa-
145
milie mehr auf die französische Seite. Eine von Franklin Roosevelt besonders gern erzählte Geschichte über Sara Delano war nach meiner Erinnerung die, daß sie mit ihrem „Papa” auf dem Segelschiff „Surprise” eine große Seereise unternahm, wodurch ihr Interesse an Geographie und Sprachen wuchs; auf jeden Fall war es ein ungewöhnliches und großes Ereignis für ein junges Mädchen, zumal da zu jener Zeit die Welt noch viel „größer” war. Fünfzig Kilometer die Stunde war damals unglaublich viel. Wie ich mich noch erinnere, sprach ich einmal mit „Granny” über Segelschiffe, den China-Handel von Fair Haven, New Haven und New Bedford und auch über verschiedene zur See fahrende Familien. Dabei erzählte sie, daß, wenn ihr Vater von einer langen Seereise aus dem Fernen Osten nach Hause gekommen war, er „niemals über das Geschäft sprach”.
Es ist nur gerecht, wenn man an jene harten Tage zurückdenkt, als der Wind die Segel füllte (oder auch nicht), vor der Zeit der Dampfmaschine, des Dieselöls, der Düsenmaschinen und der Kernkraft, sich einmal bewußt zu werden, was diese Männer, die den Elementen trotzten, für große, ja ungeheure persönliche Wagnisse auf sich nahmen und es häufig gar nicht überlebten, um nach Hause zurückkehren zu können. Die aber, die wieder nach Hause kamen, hatten einen guten, gesunden Gewinn gemacht, den sie auch behalten konnten, was gewiß in Ordnung war; jedenfalls gesünder und richtiger als das ewige Kniebeugen vor einem neidischen, marionettenhaften Bundesapparat, der bestrebt ist, den größten Teil unseres Verdienstes durch zahlreiche - angeblich nur für gute Zwecke - errichtete Steuern zu nehmen und uns auszuziehen.
Um fortzufahren, so bin ich mir bewußt, daß die alten Seekapitäne große Risiken auf sich nehmen mußten, was sie auch beim Transport und Handel mit den Produkten des Fernen Ostens wie Seide, Porzellan, Rum, Sklaven,
146
Elfenbein, Mahagoni, Teakholz und vielleicht auch Narkotika taten. Einige gut bekannte Journalisten haben in bezug auf Roosevelts Vorfahren das letztere erwähnt; fraglos ein anstößiger Punkt. Wahrscheinlich wird aber jetzt dieses Produkt heimlich noch mit Überschallgeschwindigkeit fliegenden Düsenflugzeugen durch die ganze Welt transportiert. Es besteht kein Zweifel, daß diese Beobachtungen auf Tatsachen beruhen. In jenen Tagen verkörperte der Kapitän eines Segelschiffes das Gesetz, wie er es ansah, und wofür er persönlich verantwortlich war.
So war der Seekapitän aus New Haven weitaus schöpferischer und verantwortungsvoller als die meisten unserer heutigen Regierungsbeamten und Gewerkschaftsführer. Die Seekapitäne waren für die Gesundheit, Sicherheit und für das Leben ihrer Mannschaft und für ihr Schiff verantwortlich, aber auch für den Erfolg oder das Mißlingen des Wagnisses.
*
Ich begegnete Frau Roosevelt zuerst in Hydepark, New York. Von ihrem am Hudson gelegenen Landgut, das mit der Zeit immer schöner geworden war, hatte man einen wundervollen Ausblick vom östlichen Ufer des Hudson, ungefähr zehn Kilometer nördlich von Poughkeepsie. Ihr Haus in New York City war der westliche Teil eines großen Doppelhauses Nr. 47 und 49 East 65ste Straße. Sie selbst bewohnte die westliche Hälfte und ihr Sohn mit seiner Familie den östlichen Teil. Natürlich ganz unpolitisch gesehen, lag ihr Eingang zu dem Hause auf der linken Seite und der ihres Sohnes auf der rechten Seite. Das Vorderzimmer im zweiten Stock in der 47sten East 65sten Straße, das sie als ihre Bibliothek bezeichnete, war sehr interessant und gemütlich, das dahinter gelegene Besuchszimmer dagegen steif. Es wurde selten benutzt.
Bei der Ende Dezember gegebenen ziemlich tumultvollen
147
Hausgesellschaft in Hyde Park war Frau Roosevelt die Gastgeberin. Anschließend fand dann auf dem in der Nähe gelegenen Landgut der Archibald-Rogers-Familie eine von den berühmten Sylvestergesellschaften statt. Zu dieser jährlich stattfindenden Gesellschaft kamen die am Hudson lebenden Familien von weit und breit her.
Frau Roosevelt und Frau Rogers waren eng befreundet. Letztere war eine charmante und gütige Gastgeberin. Wie bereits vorher erwähnt, war einer ihrer Söhne, Edmund, in der Jugend mit Roosevelt eng befreundet gewesen. Als Verlobter ihrer Enkelin besuchte ich dann Frau Roosevelt fünf Monate später. Sie empfing mich in der Bibliothek. Ich bekam dadurch die Gelegenheit, sie kennen und ihre edlen Charakterzüge schätzen zu lernen.
Im Juni bestimmte Anna den Hochzeitstag. Die Trauung sollte in der St.-James-Kirche, Hydepark, stattfinden, anschließend dann der Empfang auf dem Landgut ihrer Großmutter in Springwood. Roosevelt war schon seit vielen Jahren Kirchenvorsteher der St.-James-Kirche, einem ziemlich altmodischen Gotteshaus.
Schon lange im voraus wurden Pläne geschmiedet. Umfangreiche Vorkehrungen mußten getroffen werden, um für das Wohlergehen der Gäste zu sorgen, zumal da Springwood ziemlich weit draußen auf dem Lande lag. Viele Menschen wurden eingeladen und viele kamen.
Infolge der starken Beschwerung durch die Beinschienen wollte Roosevelt nicht viel umhergehen. Deswegen sollte Jimmy seine Schwester zum Altar geleiten, um sie dort ihrem Vater zu übergeben, und die weiteren Zeremonien auf sich nehmen.
Am Nachmittag vor dem großen Ereignis verließen Robert Lehman und ich frühzeitig das Büro und fuhren mit dem Wagen nach Hydepark, um rechtzeitig zu den Abendfestlichkeiten dort zu sein. Die Nacht verbrachten wir in Springwood. Van Lear Black kam ebenfalls von
148
Baltimore frühzeitig mit einer Gesellschaft an Bord seiner Jacht Sabalo an; sie ging an der Küste im Hudson vor Anker, ungefähr eine Meile vom Hause entfernt.
Am nächsten Tag gab Herr Black an Bord ein Frühstück für die Familie und für das Brautpaar. Er war ein feiner und ausgezeichneter Gastgeber, auch schätzte er Roosevelt sehr hoch.
Annas Polizeihund „Chief” fühlte, daß etwas Ungewöhnliches vor sich ging und schien sehr unruhig zu sein. Für einen Polizeihund war er etwas zu klein, aber er war ein feiner Hund, den jeder gernhatte. Es wurde dann beschlossen, daß „Chief” mit einer großen weißen Schleife für die Feierlichkeiten „geschmückt” werden sollte, was dann auch geschah. Die New Yorker Zeitungen waren am nächsten Tag voll von dieser Auszeichnung.
Nach dem Juni nannte Granny mich ihren „Enkel”, eine freundliche und herzliche Geste ihrerseits, die ich sehr zu schätzen wußte und niemals vergaß. Für mich wurde sie „Granny” und blieb es bis zum Ende. Ihre Bibliothek in New York war außergewöhnlich, teils steif, dann aber auch wieder gemütlich. Die Aubussonbrücke auf dem Fußboden wirkte steif, die Bilder an den Wänden dagegen nicht. Ihr Schreibtisch war im wahren Sinne des Wortes überladen mit silbernen Schreibtischutensilien, Zeitungen, noch zu beantwortenden Briefen, Büchern und Zeitschriften, die sie las, alles umgeben von einer Unmenge Familienfotos. Ihre Bibliothek jedoch war der Treffpunkt, an dem bei jeder Gelegenheit alle zusammenkamen.
Das Eßzimmer unten war ziemlich dunkel, nach englischem Stil mit Eichenholz verkleidet, schön, wirkte aber etwas schwer.
Auf der zweiten Etage befand sich ein Eingang, der beide Häuser verband, so daß man, ohne hinausgehen zu müssen, von einem Haus in das andere gehen konnte. Beide Häuser glichen einander. Wie in den meisten großen Fa-
149
milien wirken sich Kleinigkeiten, die Harmonie oder Streit schaffen können, nicht über Nacht aus.
Als ihr Sohn heiratete, hatte Frau Roosevelt fraglos den dringenden Wunsch, ihrer jungen Schwiegertochter zu helfen, was sie auch zu einem großen Teil tat. Sie ließ das Haus für beide herrichten und hat den größten Teil der Möbel für ihres Sohnes Haus gekauft. Es ist sehr zweifelhaft, ob er zu jener Zeit Haus und Möbel hätte kaufen können. Vielleicht hat sie auch das Hauspersonal mitbesorgt und die Sommerreisen nach Campobello und nach anderen Plätzen bezahlt. Was soll man dazu sagen? Ich bin überzeugt, daß die meisten Jungverheirateten Paare sich gefreut hätten, wenn sie so großzügig bedacht worden wären. Roosevelt war ihr einziger Sohn, und da seine Mutter früh Witwe geworden war, war es ganz natürlich, daß ihre ganze Aufmerksamkeit ihrem Sohn und seiner Familie gewidmet war.
Ich möchte jedoch darauf hinweisen, daß Roosevelt nicht gerade auf die von seiner Mutter angebotenen Aufmerksamkeiten und Erleichterungen angewiesen war, es sei denn, es paßte ihm am besten in sein Programm. Um seine Mutter nun wahrheitsgetreu zu schildern, wäre es besser, richtige Kennzeichnungen wie großzügig, hingebungsvoll, interessiert, zuvorkommend usw. an die Stelle jener boshaften Ausdrücke wie herrschsüchtig, selbstherrlich, protzig und so weiter zu setzen.
Um noch einmal auf jene Behauptung zurückzukommen, daß Sara Delano Roosevelt nur „Leute der Gesellschaft” leiden mochte, muß ich sagen, daß diese Anspielungen überhaupt nicht am Platze sind. Natürlich mochte sie „gut erzogene Menschen”. Wer mag das nicht? Die daraus gezogenen Folgerungen aber, daß sie nur sozial gut gestellte Leute liebte, und daß sie eine Angeberin war, sind in keiner Weise korrekt, ebensowenig, daß sie keine Zeit für „Arbeiter” (ein zwielichtiger Ausdruck) hatte. Sind wir
150
nicht in Wirklichkeit alle Arbeiter - bis auf die Drohnen?
Sara Delano Roosevelt begegnete allen Menschen zu jeder Zeit vollkommen natürlich. Warum hätte sie wohl wie ein politischer Kandidat, der hinter seinem Posten herläuft, handeln sollen? Ihr Wirtschaftsverwalter und ihr Hauspersonal z. B. waren jahrelang bei ihr, und das spricht sicher für sie.
Dieses reichlich billige politische „Spiel”, sie als Angeberin und herrschsüchtig erscheinen zu lassen, hatte fraglos den Sinn, auf diese Weise ein Bild zu schaffen, das ihrer Schwiegertochter erlaubte, für sich „politische Sympathien” zu erwerben, um dadurch einen „Bruch” in Szene zu setzen, um frei zu werden und sich bei der Masse beliebt zu machen. Es war ein besserer Stimmenfang, denn hinsichtlich der Stimmen gilt immer die Mehrheit, die die Stimmen bringt. Von diesen Gedanken wurde ihre Schwiegertochter beherrscht. So häufig wie möglich besuchte Sara Delano Roosevelt ihre beiden verwitweten Schwestern, Frau Paul Forbes und Frau Price Collier, an denen sie sehr hing. Frau Paul Forbes war schon älter, als ich sie kennenlernte. Sie waren beide bezaubernd und es war immer sehr interessant, der Unterhaltung der drei Delano-Schwestern zuhören zu dürfen.
Gelegentlich besuchte Granny auch ihren älteren Bruder Frederic A. Delano, der in New York und Washington ein tätiger Geschäftsmann war. Während der Wintermonate, die sie in New York verbrachte, lud Granny häufig Freunde am Sonntag zum Mittagessen um ein Uhr ein. Manchmal waren es sehr interessante Gäste, manchmal auch nicht. Aber es waren ihre Freunde. Wenn wir sonntags in der Stadt waren, wurden wir häufig von ihr eingeladen. Obwohl wir einer ganz anderen Generation angehörten, trugen wir immer etwas zu der Unterhaltung bei. Ich genoß wirklich diese sonntäglichen Ereignisse.
151
Wenn meine Schwiegermutter Grannys Sonntagseinladungen gegenüber auch nicht ablehnend war, so ging sie doch selten hin, weil sie sie „muffig” fand. Mag sein, daß es manchmal so war, aber das dauerte nicht lange. Jedoch im Hinblick auf die vielen Vorteile, die sie gehabt hat, hätte sie meiner Meinung nach etwas mehr Verständnis aufbringen müssen. Im übrigen war Granny damals schon hoch in den Jahren und hatte in der Woche nicht so häufig die Gelegenheit, ihre Familie und Freunde zu sehen. Die „Schatten” des Alters begannen sich auf sie herabzusenken.
Ein Mittagessen an einem Sonntag 1927 ist mir noch in bester Erinnerung, da es besonders interessant und vergnügt war. Es war kurz, bevor Roosevelt zum Gouverneur von New York gewählt wurde. Er war daher politisch stets etwas zurückhaltend, hatte aber immer noch Hoffnung und vor allem seine Ziele, Gefühle, die auch von ändern geteilt wurden.
Granny hatte zum Mittagessen Herrn und Frau Dr. Nicholas Murray Butler mit anderen zusammen eingeladen. Sie hatte sich aber im voraus vergewissert, daß Eleanor und Franklin ebenfalls kommen würden. Wie ich mich erinnere, war Dr. Butler zu jener Zeit dabei, sein hohes Amt als Präsident der Columbia-Universität niederzulegen. Außerdem war er ein sehr „hohes Tier” in der Republikanischen Partei des Staates New York. Nach meiner Ansicht war Dr. Butler viel zu klug, um als „Eierkopf” zu gelten, selbst nicht in Felix Frankfurters liberaler „Brutstätte”.
Schon sehr bald gerieten Dr. Butler und Roosevelt in eine widerstreitende, jedoch höfliche Unterhaltung. Wenn ich so zurückblicke, war das wirklich kein langweiliger Sonntag, an dem jeder viel zu viel aß und dann nach einer Entschuldigung suchte, um ein Nickerchen machen zu können, um wieder für einen tätigen Montag bereit zu sein.
152
Wenn ich auch, wie bereits erwähnt, politisch damals gänzlich „ahnungslos” war, so hörte ich doch mit acht anderen Leuten dieser Auseinandersetzung zwischen Roosevelt und Dr. Butler zu, nachdem ich erst einmal meine Aufmerksamkeit dem Roastbeef und Yorkshire-Pudding zugewandt hatte. Dieses Hin und Her war zweifellos besser als die heutigen Fernseh-Interviews über aktuelle Fragen. Hier gab es keine abgetönten Bänder, die schon im voraus von den links eingestellten Besitzern der Fernseh-Stationen zurechtgestimmt waren, wie es von unsern heutigen ideologischen Diktatoren nach dem Motto „zurechtgezimmerte Nachrichten” verlangt wird. Butler gegen Roosevelt kam ganz frisch aus dem „heißen Ofen”.
Roosevelt und Butler faßten manches heiße Eisen an wie Nationalschuld, Steuern, anwachsender Bürokratismus in Washington, die zunehmenden Forderungen der Gewerkschaftsführer und ihre Kontrolle über die ungeheuren Gelder, die ihnen aus den Beiträgen der Mitglieder auf einen Wink hin zur Verfügung stehen. Meiner Meinung nach argumentierten beide Herren sehr gut, besonders Dr. Butler, der allerdings in seiner Eigenschaft als Gast etwas gehemmt schien. Mama hörte sehr aufmerksam zu, blieb aber ganz zurückhaltend.
Nach dem Kaffee rüsteten die Gäste zum Aufbruch. Ich nahm Roosevelt beim Arm und geleitete ihn über den Eingang auf dem zweiten Flur langsam zurück nach Nr. 49. Als wir so entlangschritten, sagte er zu mir: „Gurt, was denkst du von den Ausführungen dieses Wunderknaben?” Taktvoll sagte ich: „Ihr beide, Pa, wart wirklich sehr interessant. Eure Unterhaltung hätte nur länger dauern sollen. Um einen Baseball-Ausdruck zu gebrauchen, möchte ich sagen, unentschieden.” Er lachte herzlich.
Während der Sommerferien 1928 warteten wir in einem kleinen Dorf Bécherel bei Paris in einer alten Mühle, die jetzt zum Restaurant Le Moulin de Bécherel umgebaut
153
worden ist, auf unser Mittagessen. Es war klein und altmodisch, aber das Essen war sehr gut. Ein jeder von uns genoß diese außergewöhnliche Umgebung, und bald saßen wir alle um den Tisch herum in festlicher Stimmung. Die beiden attraktiv und vornehm aussehenden Delano-Schwestern sahen an diesem Tag besonders gut aus. Mit einem Blick von der Seite sah ich, wie der Maitre d’Hotel sie mit offensichtlicher Bewunderung ansah. Er überschlug sich förmlich in seinen Bemühungen, für ein schönes Essen zu sorgen. Bald näherte er sich mir in einer höflichen Art und bat um Grannys Namen. Ich sah ihm starr in die Augen und sagte feierlich und etwas ehrfurchtsvoll in meinem besten (aber beschränkten) Französisch: „Elle est la Duchesse de Bécherell” (Sie ist die Herzogin von Bécherell). Für einen Augenblick schien er überrascht und starrte mich blöde an, dann brach er plötzlich in ein Gelächter aus und sagte: „Oh, ihr Amerikaner!” Granny sah an diesem Tag wirklich besonders gut aus!
Bei verschiedenen Gelegenheiten nannte ich sie später „La Duchesse de Bécherell”, was immer bei allen ein fröhliches Lachen auslöste und zu den vergnügten Erinnerungen an jene glückliche Zeit gehörte. Da Granny ihrem einzigen Sohn gegenüber immer äußerst treu und hingebungsvoll war, ist es auch ganz natürlich, daß sie eine Politik befolgte, die seinem Hauptziel, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, diente. Als dann später die Politik wirklich an sie herantrat, zog sie sich geziemend zurück; für eine Persönlichkeit, die schon älter war und dabei Kenntnisse und eine gute Beobachtungsgabe hatte, war das gar nicht so einfach.
Dabei wußte sie genau, was gespielt wurde, ließ sich nichts vormachen und konnte genau den Weizen von der Spreu trennen. Trotzdem wurde es ihr manchmal mit den politischen „Fleischklößen”, die immer und immer wieder, besonders beim Mittagessen auftauchten, zu langweilig.
154
Meiner Meinung nach zog sie sich mit Rücksicht auf das politische Programm ihres Sohnes und ihrer Schwiegertochter würdevoll zurück; unterstützte auch dabei ihre Ziele, obgleich sie so manche dieser Programmpunkte mit Sorge, ja sogar mit großem Mißtrauen betrachtete.
Die ersten beiden Jahre in Albany zeigten Granny den Weg, den sie gehen mußte und den sie auch ging. In dieser Hinsicht dürfte sie wohl keine Kritik verdient haben, die auf Egoismus und ungenauen Tatsachen beruht, sondern im Gegenteil, sie hatte sich einen anhaltenden Beifall für ihre wirkliche Größe verdient. Es machte mich ganz unglücklich, ansehen zu müssen, wie es im Laufe der Zeit immer mehr mit ihr zu Ende ging. Aber bekanntlich macht der Tod keine Ausnahme.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn meine Mutter sich bei so mancher glücklichen Gelegenheit mit Granny unterhielt. Mit wieviel Würde wurde so manches wichtige Problem in ihrer Unterhaltung berührt. Im wahren Sinne des Wortes waren sie zwei aufgeschlossene freundliche Damen, von denen es heute leider infolge der verschiedenen, unsere Kultur beeinträchtigenden Einflüsse nur noch ganz wenige gibt.
Als ich 1933 in Washington mit einer kurzen Verbeugung die Bühne verließ, nicht ohne einige kleine Anerkennungen, über die Roosevelt Bescheid wußte, erklärte Granny in aller Ruhe, sie wünsche, daß ich auch fernerhin als einer ihrer drei Vermögensverwalter tätig sein solle. Seit ungefähr zehn Jahren hatten Frederic A. Delano, Franklin D. Roosevelt und Curtis B. Dall dieses Amt inne. Diese großzügige und faire Geste mir gegenüber wußte ich hoch zu schätzen. Ich blieb also weiterhin einer der Vermögensverwalter für Sara Delano Roosevelt, bis sie von dieser Welt schied, um ihre gerechte Belohnung zu bekommen. Leider konnte ich dem Begräbnis nicht beiwohnen. Aber ihr Hinscheiden habe ich trotzdem nie vergessen.
155
Obgleich es mir zu jener Zeit finanziell nicht so gut ging, schrieb ich dem Präsidenten einen Brief, in dem ich gleichzeitig eine Kopie an Fred Delano schickte. Meine Unterschrift zu dieser Zeit war notwendig, um mehrere gerichtliche Dokumente im Zusammenhang mit Grannys Nachlaß abzuschließen. In meinem Brief an Roosevelt schrieb ich unter anderem: „Ich stimme der Abrechnung zu”, und fuhr dann fort: „Daß ich so viele Jahre für Deine Mutter tätig sein durfte, war für mich eine große Ehre, und so möchte ich Dir, als einem der Vermögensverwalter, sagen, daß ich auf jedes Entgelt verzichte. Bitte unterrichte auch Onkel Fred.” Kurz darauf erhielt ich eine Antwort von dem Präsidenten, in der er seine große Wertschätzung für meine Haltung und für meine Gefühle gegenüber seiner Mutter ausdrückte. Offenbar war es nicht leicht für ihn gewesen, diesen Brief zu schreiben.
So wurde meine Tätigkeit als Vermögensverwalter für Sara Delano Roosevelt durch deren Tod beendet. Die Bande der Freundschaft mit dem Präsidenten blieben auch weiterhin erhalten. Allerdings nur auf gesellschaftlichem Gebiet, was sicherlich so manchen guten politischen Kopf verwirrte.
Meine warmen Gefühle und die große Bewunderung für Sara Delano Roosevelt blieben immer erhalten. Wenn ich an sie denke, dann tauchen drei Worte auf, die alles besagen; das Bild in meinem Herzen ist dann ganz vollständig und ich lese: „Sara Delano Roosevelt - magna cum laude.” Eine Ehrenbezeugung von ihrem Enkel.
156
Sechzehntes Kapitel
Louis McH. Howe
Wer war nun eigentlich Louis McHenry Howe? Von vielen Menschen ist diese Frage an mich gerichtet worden. Ich kann aber wirklich nur sagen, ich weiß es tatsächlich nicht, wer er war und was er vorstellte. Eins steht jedoch fest: Er war eine der dunkelsten Gestalten, denen ich jemals begegnet bin.
Roosevelt erzählte mir einmal, er kenne Louis seit seiner ersten politischen Tätigkeit in Albany, er sei immer sehr nützlich und zuverlässig gewesen. Das war aber auch alles. Granny sagte mir einmal, daß sie es „gründlich satt hätte, Louis die ganze Zeit über um sich zu haben”. Nach ihrer Meinung übe er keinen guten Einfluß auf Franklin und Eleanor aus. Damals hatte ich auf Grund meiner sehr beschränkten Kenntnisse der Ideologien und der Ein-Welt-Politik keine Ahnung, welchen Einfluß sie meinte. Ich bemerkte nur, daß Louis Howe augenscheinlich irgendwie „gegen die Regierung” war.
Von anderer Seite erfuhr ich, daß Louis seit seiner ersten politischen Tätigkeit in Albany eine Zuneigung zu Roosevelt hatte. Er sah in ihm wohl den „kommenden Mann” in demokratischen politischen Kreisen und hatte sich dann „an ihn gehängt”, um seine weitreichenden Pläne zu unterstützen, sogar so weit, daß er den größten Teil seiner Zeit auf dieses Projekt konzentrierte. Louis war damals Reporter einer New Yorker Zeitung in Albany. Daher paßten auch die öffentlichen Berichte und Bemühungen, die er in Roosevelts Interesse unternahm, gut in dieses Bild. Selbstverständlich zahlte Roosevelt Louis mit der
157
Zeit seine Bemühungen. Bei mir indessen steigerte sich immer mehr der Verdacht, daß Louis auch von anderen Leuten in diesem Bereich belohnt würde. Vielleicht war es derselbe „Einfluß”, der Anfang 1912 Colonel E. Mandell House an die Seite Woodrow Wilsons brachte. So wurde auch Louis Howe in seiner Eigenschaft als Anwärter von großem Wert Roosevelt und seiner Frau zugeführt wie zwei Anwärtern von gleichem Wert. Wer weiß das? Gerade zur richtigen Zeit kam Louis zu Roosevelt, wohnte bei ihm und hatte ein Zimmer auf der obersten Etage der 49. E. im 65sten Street House in New York. Dort traf ich ihn sehr häufig, gewöhnlich um die Mittagszeit.
Wenn Louis seinen steifen Kragen umband, dann war es auch ein ganz großer, hoch und breit über zwei Größen zu weit. Steife Kragen wurden in jener Zeit von den meisten Männern getragen. Gewöhnlich erschien Louis schön von seinem Kragen umgeben. Daher gelegentlich eine freundliche Geste an „Louis, den Riesenkragen”.
Wenn man sich das jetzt überlegt, trug Louis wirklich einen großen „politischen Kragen”, viel größer und bedeutender, als ich es in den zwanziger Jahren glaubte, in denen ich ihn zuerst kennenlernte. Er erwarb ihn sich durch unablässige Arbeit an seinem Projekt. Und dieses Projekt bestand darin, Roosevelt zum Präsidenten der USA über den wohlbekannten „ausgetretenen” Weg seit Albany und New York zu machen.
Offen gesagt, habe ich immer die Bedeutung Louis” auf seinem eigentlichen Gebiet der Politik stark unterschätzt. Daher möchte ich noch meine besondere Anerkennung ihm gegenüber ausdrücken, und zwar für die von ihm geleistete Tätigkeit, unabhängig davon, was seine auf weite Sicht gesehene politische Philosophie bezwecken sollte. Sowohl in seiner Erscheinung wie auch in seinen Handlungen war er eine ungewöhnliche Persönlichkeit. Er war tatsächlich etwas Außergewöhnliches. Um ehrlich zu sein, muß
158
ich sagen, daß unsere Ansichten und Meinungen immer von gänzlich entgegengesetzten Anschauungen herrührten. Aus diesem Grunde hielt ich ihn auch für interessant. Von keinem Menschen habe ich jemals gehört, daß er Louis beschuldigte, seine Badebürste übermäßig stark benutzt zu haben, um frisch und rosig auszusehen; meinerseits hätte eine derartige wunderliche Beobachtung ein großes Erstaunen ausgelöst und wäre wahrscheinlich von einem inneren Lachen begleitet worden. Manchmal verbrannte Louis in seinem Zimmer in der obersten Etage Weihrauch. Der so entstehende Geruch, gemischt mit abgestandenem Zigarettenqualm, schuf eine eigenartige Kombination, die schwerlich einen Parfümeur zur Nachahmung angeregt hätte, um sie unter die Menge zu bringen.
Louis’ Familie lebte in Fall River, Massachusetts, und häufig fuhr er von New York für einige Tage dorthin. Nach Magnolia in Massachusetts hatte sich Colonel E. Mandel House zurückgezogen, eine aus mehreren Gründen interessierende Tatsache.
Meiner Ansicht nach besteht eine überraschende Ähnlichkeit zwischen Louis Howe und Colonel House, eine Tatsache, mit der man mehrere Seiten füllen könnte. Ich will indessen diese Ähnlichkeit zwischen beiden nur kurz streifen. Wie bereits gesagt, gewann Louis noch in jungen Jahren durch seine Zeitungsreportertätigkeit in New York City und Albany Interesse an Politik und Parteipolitik, genau wie Colonel House in Austin, Texas, durch seine Tätigkeit in allgemeinen und örtlichen Wahlkämpfen.
Nebenbei gesagt, ist der Titel „Colonel” bei „Colonel House” nur auf eine verbindliche politische Geste seitens eines Texas-Gouverneurs zurückzuführen für einige ihm erwiesene politische Dienste. Ich bezweifle, daß sowohl Colonel House wie auch Louis Howe jemals auch nur einen Tag Militärdienst geleistet haben. Beide, sowohl Howe wie auch House, waren körperlich ziemlich
159
schwächlich und fühlten sich daher zu den körperlich aktiven und aggressiven Naturen hingezogen, um mit ihnen zusammenzuarbeiten. Beide waren sich darüber klar, daß, um erfolgreich zu sein, sie dies nur mit oder hinter einer starken Persönlichkeit erreichen konnten, und so handelten sie mit Hilfe Roosevelts und Woodrow Wilsons.
In ihrem Denken waren beide, sowohl Howe wie auch House, reichlich unfruchtbar und daher immer bereit, Befehle von „oben” in Empfang zu nehmen, dabei zuverlässig und verschwiegen, Mitspieler in einer auf weite Sicht angelegten Strategie.
Es ist selbstverständlich, daß, als die „große Strategie” ihrer Projekte immer mehr an Bedeutung gewann, auch ihr Einfluß „hinter der Szene” gleichermaßen wuchs. Diese Lage hob natürlich weitgehend das Ego eines jeden, fraglos mit dem Gefühl, daß jeder öffentliche Beifall und jede Lobpreisung auf „ihren Mann” nur ihren persönlichen Anstrengungen zu danken war, was ja auch zum Teil zutraf.
Louis sah in Roosevelt den kommenden politischen Mann, und zwar schon vor dem Ersten Weltkrieg. Als Zweiter Sekretär der Marine stieg Roosevelts Stern weiter in demokratischen Kreisen. Ob damals schon jene Leute dahinter saßen, die Louis veranlaßten, sich eng an Roosevelt und seine Frau anzuschließen, um „dort zu bleiben und sich häuslich niederzulassen”, weiß ich nicht, aber es ist sehr gut möglich.
Colonel House wurde auf Woodrow Wilson aufmerksam, als dieser Gouverneur von New Jersey in Trenton wurde und „politisch viel Aufsehen erregte”, indem er sich direkt an die höchste Clique wandte, an die ersten Ein-Welt-Macher. Mit Zustimmung seiner Berater schloß Colonel House sich rechtzeitig an Woodrow Wilson an und wurde so sein politischer Antreiber, Berater und Steuermann, eben sein zweites Ich.
160
Colonel House war sich darüber klar, daß Wilsons akademische Talente und sein Idealismus, den er rechtzeitig in Princeton zum Ausdruck gebracht hatte, noch durch einen starken persönlichen Ehrgeiz überragt wurden. Auch wußte er, daß Wilson durch Erpressungen leicht zu verletzen war. Aus allem schloß House, daß, wenn Wilson in die richtige politische Richtung gelenkt würde, er auch für seine politischen und ideologischen Hintermänner „nach oben geschoben” werden könnte, wie sich zum Unglück für unser Land erwiesen hat.
Aus seiner früheren Tätigkeit in Texas heraus erweiterte Colonel House allmählich seinen politischen Horizont und interessierte sich weitgehend für nationale und internationale Fragen. Wie man sagt, soll er auch die Aufmerksamkeit einiger Mitglieder der Rothschild-Bankgruppe, einer prozionistischen politischen Gruppe, in allen für sie wichtigen Fragen auf sich gelenkt haben. Er verstand es, ihre Auffassung immer zur richtigen Zeit weiterzugeben. Sie sollen 1919 die Urheber des Council on Foreign Relations gewesen sein, die die Vereinten Nationen und das Ein-Welt-Projekt forderten. Colonel House wurde dazu benutzt, insgeheim in ihren vordersten Reihen tätig zu sein. Natürlich achtete er auch sorgfältig darauf, daß „sein Mann” Woodrow Wilson dieses Spiegelbild auch immer widerspiegelte.
Sowohl Howe wie auch House blieben bei dem überaus wichtigen Vorgang, ihren Mann am Wahltag durchzubekommen, im Hintergrund, dabei ihre Schlüsselstellungen beherrschend, wobei sie sich aber stets vergewisserten, daß ihre Männer taktisch immer einsatzfähig waren und die richtigen Worte für die richtigen Leute fanden, besonders wenn der „Klingelbeutel” für die ganz großen Stiftungen umging.
Man muß sich natürlich darüber im klaren sein, daß große Politik und Parteipolitik zwei ganz verschiedene Dinge
161
sind. Parteipolitik ist eine bessere Schaustellung, große Politik aber eine sehr ernste Sache.
Ob es nun der Unterschied einer langen Reihe von Jahren war zwischen diesen beiden Männern, oder in den zwanziger Jahren die Berater mit den Folgen des Ersten Weltkrieges reicher und damit aggressiver geworden waren, ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall hat Louis seine Macht nicht übertrieben und ist auch nicht länger geblieben, als es notwendig war und wie es Colonel House tat, sondern er gab auf der Höhe seines politischen Prestiges und seiner Einflußsphäre in seiner politischen Rolle in Washington seine Stellung auf, um auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Andererseits verlor Colonel House, als er eine führende Rolle auf der internationalen Bühne spielte, anscheinend auf der Pariser Friedenskonferenz 1919 an Boden und wurde durch Frankfurter, Baruch und einige Ein-Welt-Bankiers sehr grob niedergetreten, nachdem der Krieg “gewonnen war. Damals wurde auch Präsident Wilson kühler ihm gegenüber.
Die außerordentliche Zusammenkunft in Magnolia Massachusetts im Hause von Colonel House, an der die demokratischen Kandidaten Roosevelts und seiner intimen Clique teilnahmen, als sie von der erfolgreichen Chicagoer Konvention 1932 zurückkkehrten, muß sehr interessant und von weitreichender Bedeutung gewesen sein. Fraglos fand Louis Gefallen an dieser Zusammenkunft, weil er die rechte Hand des demokratischen Präsidentschaftskandidaten war, von dem die meisten Menschen glaubten, daß er die Wahlen im November gewinnen würde. Daher war Louis’ politisches Format stark in die Breite gegangen. Sein „Stern” stieg und stieg immer höher, während der Stern von Colonel House zu verlöschen drohte.
Der folgsame und pflichttreue Colonel House half Präsident Wilson bei der Ernennung seiner Kabinettsmitglieder und half ihm auch weitgehend, hinter den Kulissen die
162
Zustimmung des Kongresses zu bekommen für das kostspielige, im Privatbesitz befindliche Federal Reserve Bankgeschäft, genannt die Federal Reserve Bank Act. Ferner leistete er einigen politischen Pro-Zionistenführern sowie dem Richter am Obersten Gerichtshof Brandeis in einem wenig bekannten Handel mit England 1916 Hilfe. Es handelte sich darum, Amerika an Englands Seite in den Ersten Weltkrieg zu bringen, wofür England sich verpflichtete, ihnen zu gegebener Zeit „Palästina zu überlassen”.
Nach dem erfolgreichen Abschluß des Ersten Weltkrieges im November 1918 hatten Bernard Baruch, Richter Louis D. Brandeis und Felix Frankfurter die Dienste des Colonel House anscheinend weniger nötig. Der Völkerbund hatte sich als nutzlos und auch als unerwünscht erwiesen und wurde von den USA abgelehnt. Präsident Wilsons Gesundheit brach zusammen. Kurze Zeit darauf wurde er Invalide. Die Rolle von Colonel House als sein „politischer Makler” und Wachhund war damit ausgespielt.
Fraglos behandelten die späteren leitenden Roosevelt-Berater Colonel House immer mit der gebührenden Achtung, schon auf Grund seiner intimen Kenntnisse in zahlreichen vertraulichen Fragen, über die die amerikanische Öffentlichkeit überhaupt nicht unterrichtet war. So wurden die scharfsinnigen Anstrengungen von Colonel House, dieses ruhigen, mit geschmeidiger Stimme sprechenden Vertrauten und politischen Lehrers des ausgenutzten College-Professors zum Abschluß gebracht. Mrs. Edith Galt Wilson schien in Colonel House sehr bald einen „ideologischen Sprinter” zu sehen und tat das Ihrige, seinen Ruf tüchtig zu schmälern, vor allem in Hinsicht auf irgendwelchen weiteren Kontakt mit ihrem kränklichen Ehegatten, und zwar schon lange vor Wilsons Abgang.
Colonel House wurde noch nicht einmal zum Begräbnis Wilsons in Washington eingeladen, „seines Mannes” der
163
vergangenen Jahre. Fest lenkte er jedoch Wilsons politische Hand seit den Tagen in Trenton New Jersey im Jahre 1912, bis durch den Eintritt in den Krieg Amerika schließlich Deutschlands Schicksal besiegelte und nun die pro-zionistischen Führer von England verlangten, seinen Verpflichtungen aus dem Geschäft im Jahre 1916, „ihnen Palästina zu geben”, nachzukommen.
Zur Vervollständigung des Internationalisten-Programms muß noch gesagt werden, daß nach Louis Howes Tode Harry Hopkins durch die Berater in das Weiße Haus lanciert wurde. Auf diese Weise wurde Harry Hopkins eng angeschlossen an Roosevelt, ein zweiter Colonel House. Hopkins Operationen waren weitaus mehr der Öffentlichkeit zugänglich und entwickelten sich, wie bei einer internationalen Marionette üblich, in der Richtung auf die Ein-Welt-Regierung, und zwar in einer auf weite Sicht geplanten Strategie, die direkt vom Weißen Haus aus gelenkt wurde.
Wie weit Louis dabei in seiner politischen Philosophie „ganz nach links” abgerutscht ist, vermag ich nicht zu sagen. Es war jedoch keine Frage, daß er selbst sehr links eingestellt war.
Als ich Louis 1933 zuletzt sah, war zu unsern Diskussionen etwas Neues hinzugetreten. Ursprünglich hielten sie sich innerhalb einer gewissen Grenze oder hatten einen ausgesprochen lokalen Charakter. Was ich jedoch eines Morgens ganz durch Zufall im Weißen Haus feststellen mußte, und zwar beim Anblick einer Louis-Besuchergruppe, hat mich nicht nur sehr beeindruckt, sondern auch regelrecht verwirrt. Es schien mir, als ob von Louis’ Operationen ein politischer „Geruch” und nicht etwa Weihrauch aufsteige, und ich hatte das Empfinden, daß dieser „Geruch” nicht in das Weiße Haus gehöre. Ich sprach das ihm gegenüber auch an meinem letzten Abend dort offen aus. Als Louis Howe starb, verlor Roosevelt nicht nur ei-
164
nen langjährigen guten Freund, sondern auch einen scharfsinnigen politischen Berater.
Es war für Roosevelt nicht möglich, diesen Verlust zu ersetzen, aber mit der Zeit zeigte es sich, daß Louis’ beide Schüler mit Erfolg bestanden hatten und auf dieser Grundlage auch handelten. Die durch Louis’ Tod geschaffene Situation brachte für neue Gesichter eine gute Gelegenheit, sehr viel näher an Roosevelt im Weißen Haus heranzukommen, die abwegigen Berater-Ziele in die Praxis umzusetzen und unseren höchsten Beamten als ihr Werkzeug zu benutzen. Und so geschah es denn auch.
165
Siebzehntes Kapitel
Joe Kennedys Blanko-Verkäufe
Seit sechs Jahren waren der Effektenmarkt sowie die ändern Märkte ständig angewachsen. Viele Menschen hatten nach bescheidenen Anfängen riesige Gewinne erzielt, von denen die meisten allerdings nur auf dem Papier standen. Die Prognosen für den Markt waren zum größten Teil immer noch auf Hausse eingestellt und regten trotz bedeutender Kursrückgänge zu weiteren „Käufen” an. Ein ganz bekannter Investmentberater, Roger Babson, hatte indessen zur Vorsicht geraten, daß der Effektenmarkt seinen Höhepunkt erreicht hätte. Eine Zeitlang war er natürlich im Unrecht, bis dann der 24. Oktober 1929 kam und er mehr als recht hatte. Schon bei ein oder zwei Gelegenheiten wäre die Panik beinahe ausgebrochen. Vielleicht war der Effektenmarkt schon vorher von machtvollen Kräften abgetastet worden, vielleicht waren aber auch einige ausländische Interessenten bereits ausgestiegen, vor allem wohl jene, die die rückläufige Wiederanpassung der Preise aus Profitgründen planten.
Auf jeden Fall kam der wirkliche Zusammenbruch am 24. Oktober 1929. Am späten Vormittag lief das Band an der New Yorker Börse hoffnungslos hinter dem Markt her. „Börsenpreise” in führenden Aktien mußten blitzschnell direkt vom Makler auf das Band gebracht werden, denn in vielen Fällen lagen die Börsenpreise unter den letzten Verkaufspreisen, die durch Band im ganzen Lande durchgegeben wurden. Diese Tatsache an sich schuf Furcht und Ungewißheit und wurde daher zum weiteren Antrieb für die anhaltende Verkaufsflut der Effekten.
166
Als ich so um die Mittagszeit mich durch die lärmende Menschenmenge hindurchschlängelte, tauchten hier und da häßliche Gerüchte über den Zusammenbruch „dieser oder jener Firma” auf.
Wie in allen anderen New Yorker Büros herrschte auch in dem unsrigen ein großes Durcheinander. Ich kämpfte an der Börse darum, für unsere Order Vollzugsaktien zu bekommen, und ebenfalls darum, Informationen über „Platzverkäufe” der führenden großen Effektenhäuser für das Büro zu erhalten, um sie unsern wahnsinnig gewordenen Kunden zu übermitteln.
Die Börse selbst war ein Bild für sich. Manieren und das auf der Börse gewohnte Benehmen wurden mit Füßen getreten. Zeitweise war es beinahe wie ein Aufruhr. In vielen Fällen wurden Blankoverkäufe bei einer Bank angekündigt, um ihre Bankkredite zu stützen. Wie ich mich noch erinnere, erschien um 2 Uhr 15 Sir Winston Churchill auf der Besuchergalerie als „Zuschauer”. Wie er selbst so nett sagte, war er in den Staaten auf einer Vortragsreise. Kein Mensch jedoch an der Börse interessierte sich im geringsten für ihn, während er genug zu sehen bekam. Vielleicht hatte er mit Baruch zusammen Mittag gegessen, vielleicht war er auch eingeladen worden, sich das „Schauspiel” anzusehen, was nach Meinung mancher schon vor mehreren Monaten geplant war.
Die Panik wütete im höchsten Grade. Es war wirklich ein Drama. Häßliche Gerüchte entstanden und breiteten sich weiter aus. Leute, die vollkommen den Kopf verloren hatten, stürzten sich aus den hohen Fenstern der in der Nähe liegenden Gebäude. Sie waren nicht mehr in der Lage, ihren Verlusten ins Auge zu sehen. Sirenen der Polizeiwagen heulten durch die Gegend, was ein merkwürdiges und unheimliches Gefühl verursachte. Ich persönlich war nicht übermäßig aufgeregt, aber fühlte eine starke innere Spannung wie in einer Schlacht: Menschen starben.
167
Wieviele Häuser „wackelten”, wußte in Wirklichkeit keiner. Die Banken wurden bei diesem Preissturz aufs stärkste mithineingerissen. Als der Abend kam, leuchteten die Lichter von den hohen Gebäuden in Wallstreet weit in die Nacht hinaus, einige bis zum frühen Morgen. So manche Geschäftsführer, Angestellte und Kassierer dösten in ihren Stühlen oder schliefen auf dem Fußboden ihrer Büros. Von tiefer Sorge erfüllt, betrachteten die Teilhaber der Firmen die Situation und verhandelten in ruhigem Tone. An diesem Tag wurden 12 894 650 Aktien gehandelt und am 29. Oktober 16410030 Aktien. Es war ein noch nie dagewesener Rekord. Die große Konjunktur der zwanziger Jahre war vorüber. Natürlich erholte sich der Markt in der Folge noch manchmal, aber das war immer nur von kurzer Dauer. Die Jahresabschlüsse der meisten Firmen wiesen erschütternde Verluste aus. Bei mir war es auch so. Der Grundstücksmarkt bekam in erster Linie die Wirkung dieses großen Zusammenbruchs der Aktienkurse zu fühlen. Dann merkten es die Kaufhäuser und zuletzt die Wirtschaft im allgemeinen. Grundstücke konnte man für ein Ei und ein Butterbrot kaufen.
Langsam begannen die Finanzmächte ihre Kräfte umzugruppieren. Stärkere Firmen schluckten schwächere auf. Wallstreet war nicht alleine in diese Katastrophe hineingezogen, „Main Street” war ebenfalls vollständig mitbetroffen.
Sehr viele Faktoren waren fraglos in diese Sache verwickelt und trugen das Ihre zu diesem katastrophalen Ereignis bei. Selbst jene, die einen Einblick in die internationalen Finanzangelegenheiten hätten, konnten nicht genau sagen, wann der große „Zusammenbruch” kommen würde.
Ich denke noch an die Bemerkung von Bernard Baruch hinsichtlich des Aktienmarktes im Frühjahr 1929: „Er sähe ‘Sturmwarnungen'”. Später im Juli berichtete die
168
Presse, er besuche Süd-Frankreich und mache dort mit Bankiersfreunden Ferien. Nach Zeitungsmeldungen ist er dann mit Winston Churchill Anfang August von Süd-Frankreich nach Schottland gefahren, um der Eröffnung der Moorhühnerjagd beizuwohnen.
Im September wurde der Aktienmarkt von einer neuen plötzlichen Nervosität heimgesucht. Und im Oktober ging es erst richtig mit dem eigentlichen Tanz los.
Beim Überdenken des Zusammenbruchs vom 29ten habe ich häufig darüber nachgedacht, ob dieses von der Presse berichtete Zusammentreffen dieser außerordentlich einflußreichen Finanzgrößen im Juli und August in Europa nicht in einer direkten Beziehung zu der im Oktober eröffneten „finanziellen Moorhühner-Jagdsaison” in Main Street in den Vereinigten Staaten gestanden hat. Ich persönlich glaube das.
Im August 1932 begann der Kampf um die Präsidentschaft des Präsidenten Hoover gegen Gouverneur Roosevelt. Wie bereits gesagt, nahm Louis Howe von mir, der ich in Wallstreet arbeitete, nur wenig Notiz. Dann jedoch sollte ich in einem in alle Einzelheiten gehenden Bericht dem „Boß”, so nannte er Roosevelt, gerade über das, was in Wallstreet „nicht richtig war”, aufklären, wobei er darauf hinwies, daß die Demokraten Wallstreet zum Ausgangspunkt ihres Propagandafeldzuges machen wollten.
Es gab indessen in Wallstreet nicht viel, was „nicht in Ordnung war”, um Louis’ Worte zu benutzen. Meiner Meinung nach waren es nur einige geringfügige Punkte und Bereiche, die einer Verbesserung bedurften, wie z. B. bei den Funktionen der Spezialisten, eine bessere öffentliche Unterrichtung über den zur Verfügung stehenden Vermögensstand bei bestimmten Punkten einer angebotenen Subskription, über neue Ausgaben (Emissionen) bezüglich der Obligationen einer Gesellschaft wie z. B. die Aktienlage „der eingeweihten Kreise” und Einzelheiten
169
über ihre Optionsrechte des Gesellschaftskapitals. Das war eigentlich alles, was ich vernünftigerweise vortragen konnte. Mit der Kontrolle der Federal Reserve Bank über Zinssätze, Kredite und über den disponiblen Vorrat an täglichem Geld sowie mit Krediten ganz allgemein gesehen, hatte ich nichts zu tun. Das „Unrichtige oder Inkorrekte” rührte von den an der Spitze stehenden Spekulanten her, und zwar sowohl bei uns wie auch im Ausland. Werde da aber einer mal mit fertig!
Ich persönlich sah das Hauptproblem in der Kontrolle der Versorgung mit Geld, das seinerseits den Zinssatz und den täglichen Geldmarkt kontrolliert. Dadurch wurde andererseits wieder die Aufnahmefähigkeit des Aktienmarktes entweder nach oben oder nach unten gefördert. Doch lag damals dieses Thema gänzlich außerhalb meines Gesichtskreises, und selbst Roosevelt würde nie gewagt haben, es aufzugreifen oder er wäre politisch ein toter Mann gewesen, wobei noch zu prüfen wäre, ob er diese Frage überhaupt verstanden hat, was ich sehr bezweifle. In dieser Hinsicht erhielt er immer viele „Hinweise”.
Auf jeden Fall schrieb ich ein ehrliches, sorgfältig vorbereitetes Memorandum über „Wallstreet”, wie verlangt via Louis an den „Chef”. Louis paßte das jedoch nicht. Er hatte von meinem Memorandum den bestimmten Eindruck, daß es in Wallstreet doch viel Gutes gebe, was ja auch stimmte. Was Louis von mir wollte, war, daß meine Denkschrift rücksichtlos wie ein feuerspeiender Drache alles niedertreten sollte. Gegen ihn sollte dann Roosevelt mit einer politischen Rüstung versehen, tapfer auftreten, um ihn zu treffen und zu schlagen. In den darauf folgenden hundert Tagen des Wahlkampfes sind Louis und ich über diese Sache scharf aneinander geraten, was uns einander sehr entfremdete.
Von meiner Denkschrift und der aufbauenden Kritik habe ich nie wieder etwas gehört. Louis fand jedoch sofort an-
170
dere, die ihm das schön zurechtgemachte politische Bild von Wallstreet lieferten. So entstand eine neue bürokratische Bundeskommission. Der SEC wurde in kurzer Zeit ein Paradies für politische Anwälte, eine Goldgrube.
Frühjahr 1933 schielte Wallstreet mit Besorgnis nach Washington, um von dort das Stichwort zu bekommen, fasziniert, aber auch bekümmert im Hinblick auf den politischen Jahrmarktsrummel, der sich dort abspielte.
Sorgfältig wurden „politische Professoren” ausgesucht, um das Volk zu dem neuen Alphabet umzuerziehen, und zwar in Richtung auf die zahlreichen neuen Ausschüsse, Abteilungen und Agenturen, die natürlich alle von den Günstlingen der Berater und ihrer CFR-Mentoren in Washington besetzt waren. Hierzu gehörte vor allem Prof. Felix Frankfurter. Sein Rat galt sehr viel und sein Ja war unbedingt notwendig. Von anderer Seite ist sogar die Bemerkung gemacht worden, daß Frankfurter es als seine besondere Aufgabe ansah, wichtige Posten in der Regierung mit ihm völlig willigen Strohmännern zu besetzen. Wie Wachs in seinen Händen bildeten sie das größte Netzwerk von Agenten, das jemals unter einem einzigen Mann in unserm Lande geschaffen worden ist.
Das Gejammer über die Unvollkommenheit und Schlechtigkeit von Wallstreet verstummte bald nach der exakt erfolgten Wahlzählung des vorhergehenden Novembers. Mit Hilfe von wichtigen Anwälten des New Deal einschließlich meines Klassenkameraden James Landis und anderer, die nicht schnell genug ihre Krallen nach neuen großen Bezirken ausstrecken konnten, war Louis Howe eifrig damit beschäftigt, die Securities und Exchange Commission (SEC) auszubrüten. Die Aufgabe dieser Kommission sollte darin bestehen, bestimmte Verbesserungen zu schaffen. In Wirklichkeit aber zielte sie dahin, die Kontrolle der Bundesregierung über das Finanzwesen unseres Landes auszudehnen. Eine Zeitlang war es tatsächlich so
171
weit, daß jeder, der im Investmentgeschäft beschäftigt war, sich nicht rasieren oder frühstücken konnte, ohne vorher den Rat eines Anwaltes einzuholen, der „jemanden in Washington kannte”. Selbst dann mußte man sich noch in einer bestimmten Richtung rasieren, um Ruhe zu haben, oder die empfohlene schlank machende „Diät” weiter einhalten.
Die Atmosphäre an der New Yorker Börse wurde im Verhältnis zum vergangenen Jahr allmählich immer lebhafter, ein Zeichen, daß die obersten Plänemacher etwas mehr Vertrauen wie eine milde Gabe ausschütteten, zusammen mit schwachen Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung. Ich erinnere mich noch, zwei vollkommen verschiedene, aber ganz nahe beieinander liegende Richtungen beobachtet zu haben. Man muß natürlich dabei bedenken, daß die New Yorker Aktienbörse wie ein Spiegel die verschiedensten Ereignisse, von irgendwoher zusammengefaßt, reflektiert. So lief z. B. die Begeisterung der Hausse-Spekulanten 1928 und teilweise 1929 auf vollen Touren, bis dann die lange Periode der geschäftlichen Ausdehnung und der steigenden Preise zu Ende ging.
Eine der „Bell-Cow”-Anlagen, die damals großen Optimismus auslöste, war die Radio Corporation of America, genannt Radio. Als Spezialist betrieb Mike Meehan das Radio-Kartell. Er war ein aufgeweckter, gutherziger und freundlicher Irländer mit rötlichem Haar. Wir wurden bald Freunde. Sein engster Teilhaber war George Garlick, ein ungehobelter, aber immer bereiter, klug schnackender kleiner Kerl. Entweder mochte George einen oder nicht. Mit der Zeit wurden wir Freunde, nachdem wir einander in die Haare geraten waren. Ich tat es zu meiner eigenen Verteidigung und er mochte das. Viele Makler drängten sich um Mike, wenn Radio in Bewegung kam.
Als Radio gerade einmal tätig war, bekam Mike eine schwere Kehlkopfentzündung, da er seine Stimme stark
172
überanstrengt hatte. Seine Teilhaber drängten ihn, nach Hause zu gehen, um sich einige Tage auszuruhen. Er wollte aber nicht. So gegen 3 Uhr, kurz vor Schluß der Börse, kam Mike in die Mitte der Radio-Menge, um die Effektenbörse in guter Stimmung zu schließen. Er hob seine Hand, versuchte sein Angebot hinauszuschreien, strengte sich so an, daß die Adern an seinem Hals dick heraustraten und er im Gesicht knallrot wurde, aber er konnte nur flüstern; da ich jedoch dicht bei ihm stand, hörte ich es. Es war ein Angebot über 10 000 Aktien] Radio schloß in guter Stimmung und Mike ging nach Hause, um sich auszuruhen.
Eines Tages erhielt ich den Auftrag, für einen Kunden des Hauses 500 Radio-Aktien zu kaufen. Das Limit lag etwas unter dem Marktpreis. Falls der Markt abschwächte, könnte der Auftrag ausgeführt werden. Daher entschloß ich mich, unter der Menge zu bleiben und ihn zurückzuhalten in der Hoffnung, ihn doch noch ausführen zu können. Ich stand dicht bei Mikes Börsenstand.
Es war ein schöner warmer Sommertag. Ich trug daher an jenem Sonnabendmorgen einen leichten, weißen Leinenanzug zum Wochenende. Als ich so unter der Menge stand, bekleckste dieser Kobold George Garlick meinen weißen Anzug. Ich merkte plötzlich, wie jemand hinter mir auf meinen Rücken schrieb. Brüllendes Gelächter kam von allen Seiten. Klar, ich war in die Falle geraten und so blieb mir nichts anderes übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen und zu lächeln.
Als George Garlick - wer konnte es sonst sein - seinen Kunstsinn mit einem großen weichen Bleistift quer über meinen Rücken in großen schwarzen Buchstaben beendet hatte, stand dort: „Nimm ein Horton”! Das war der Werbeschrei eines ganz bekannten Eiscrems, ähnlich wie ein „Gut gestimmter Mann”, eine bekannte Gestalt im weißen Anzug in der Sommerzeit. George hatte mich so
173
richtig zugerichtet; es noch einmal zu tun, habe ich ihm allerdings niemals wieder Gelegenheit gegeben. Er hätte sein ausgesprochenes Talent lieber in der Werbeindustrie ausnutzen sollen, die damals in Madison Avenue zu blühen begonnen hatte. Als ich diesen Jux auf meine Kosten lächelnd und mit guter Laune quittiert hatte, gab es nichts mehr, was ich nicht von diesem Haufen Irländer, die um Mike herumstanden, bekommen hätte.
Ich erinnere mich ebenfalls, wie ein gewandter Makler einen Ausschnitt aus der New Yorker Zeitung Sunday zeigte, der ein niedliches, kleines Mädchen auf einem Pony bei einem Turnier in Southampton zeigte und dieses Bild auf dem Börsenstand über „General Electric” klebte. Das kleine Mädchen schien ungefähr vier Jahre als zu sein. Ihr Vater, Jack Bouvier, ein sehr schöner Mann mit dunklen Haaren, führte das kleine Pferdchen. In der Börse galt er als Fachmann in General Electric und saß direkt unter dem Bild. An jenem Morgen mußte er viel gutgemeinten Spaß über sich ergehen lassen wie: „Wo war sein Pferd. In welcher Klasse gedachte er zu reiten”, usw. Jack führte seine reizende kleine Tochter Jackie, die später die berühmte Gattin des verstorbenen Präsidenten Kennedy werden sollte. Jacks freundlicher Vater, Herr Bouvier, gehörte damals schon den älteren Jahrgängen an und erschien nur noch gelegentlich an der Börse.
Hinter der Effektenbörse zog sich wie ein schmales Band die New Street hin. Mit einigen Restaurants, kleinen Läden und einer Kunsthandlung usw. gab sie furchtbar an. Nahe der Ecke, bei Wallstreet, hatte sich, allerdings nur bei gutem Wetter, ein kleiner beweglicher Fruchtstand niedergelassen. So war es natürlich für die Mitglieder und Laufburschen sehr bequem, sich dort einen Apfel oder eine Birne zu kaufen, wenn viel zu tun war.
Eines Tages erlaubte sich einer einen Spaß auf Kosten des beliebten Besitzers dieses Fruchtstandes, einem italieni-
174
sehen Amerikaner mit Namen Tony. Es war die Zeit der frischen Pfirsiche. Tony hatte welche. Es ging darum, die Pfirsiche zu begutachten, Tony zu fragen, ob sie wirklich reif wären und dann, um sicher zu gehen, sie zu drücken. Bei Geschäftsschluß hatte Tony nicht einen einzigen von den schönen Pfirsichen verkauft, da die meisten, häufig gedrückt, in der Sommerhitze welk geworden waren; und genau so elend wie die Pfirsiche waren, so tief ließ auch Tony seinen Kopf hängen. Er hatte nichts Ungewöhnliches geahnt.
Einer unserer Burschen, den wir als Kundschafter losgeschickt hatten, meldete uns um halbdrei, daß Tony außer sich und ganz aus der Fassung geraten wäre. Er wäre im Begriff, alles stehen und liegen zu lassen und fortzugehen. Mittlerweile hatte aber schon eine sehr ansehnliche Geldsammlung stattgefunden, um den Verlust wieder gutzumachen, den Tony erlitten hatte, weil man seine Pfirsiche zu sehr unter die Lupe genommen hatte. Eine entsprechende Abordnung ging daher zu Tony, klopfte ihm auf den Rücken und übergab ihm mit viel Hurra und Händewinken die Geldbörse. Tony hatte einen guten Tag gehabt und ging mit einem breiten Lachen nach Hause. Als er aber am nächsten Morgen zur gewohnten Stunde wieder erschien, gab er es uns wieder; auf seinem Schild an seinem Fruchtstand stand dick geschrieben: „Wenn ihr schon die Früchte drücken müßt, dann macht das bitte nur mit meinen Kokosnüssen.” Das waren so ein paar nette, kleine Ereignisse in den erfolgreichen Tagen in Wallstreet während des Jahres 1928 und 1929.
In der Zeit der Depression waren deutlich zwei Grundzüge zu sehen, einmal die hoffnungsvolle aufbauende Kraft und auf der anderen Seit die Kräfte der Zerstörung, ich möchte sagen, Zerstörung aus Geldgier. Nachdem am 24. Oktober 1929 das Vertrauen stark erschüttert war, mußte die Zerstörung noch tiefer greifen, damit die Ein-
175
geweihten auch bis zuletzt eine gute Ernte unter Dach und Fach bringen konnten, bevor das Signal zur Operation „Wiedergewinnung” gegeben werden konnte. Es wäre natürlich für uns sehr wichtig, zu wissen, wer dieses ganze Schauspiel vom 24. Oktober 1929 in Szene gesetzt hatte. Wahrscheinlich war das tatsächliche Datum zufällig, obwohl der Monat für die plötzliche Zurückhaltung der normalen Kreditversorgung augenscheinlich ausgesucht war. Ich fragte mich: Kam dieses „Signal” vom Ausland? Das dürfte zutreffen, denn viele bereits vorgesehene Verkäufe und viele Blanko-Verkäufe von Effekten erfolgten schon vor dem Krach selbst, genau wie nachher, als sich der Markt erholt hatte. In den darauf folgenden Monaten hatte man das Gefühl, daß es in erster Linie drei große Blanko-Verkäufer gab, und zwar Tom Bragg, Ben Smith und Joe Kennedy.
Tom Bragg kannte ich nur dem Namen nach. Ben Smith dagegen kannte ich und begegnete ihm meistens an jedem Geschäftstag auf der Börse. Den von Bosten kommenden Joe Kennedy lernte ich kurz bei einer demokratischen Versammlung kennen. Er wurde als ein politisch sehr wichtiger Mann beschrieben, sehr aktiv im Bostoner Bezirk, geschmeidig, aber ein sehr harter Politiker. Ich nehme an, daß sich Louis Howe und Roosevelt ein wenig über ihn geärgert hatten, weil er nur zögernd in ihren politischen Kreis getreten war. Im Laufe der Zeit sagte Louis mir jedoch, daß er sich sehr freigebig gezeigt hätte. Vielleicht hatte er für diese Verzögerung seinen guten Grund. Man muß einmal folgendes bedenken: Wenn die allmächtige europäisch-amerikanische Geldmacht-Gruppe die Zeit für reif hielt, die Preisstruktur der Effekten hier und dort niederzureißen, um einen tatsächlich lohnenden Gewinn zu erzielen oder besser eine richtige „Schur” vorzunehmen und damit zugleich Präsident Hoover auszulöschen, dann würden sie es nicht wagen, einen Rothschild, Sasoon, War-
176
burg, Sieff, Morgan, Montefiore, Schiff oder einen Whitney auszuwählen, um die notwendigen „Scheren” anzusetzen. Diese gerade nicht sehr delikate Aufgabe mußte von ganz anderen Leuten gehandhabt werden, d. h. durch neutrale und trotzdem zuverlässige Menschen. Diese auf breiter Front ausgeführte Effekten-Operation in Baisse konnte wohl nicht besser durchgeführt werden, als indem man einige „passende” angriffslustige Irländer herbeipfiff, die dann mit Hilfe anderer die Schur des Publikums durchzuführen hatten.
Sei es, wie es sei, die Operation wurde mit rücksichtsloser Raffinesse und Energie durchgeführt. Die Zerstörung war ungeheuer. Ben Smith hatte ein künstliches Auge. Infolge dieser unglücklichen körperlichen Benachteiligung hatte ich, wenn ich ihn ansah, das Gefühl, daß er mich garnicht ansah. Während dieser dunklen Monate sah ich Ben häufig, wie er seine Spießgesellen - etwa zehn Makler - wie zufällig zusammenrief, um dann einige Minuten vor Schluß dem sich schwer erholenden Markt einen schweren Schlag durch große Verkaufsorders in verschiedenen Schlüsselaktien durch die ganze Börse hin zu versetzen. Infolge dieses Manövers erbrachte der Marktschluß ein schwaches Bild, das sich im ganzen Lande auswirkte.
Das diente natürlich nicht zum Aufbau. Ben war auch nicht gerade beliebt. Baisse-Spekulation ist an und für sich nichts Unrechtes, vorausgesetzt, daß keine räuberischen Taktiken angewandt werden. Meiner Ansicht nach waren Bens Taktiken nicht weit davon entfernt. Bis jetzt hatte ich noch nicht gelernt, daß der größte und schnellste Nutzen den mächtigen Bankiers und Kreditschiebern dann zufließt, wenn sie gerade vor dem von ihnen zu schaffenden Zusammenbruch verkaufen, um das Vertrauen in der ganzen finanziellen Welt zu erschüttern, besonders durch Krieg und Paniken aller Art. Es dürfte wichtig sein, hierüber einmal nachzudenken. Tom Bragg und Joe Kennedy
177
sollen ihre Operationen mit Hilfe verschiedener großer Funkhäuser durchgeführt haben. Diese hatten sie zu ihrer Niederlassung gewählt, um so den Eindruck zu erwecken, als ob die Verkauforders aus dem ganzen Lande kämen. Ben Smith sah ich dagegen ganz in der Nähe operieren. Von den drei eben erwähnten gut bekannten Baisse-Spekulanten soll Joe Kennedy der wichtigste, mächtigste und erfolgreichste gewesen sein. Wären das seine Methoden wirklich gewesen, hätte er sich unersetzbar, aber auch offensichtlich durch wichtige, sehr wichtige Welt-Finanzmächte politisch kontrollierbar gemacht. Hatten die Welt-Finanzmächte Joe Kennedy vielleicht sorgfältig ausgesucht, um auf Baisse spekulieren zu können?
Als Kennedy später Botschafter in London war und seine berühmte Bemerkung machte, daß Amerika „nur über seine Leiche” in den Zweiten Weltkrieg schliddern würde, wurde er sofort von seinem Posten in London abberufen und nach Florida abgeschoben, um sich dort eine Zeitlang abkühlen und wieder die „richtige” politische Weltanschauung zulegen zu können. Und so ging er nach Florida. Doch durch wen und warum wurde er umerzogen? Seine in London betonte Ansicht, sich aus dem Krieg herauszuhalten, war gesund. Wenn man auf dieses historische Urteil zurückblickt, um zu versuchen, diese Frage zu beantworten, so besteht wohl kein Zweifel, daß die Welt-Finanzmächte in New York, London und Paris, die selbst streng an die Goldwährung gebunden waren, in erster Linie den Zweiten Weltkrieg dazu zu nutzen wünschten, Hitlers schnellwachsendes Tauschhandels-System für den Welthandel abzudrosseln, um so auf breiter Grundlage den ausgedehnten Goldhandel zu beeinträchtigen. So kam der rechtzeitig geplante Schritt jener Gruppe, die Horden Stalins durch ein großes Kriegsziel quer durch Mitteleuropa zu entthronen, um so den stückweisen Zerfall unserer westlichen Kultur und Zivilisation, wie wir sie ken-
178
nen, zu fördern, zu jener Zeit für sie erst an zweiter Stelle. Ich frage mich jedoch, ob es wirklich notwendig war, daß so viele Amerikaner und Männer anderer Nationen ihr Leben lassen mußten, um dieses niederträchtige Ergebnis zu erzielen?
Fraglos befand sich der Botschafter Kennedy in einer üblen Zwickmühle dadurch, daß er dem lang vorbereiteten Plan der Finanzmächte durch seine aufrichtige, patriotische Äußerung im Interesse des amerikanischen Volkes Widerstand geleistet hat. Sein Herz und seine Lippen waren sicher auf dem rechten Fleck, aber seine Hand wurde gezwungen, sich den selbstsüchtigen Wünschen der Weltfinanzmächte zu beugen, die mit dem Sitz in New York direkte Verbindungen zu Downing Street 10 und zum Weißen Haus hatten.
Um noch einmal auf das Wallstreet-Thema zu kommen: Zeitweise verließ ich die Börse und machte gelegentlich lange Fahrten durch das Land zusammen mit Alph Beane aus New York und Charlie Fenner aus New Orleans, um die verschiedenen Büros von Fenner sowie Beane & Ungerleider zu besuchen. Unsere Firma hatte damals über fünfzig Niederlassungen. Wir fuhren für gewöhnlich von New York City nach Washington in Richtung Süden, wobei wir viele Plätze besuchten, zuerst den Piedmont-Bezirk, dann Atlanta, Tulsa, Oklahoma City, Dallas, Fort Worth, Houston, New Orleans und zurück. Es war eine anstrengende Fahrt. Sie ging einem nach den vielen Gesellschaften, den großen Essen, Stammtischen, Frühstücken und was sonst noch da war, stark auf den Magen. Trotzdem war es ganz interessant, zumal da Vetter Alph und Charlie angenehme Reisegefährten waren. Letzterer hatte besonderes Verständnis für meine dauernd angespannte Gemütsverfassung, unter der ich litt, da ich immer versuchte, Roosevelt und seiner Umgebung gegenüber gerecht zu sein und doch seiner experimentellen politischen Weltanschau-
179
ung in jener Zeit kritisch und bewußt gegenüberzustehen. Bei einer Fahrt nach Atlanta traf ich Bobby Jones im Mountain-Lakes-Club. Bobby war ein feiner Kerl. Für die Kunden unserer Firma wurde an einem Sonnabend ein großes Essen gegeben. Nach dem Essen schlug ich vor, Tennis zu spielen, da wir unbedingt Bewegung brauchten. Jones meinte, er würde nachkommen. „Gut”, sagte ich, „ich will eine Wette mit dir abschließen, Bob.”
„Worum geht die Wette?” fragte er.
„Ich will dich zu einem Golfspiel mit achtzehn Löchern auffordern für fünfhundert Dollar, vorausgesetzt, alle Löcher werden getroffen.” Da die Unterhaltung plötzlich stoppte, wartete ich. In seiner ruhigen Art lachte er mich an: „Gut, ist das alles?”
„Nein”, erwiderte ich, „das ist noch lange nicht alles, wenn du bereit bist, mit mir Tennis zu spielen, aus drei Sätzen die beiden besten für fünfhundert Dollar!” Ein brüllendes Gelächter war die Folge. Später kam er auf den Tennisplatz, knipste ein Bild von uns, trug aber nicht seinen berühmten Golfschläger „Calamity Jane”, sondern einen Tennisschläger.
In Dallas mußte ich mir alles über Earl Hulseys langweilige Hahnenkämpfe anhören, in Fort Worth Amon Carters abgestandenen Witz über das berühmte Schinkenbrot, das er auf einer Geschäftsreise nach Dallas mit sich nahm, so daß er in Dallas nicht einen Groschen auszugeben brauchte.
Die Sammlung der Remington-Gemälde und Bronzen im Fort Worth Club war einfach großartig.
Eines Tages erhielt ich bei einem kurzen Besuch in Victoria Texas, obwohl meine Vorfahren, die Austins, die erste angelsächsische Kolonie, später die Lone Star State gegründet hatten, das gewohnte, herzliche „Willkommen” für Süd-Texas, und ich überlebte es. Einer der dortigen großen Farmbesitzer, Jim Waelder, bot mir eine Wette an,
180
daß sein Maulteir die Fähigkeit besäße, Wachteln aufzustöbern. Ich hörte ziemlich ungläubig zu und hatte dabei das Gefühl, daß ich, da ich von New York kam, mächtig auf den „Arm genommen würde”. Es ging um zehn Dollar, und so zogen wir am nächsten Morgen los, um auf seiner Ranch Wachteln zu schießen; es war später Herbst und so waren sie frei. Wir waren zu mehreren, dazu kam natürlich das von einem sehr netten Jungen gerittene Maultier.
Ich nahm die ganze Wette nicht ernst, da ich das Gefühl hatte, daß Jim mich zum besten hatte. Das Land war ganz trocken und in der flachen, sich weit hinziehenden Prärie standen Gruppen kleiner Büsche mit roten Blättern, einige von Geißblatt-Ranken umwunden. Diese waren so breit wie ein großes Zimmer, manchmal noch breiter. Jim sagte: „Nun, Curtis, die Wette gilt. Bist du bereit?” „Klar, fangen wir an”, sagte ich. Jim winkte dem Reiter, mit seinem Maultier anzureiten, und wir folgten. Ich dachte, von allen dummen Streichen, ist dieser der dümmste. Nach ungefähr hundert Metern näherten wir uns der ersten Buschgruppe. Jim wies mich an, auf der einen Seite zu gehen, und er ging auf der anderen. Wir gingen weiter, aber nichts geschah. Das Maultier trottete immer weiter und ich dachte bei mir selbst, jetzt habe ich Jim gefangen. Er griente auch. Das Maultier ging weiter vor uns, und wir kamen an die nächste Gruppe von kleinen Büschen. Da, genau am Rand der Gruppe, machte das Maultier plötzlich halt, spitzte seine beiden Ohren und drei Wachteln gingen plötzlich hoch, zwei davon schössen wir. Eine ganze Zeitlang sagte ich nichts zu Jim. Jim winkte mit der Mütze. Von der Straße her, ungefähr eine halbe Meile rechter Hand, hörten wir das Hupen der Autos unserer Freunde, die den Spaß und die Jagd genossen. Ich bezahlte die zehn Dollar und sagte: „Du hast gewonnen!”
181
Wenn das Wetter in Süd-Texas trocken gewesen ist, scheint es, als ob die plötzlich gestörten Wachteln ein leichtes Rascheln verursachen, sobald sie durch die Ranken und durch das niedrige Buschwerk Zuflucht suchen. Das hatte das Maultier gehört und spitzte daher seine Ohren. Dies war der „springende Punkt”. Es war ganz ehrlich zugegangen. Jims Freunde freuten sich alle, als sie hörten, wie der aus dem Osten Gekommene bei der Maultierwette auf die Schippe genommen worden war.
*
Nach einigen Jahren verließ ich diese große Firma und nahm mir eine kleine Wohnung am Broadway, um an besonderen Fragen zu arbeiten, aber auch um mich von der unangenehmen Spannung Wallstreet gegen Washington zu erholen.
Auf einer Anfang 1940 unternommenen Reise nach Nashville in Tennessee geriet ich zwecks einer möglichen Verschmelzung einiger Phosphat-Betriebe an ein Projekt, das mich sehr interessierte. Einige Freunde machten mir klar, wie vorteilhaft es sein würde, Erdgas von Texas nach Nashville zu leiten, dazu in den ganzen Appalachian-Bezirk. Erdgas dient als Ergänzung für die Kohle und ist ein sehr sauberer Brennstoff. Da Nashville von einer Art vulkanischer Bergkämme umgeben ist, war es, besonders im Winter, infolge des Kohlendunstes sehr schmutzig.
Victor Johnson aus Chicago war ein sehr überzeugter Vertreter dieser Idee. Zur rechten Zeit kam er zu mir nach New York, und ich erklärte mich bereit, eine Erdgasleitung-Gesellschaft zu gründen und das Risiko der Führung und Entwicklung dieses Projektes auf mich zu nehmen. Das bedeutete sehr viel Arbeit.
Am 1. April 1940 gründete ich die Tennessee-Gas and Transmission Co., Inc. in Nashville, Tennessee. Das klingt wie ein Aprilscherz, es wurde aber keiner. Tatsächlich
182
wurden viele Leute daran reich. Heute ist sie eine Milliarden-Dollar-Gesellschaft, eine der besten, deren Aktien an der New Yorker Aktienbörse gehandelt werden. Ich habe es immer bedauert, daß ich, als die ersten Aktien auf den Markt kamen, nicht mehr dazu gehörte.
Es handelte sich anfänglich um eine recht große Gesellschaft, die dazu bestimmt war, Erdgas von Südwest-Louisiana und von Ost-Texas nach dem Appalachian-Gebiet zu leiten. Die Eisenbahnaktionäre in Tennessee erhoben Widerspruch, ebenfalls tat es der mächtige J-H.-Hillman-Konzern in Pittsburgh wie auch John L. Lewis und die Vereinigte Bergwerksgewerkschaft, außerdem noch die Standard Oil Company New Jersey. Außer diesen Gruppen hatte ich keine weiteren Gegner.
Um auf jeden Fall zu verhindern, daß meine mächtigen Gegner mein Projekt durch einen Gerichtsbeschluß in Nashville sofort unterbinden würden, flog ich eines Nachts schnell nach Washington, um mir bei der neu eingerichteten Federal Power Comission im öffentlichen Interesse und aus Gründen der Notwendigkeit ein Beglaubigungsschreiben ausstellen zu lassen. Am nächsten Tag flog ich nach Nashville zurück.
Beim Gerichtshof in Nashville kam ich gerade zur rechten Zeit an, um dabei zu sein, wie Fourney Johnson aus Birmingham, einer der größten Anwälte des Südens und Vertreter der Southern Natural Gas Company, ein von der Federal Power Commission an seinen Klienten gerichtetes Telegramm erhielt, daß sie in bezug auf „Tennessee Gas” die oberste Gerichtsbarkeit im Staate Tennessee übernommen hätte. Das offene Telegramm hin und her schwenkend, ging Johnson ruhig zum Fenster und schaute eine Zeitlang schweigend hinaus. So überlebten wir mit Mühe und Not, bereit, eine neue Runde in unserm Kampf zu starten und die lange Erdgasleitung vom Südwesten her zu bauen.
Frühjahr 1942 wurde ich durch verschiedene Regierungs-
183
ämter infolge der von ihnen verursachten Verzögerungen erneut verärgert, bevor wir überhaupt anfangen konnten. Ich erwartete keinerlei Vergünstigungen, lehnte aber auch bestimmt die Ansicht so mancher ab, die glaubten, daß, wenn man mit einem wie mir als dem früheren Schwiegersohn Roosevelts Geschäfte machte, ein möglicher politischer Widerhall demjenigen gegenüber entstehen könnte, der sich in Regierungsdiensten befand. Es entstand daher ein beträchtliches Durcheinander. Außerdem kostete uns die Verzögerung Geld, was wir sowieso nicht hatten. Überdies war es besonders schwer, Geld für ein neues Unternehmen zu bekommen, das dazu noch in dem Ruf stand, Spekulation zu sein.
Anfang März 1942 entschloß ich mich dann, einen Brief an Roosevelt zu schreiben und ihn auf meine unglückliche Lage aufmerksam zu machen. Seine in wohltönenden Phrasen abgefaßte Antwort vom 11. März 1942 erfolgte natürlich im Hinblick auf einen Zeitungsbericht. Ich „zeigte” sie, und wir kamen wieder einen Schritt weiter.
Einen weiteren Tritt in die Seite erhielten wir durch einen intervenierenden Antrag seitens einer Tochtergesellschaft der Standard Oil Company, der Hope Natural Gas Co., als Widersacher unserer beabsichtigten Erdgasleitung bei der FPC. Darauf ging ich zu meinem Freunde Nelson Rockefeller. Ihm war kürzlich von der Regierung die Stellung eines „Coordinator für Latein-Amerika” angetragen worden, ein dicker Posten in Washington. Freundlicherweise setzte er eine Unterredung mit mir fest, die auf etwa folgende Weise vor sich ging: „Nelson”, begann ich, „ich habe die Absicht, eine Erdgasleitung von Texas bis in diesen östlichen Bezirk zu legen, aber eine Tochtergesellschaft einer Ihrer großen Ölgesellschaften, die Hope Natural Gas, macht mir große Schwierigkeiten.”
„Curt”, erwiderte der, „was kann ich schon machen. Ich bin aus dem Ölgeschäft raus und in Regierungsdiensten.”
184
„Ich weiß, Nelson”, sagte ich, „daß Sie überhaupt nichts mehr mit dem Ölgeschäft zu tun haben, aber können Sie nicht irgendjemanden bei der Hope Natural anrufen und vorschlagen, daß wir beide für die Dauer des Krieges zusammenarbeiten und danach jeder seinen eigenen Weg geht. Sicher ist Ihre Standard Oil-Gruppe sehr groß und wir sind klein, aber beide wollen wir doch dem öffentlichen Interesse dienen, schließlich kämpfen wir doch beide in diesem Krieg als Amerikaner. Ich bin jetzt an das Pentagon gebunden. Meine rechte Hand in unserer Gesellschaft (ich meinte damit den Vizepräsidenten Harry Tower) ist körperlich behindert.”
Nelson sah mich nachdenklich an und sagte: „Mit wem hast du denn bei Hope Natural zu tun?”
„Ein Herr Tonkin ist dort Präsident!” sagte ich.
„Schön, Curt”, sagte er, „ich schlage vor, du schickst ihm ein Telegramm, um eine Zusammenkunft zu vereinbaren, die dem Zwecke dient, wichtiges Kriegsmaterial zu erhalten und dann mußt du dich mit ihm unterhalten, wie du deine Interessen einordnen kannst, bis der Krieg vorbei ist.”
Ich bedankte mich und sagte: „Vielen Dank für deinen Rat und deine Mitarbeit”, womit ich ihn verließ. Ich ging von dort direkt zum Willard Hotel und setzte ein höfliches Telegramm an Tonkin auf, in dem ich ihm eine Zusammenkunft in Washington vorschlug oder an einem sonst ihm passenden Ort, um unsere jeweiligen Gesellschaftsinteressen für die Dauer des Krieges abzustimmen und um somit wichtiges Kriegsmaterial zu erhalten.
Am nächsten Tag erhielt ich aus Washington ein völlig abweisendes Telegramm von Tonkin, dahin lautend, daß er an einer Zusammenkunft mit mir überhaupt nicht interessiert sei, auch nicht im Hinblick auf Kriegsmaterial. Diese Nachricht enttäuschte mich tief; unser Gesellschaftskapital war langsam im Schwinden, denn die Kosten für Inge-
185
nieure, Anwälte, Hotelspesen, Mieten und verschiedene andere Dinge waren beträchtlich, und dieser Neuausstattung stand kein Einkommen gegenüber.
Der Inhalt dieses Telegramms erschien mir so hochfahrend und so anmaßend, daß ich beschloß, Kopien davon machen zu lassen, und zwar besonders im Hinblick auf weiteres Kriegsmaterial. Als ich Nelson einen Dankesbrief schrieb, fügte ich eine Fotokopie von Tonkins enttäuschender Antwort bei. Ebenfalls schickte ich Kopien an das Sekretariat der F. P. für unsere Akte dort und eine an das War Production Board. Das brachte die Sache ins Rollen. Kurz darauf machte unsere Gesellschaft noch einen weiteren Schritt vorwärts. Jener Herr, der mir dieses unverschämte Telegramm geschickt hatte, wurde bald darauf abgeschoben.
An einem Sonntagnachmittag, kurz nach meiner Unterredung mit Nelson, ging ich vom Pentagon zum Hotel Willard. Sonntag war der einzige Tag, an dem ich es einrichten konnte, an einer Gesellschaftskonferenz teilzunehmen. Mehrere von uns warteten auf Victor Johnson, unserm größten Aktionär. Sein Zimmer im Hotel Willard lag auf dem zweiten Flur genau über dem von Harry Tower. Schließlich wurden wir unruhig, gingen zu Victors Zimmer und klopften. Niemand antwortete. Wir riefen das Zimmermädchen, das die Tür aufschloß, da lag Victor tot in seinem Bett.
Offenbar hatte er in der Nacht einen Herzschlag bekommen. Wir haben es nie genau erfahren. Jedenfalls war es für seine Familie in Chicago wie auch für uns sehr traurig. Wir hatten eine wichtige Gesellschafterversammlung vorgesehen, um einem Finanzgeschäft zuzustimmen, das uns von einer Chicagoer Korporation angeboten worden war. Damit wollte sie die Finanzierung der Erdgasleitung übernehmen. Wir hatten gerade die „Bedingungen bekommen, unter denen die PFC zustimmen würde”, falls wir mit
186
ähnlicher finanzieller Beteiligung für die ersten geschätzten Kosten der Leitung aufkommen konnten, etwa fünfzig bis sechzig Millionen Dollar.
Infolge des plötzlichen Todes von Victor Johnson sowie meiner Anwesenheit in Uniform wollten die Bankiers mit meiner Gruppe sehr rücksichtslos vorgehen. Wir waren ihnen aber gewachsen zugunsten einer neuen machtvollen Leitung. Das Projekt machte Fortschritte. Innerhalb eines Jahres wurde die Erdgasleitung gebaut, und unser neuer Präsident, der gleichzeitig die Banken vertrat, Gardiner Symonds, hat ein erstklassiges Geschäft durch die Gründung einer sehr guten Gesellschaft aufgebaut und gleichzeitig klugerweise seine Tätigkeit auf mehrere angeschlossene Gesellschaften ausgedehnt.
Nachdem ich nun dieses wichtige und sich erfolgreich entwickelnde Projekt in größere und stärkere Hände gelegt hatte, widmete ich mich weiterhin den dringenden Angelegenheiten der Luftwaffe im Pentagon. Nach Beendigung des Krieges verbrachte ich mit meiner Familie etliche interessante Monate in Baltimore. 1946 fuhren wir dann nach San Antonio in Texas.
Als wir den Osten verließen, um nach Texas zu fahren, sagte ich „Auf Wiedersehen” zu Wallstreet, meinen vielen Freunden dort, den Veteranen der guten und schlechten Tage mit Sonne und Sturm, und so wird es wohl immer sein!
187
Achtzehntes Kapitel
Der „Pfennig-Baum”
In der rücksichtsvollen, auf gesetzlicher Grundlage freundschaftlich geregelten Abmachung mit Roosevelts persönlichem Anwalt Harry Hooker hinsichtlich Roosevelts, Annas und meiner Person im Frühjahr 1933 sowie aufgrund meiner ihm gegenüber geäußerten Gefühle im Hydepark wurde mir das Recht zugestanden, Sisty und Buz bei passender Gelegenheit, besonders aber in den Ferien und im Sommer, bei mir zu haben. Die Eltern meines guten Freundes Willis Wilmot in New Orleans besaßen eine kleine und malerische Insel im Plum Lake im nördlichen Wisconsin, die sogenannte Wilmot-Insel. Seit vielen Jahren fuhren Herr und Frau Wilmot während des Juli und August von dem schwülen New Orleans nach dem kühlen Wisconsin, begleitet von ihren drei Kindern Maud, Dorothy und Willis. 1933 wurde Dorothy Frau William Seward Allen, New York, und Gattin eines sehr bekannten Staatsanwaltes. Liebenswürdigerweise hatten sie mich mit Sisty, Buz und der treuen Katy, ihrem Kindermädchen, im Juli 1933 eingeladen, sie in Plum Lake zu besuchen. Hinter allen von uns lag eine schwere Zeit, Plum Lake war ein ganz ruhiger entzückender Platz mit allen Möglichkeiten zum Fischen, Schwimmen, Kanufahren, vor allem aber mochten Herr und Frau Wilmot sowie Willis uns alle drei, Sisty, Buz und mich. Frau Wilmot war eine ruhige, sehr liebenswürdige Dame; Wilmot selbst, schon in vorgeschrittenen Jahren, machte einen recht lebendigen Eindruck. Vor allem hatte er einen köstlichen Sinn für Humor.
188
So nahm ich ihre Einladung mit großem Vergnügen an, zumal da Anna die Absicht hatte, noch eine Zeitlang in Nevada zu bleiben; Katy sollte mir in der Zwischenzeit mit den beiden Kindern helfen.
Im Hinblick auf das Protokoll und auf das ermüdende dauernde Leben in der Öffentlichkeit bat ich mit Rücksicht auf Sisty, Buz und auf das ganze Theater im Weißen Haus um die Erlaubnis, mich von einem Mitglied des FBI während meines Besuchs der nördlichen Wisconsin-Wälder begleiten zu lassen.
So fuhr ich denn an einem Julitag nach Washington und besuchte den Leiter der FBI, den großen Amerikaner J. Edgar Hoover. Ich erhielt von ihm die Erlaubnis, eine Waffe zu tragen, und traf seinen Agenten Charles Reich, einen feinen Kerl, mit dem ich bald Freundschaft, schloß. Ich dankte Hoover für seine freundliche Beihilfe und fuhr mit Charlie, Katy und den beiden Kindern mit der Bahn nach Chicago, um dort Willis zu treffen und dann in der Nacht nach Plum Lake zu fahren.
Wilmot-Insel, etwa 400 Hektar groß, war von ziemlich unregelmäßiger Form. Der Boden stieg allmählich an bis zu einer Höhe von ungefähr fünfundvierzig Fuß über dem Wasserspiegel. Man konnte das Eiland natürlich nur mit einem Boot erreichen und mußte über eine nur sechzig Fuß lange Hafenanlage klettern, bis man auf einem sich dahinwindenden Pfad zu einer großen Hütte gelangte, den zahlreiche schlanke Fichten säumten. Die größte davon beschrieb uns Wilmot zur besonderen Freude der Kinder als „Pfennigbaum”. Nach seiner Erzählung sollten von dem „Pfennigbaum” in Sommernächten, vor allem im Juli, etliche runde Blüten auf den Weg fallen. Wenn dann junge scharfe Augen vor Sonnenaufgang tüchtig suchten, würden sie vielleicht einige dieser „Blüten” finden. Man nannte sie Pfennige. Buz’ Augen wurden nach dieser Erzählung immer größer. Auch Sisty schien sehr beein-
189
druckt, sie kicherte, nicht so ganz von der Wirklichkeit dieses ungewöhnlichen Gebarens seitens des Pfennigbaums überzeugt.
Trotzdem rasten jeden Morgen vor dem Frühstück Buz und Sisty zum Pfennigbaum, ob sie Pfennige finden würden, und meistens fanden sie sie. An manchem Morgen kamen sie mit drei oder vier Pfennigen zum Frühstück. Und einmal hatten sie sogar sieben Pfennige. Aus einer verborgenen Ecke der Hütte ließ sich Wilmot auch nicht die geringste Kleinigkeit dieses Schauspiels entgehen und genoß aus vollem Herzen die Magie des Pfennigbaums.
Als wir eines Abends nach dem Essen über die Ereignisse des Tages sprachen - die Kinder waren längst im Bett - und Wilmot in seinem bequemen Stuhl im Wohnzimmer saß, lachte er immer vor sich hin. Willis und ich schauten ihn fragend an. Er lehnte sich dann nach vorn und sagte: „Curt, Sisty und Buz haben heute morgen nur zwei Pfennige gefunden und ich hörte, wie sie hier an der Hausecke Buz ins Ohr flüsterte: ,Buz, ich glaube, der alte Mann ist pleite.'”
Wilmot verfügte über einen köstlichen Humor. Eines Tages zerlegte er für die vielen Gäste, die rund um den langen Tisch zu einem herrlichen Mahl versammelt waren, eine Ente. Irgendwie rutschte das Messer ab und die in einer schlüpfrigen Sauce liegende Ente machte sich selbständig und schlidderte auf den Tisch. Alle waren vor Aufregung überrascht und schrien durcheinander. In aller Ruhe überblickte Wilmot die Tafelrunde und die Ente und sagte dann in seiner typisch trockenen Art: „Recht und schlecht habe ich mich mit der Ente geschlagen, aber dann hat sie mich doch untergekriegt.”
Manchmal pflegten Charlie Reich und ich bis an das äußerste Ende der Insel zu gehen, um uns im Pistolenschießen auf Blechkanister zu üben, die auf fünf Fuß hohen Stöcken befestigt waren. Obwohl mein Sportkamerad
190
zu den von Onkel Sam bevorzugten luchsäugigen FBI-Männern gehörte, schnitt ich gar nicht so schlecht ab. Sicher hätte ich Charlie geschlagen, wenn wir mit einer Schrotflinte auf fliegende Vögel geschossen hätten.
Manchmal nahm ich auch die beiden Kinder auf Bootsfahrten mit über den See, wobei wir häufig fischten. Jeden Tag gingen wir zum Schwimmen in den Hafenanlagen, wobei ich auf die beiden Knirpse scharf aufpaßte, denn das Schwimmen im See birgt Gefahren in sich.
Nachdem wir mehrere Wochen auf dieser abgeschlossenen, glücklichen Insel mit lieben Menschen verbracht hatten, wurde es für uns wieder Zeit, nach dem Osten zurückzukehren. So verließen wir denn an einem Nachmittag die Wilmot-Insel, wobei wir allen, die zum Hafen gekommen waren, ein letztes Lebewohl zuwinkten.
Nach der Ankunft in Chicago am nächsten Morgen manövrierte ich uns so geschickt durch die Menge, daß wir den an der Eisenbahnsperre wartenden Fotoreportern unbemerkt entschlüpften. Am nächsten Tag waren wir wieder im Osten. Die herrlichen Ferien in Plum Lake waren für mich vorüber.
Herr und Frau Wilmot sind schon lange tot. Willis und ich aber treffen uns, so oft es nur möglich ist. Jedoch möchte ich zu gern wissen, ob jene stattliche, schlanke Fichte auch jetzt noch so majestätisch auf der Insel im Plum Lake steht. Ich hoffe es und hoffe auch, daß im Herzen dieses Baumes die Erinnerung an zwei kleine Kinder bleibt, die am Fuße des Stammes auf den Knien nach ihren seltenen „Blüten” suchten, die in den Julinächten abfielen. Das war vor dreiunddreißig Jahren. Ich weiß, daß in den Herzen vieler Menschen die Erinnerung an Robert Wilmot und seinen „Pfennigbaum” am Plum Lake weiterleben und niemals vergessen werden wird.
191
Neunzehntes Kapitel
Das Finale
Jenes kleine, bereits von mir erwähnte Ereignis - die Pendergast-Missouri-Delegation bei der Tagung in Chicago und meine damals an den Tag gelegte freche laienhafte Einstellung zugunsten Roosevelts - hatte ihm große Freude bereitet. Gelegentlich hatte ich dies gegenüber Louis Howe erwähnt, der sah mich jedoch ganz erschrocken an und tat dabei, als ob er überhaupt nichts verstanden hätte. In Wirklichkeit hatte er es jedoch gut verstanden. Man hatte eigentlich schon immer erwartet, daß zwischen Louis Howe und Basil O’Conner Spannungen entstehen würden; beide Männer standen Roosevelt sehr nahe.
Letzterer war sein engster Rechtsbeistand in der Firma Roosevelt & O’Conner, und Louis Howe war sein engster politischer Berater. Wie ihre Herkunft im Grunde genommen ganz verschieden war, so waren es auch ihre diesbezüglichen Ziele. Sie standen daher immer in einem freundschaftlichen Wettstreit im Dienste Roosevelts. Manchmal geriet ich in eine Unterhaltung hinein, die diese Fragen behandelte. In der Regel gab es nach dem Essen eine Unterhaltung zu dreien zwischen Mama, Louis und mir. Beide wußten, daß ich Basil, sein Spitzname war „Doc”, leiden mochte. Wir hatten oft zusammen gegessen. Bei diesen Unterhaltungen geriet ich immer in die Lage, Doc verteidigen zu müssen. Das ärgerte jedoch Louis offensichtlich und bis zu einem gewissen Grade auch meine frühere Schwiegermutter. Im Laufe der Zeit hatte ich bei diesen Unterredungen das Gefühl, daß Louis und Mama
192
darauf hinauswollten, „Doc” los zu werden, und zwar lag besonders Louis daran, ihn auszubooten. Angesichts dieser Taktiken hätte ich im Hinblick auf die später auf mich zukommenden Dinge auf der Hut sein sollen.
Nach Louis’ Dafürhalten und auch nach seinen Äußerungen mir gegenüber war „Doc” in gewisser Weise „gefährlich” geworden und auch viel zu gesellig, wobei er mir vorsichtig zu verstehen gab, daß Docs Treue zu Roosevelt vielleicht „ins Wanken geraten könne”.
„Unsinn, Louis”, gab ich schnell zurück, „Doc ist gegenüber Pa genau so treu, wie du es bist!” Das paßte Louis natürlich gar nicht, aber er schwieg.
Immerhin beschloß ich, diesem hinterlistigen Spiel, wenn irgend möglich, ein Ende zu bereiten. Als ich kurz darauf vor dem Essen mit Roosevelt ins Gespräch kam und wir alleine in seinem Schlafzimmer waren, erwähnte ich die Verschwörung, die gegen Doc angezettelt worden war und sagte zum Schluß: „Meiner Ansicht nach, Vater, ist Doc dir gegenüber genau so treu wie Louis, und dieses .Sticheln’ ihm gegenüber sollte aufhören. Ich finde es nicht ganz anständig.” Ziemlich überrascht, erwiderte er: „Ich danke dir für deine Information und Aufrichtigkeit, Curt. Ich werde damit Schluß machen.” Er tat es auch.
Weihnachten 1932 verbrachten wir mit Granny in Hydepark. Ein großer Weihnachtsbaum schmückte das Zimmer und, um das Klavier herum stehend, sangen wir Weihnachtslieder. Alle waren voll festlicher Stimmung. Vor der Einführung, vom Wahltag bis zum 4. März 1933, ereignete sich allerlei. Viele Besucher kamen und gingen nach Hydepark und nach New York. Die damals mir ganz unbekannte inoffizielle Verwaltungsabteilung für Planung arbeitete von früh bis spät, um die „neue” Gesetzgebung für den Kongreß vorzubereiten. Herr „Herbert” war als Gouverneur nach Albany gegangen. Vergebens hatte sich Präsident Hoover an Roosevelt und seine Berater zwecks
193
einer „Zusammenarbeit” bei der Stützung der schwankenden Banken gewandt.
Im häuslichen Kreise gewann ich die Zuneigung von Roosevelt dadurch, daß ich eine Familienangelegenheit in Verbindung mit einer bevorstehenden Scheidung delikat behandelte. Wallstreet wies Anzeichen neuen Lebens auf. Es schien, als ob wieder bessere Tage für unser Land kommen würden. Bis zum 4. März hatten viele Menschen an der Vorbereitung und Ausarbeitung der Rede gearbeitet, die der Präsident an seinem Einführungstage halten sollte. Noch fünf Minuten, bevor diese Rede endlich an die riesige, am Hügel des Capitols versammelte Menge Volkes gehalten werden sollte, wurde immer noch an ihrer Vorbereitung gearbeitet. Allerdings war sie nicht wie das großartige demokratische Programm von 1932 eine Verpflichtung, was sie hätte sein müssen, sondern nur eine politische Botschaft mit dem Ziel, den Wählern zu schmeicheln. Nachdem die in Schlüsselstellung befindlichen Kabinettsmitglieder und andere in hohen Posten stehende Beamte dem neuen Präsidenten „vorgeschlagen” und kurz bestätigt worden waren, spielten sich die weiteren Dinge ganz geruhsam ab. Das demokratische Programm wurde zweckmäßigerweise vergessen. Ein jeder, auch ich, kann seine Stellung in unserer Gesellschaft sehr leicht verlieren. Viele bedeutende Bürger der Vereinigten Staaten sind auf diese Weise behandelt worden, wenn sie bei der Untersuchung wichtiger Situationen ihre „eigenmächtigen” oder gegensätzlichen Meinungen zum Ausdruck brachten und sich dabei um eine konstruktive Aktion bemühten. Wie könnte man sich auch etwas Ungehörigeres vorstellen, als wenn ein Amerikaner zugeben müßte, daß seine Gedanken und Beobachtungen von Schattenfiguren zensiert werden könnten, ohne daß ihm das Gesetz zu Hilfe käme! Gleichwohl werden sie manipuliert und sorgfältig zensiert.
194
Die Freiheit der Presse, für deren Erhaltung unsere Vorfahren kämpften und bluteten, ist nur noch ein Mythos! Wessen Freiheit? Wessen Presse? Nun, die Zeit ist längst gekommen, daß unser gesamter Nachrichtenapparat einer Verbesserung, Überholung und Kritik unterzogen wird. Als das New-Deal-Programm steckenzubleiben begann, kam Adolf Hitler. Die Weltfinanz stärkte ihm anfänglich den Rücken, erfreut durch Pearl Harbour und Churchills berühmte Äußerung „Nun sitzen wir alle im gleichen Boot”, womit er seine vollste Zufriedenheit ob dieses geplanten zufälligen Ereignisses zum Ausdruck brachte. Nun schaltete sie in zuvorkommender Weise um und gab nunmehr uns den notwendigen Rückhalt.
Nach Louis Howes Tode wurde Harry Hopkins, ein Fürsorger, aus einer dunklen Ecke ans Tageslicht geholt und abgestaubt, um ihn zu ersetzen. In vieler Hinsicht gelang es ihm, in mancher nicht. Mit seiner ständigen Demut gegenüber den Einweltlern übertraf er sogar noch die Anstrengungen und den Einfluß von Louis auf der internationalen Bühne, was natürlich nur mit Hilfe der Gattin des Präsidenten und der „Leitung” des Weißen Hauses gelang.
Gegenüber „Gästen”, besonders solchen, die nicht auf der offiziellen Besucherliste des Weißen Hauses standen, konnte der Präsident nicht widerstehen. Zu den bevorzugten „Beratern” und prominenten Persönlichkeiten gehörten Bernard Baruch, Felix Frankfurter, Henry Morgenthau jr., General George Marshall und andere.
Arbeiterführer, Großmogule des Rates für Auswärtige Angelegenheiten und andere summten wie die Bienen um eine Wabe. Und was das für eine Wabe war: die Macht, Energie und der Reichtum eines großen freundlichen Volkes, der Vereinigten Staaten.
Als die 1933 neu aufgetauchten Lehrmeister ihre Munition verschossen hatten und die Kriegstrommeln in Europa als
195
Folge der mißglückten Pariser Friedenskonferenz von 1919 aufs neue dröhnten, brüteten die Berater schon wieder neue Pläne aus und gaben somit Roosevelt die Möglichkeit, ein neues „Schauspiel” über die Bühne gehen zu lassen. Diese bekannte Technik diente eigentlich nur als Ablenkungsmanöver, um die öffentliche Aufmerksamkeit von dunklen, ungelösten häuslichen Problemen abzulenken.
Die immer laut nach „Frieden” (ein viel mißbrauchtes Wort, das für sechs verschiedene Völker sechs verschiedene Bedeutungen hatte) schreiende Verwaltung suchte immer wieder nach verschiedenen Maßnahmen und konstruierte Pläne, die schließlich unser Land mit Hilfe ihrer friedensliebenden Präsidenten Woodrow Wilson und Franklin Roosevelt in zwei ausländische Kriege stürzte.
Für die Berater jedoch war das alles eine Sache von zur rechten Zeit manipulierten Nachrichten. Das amerikanische Volk konnte daher nicht wissen, daß es auf geschickte Weise preisgegeben und ausgebeutet werden sollte. Ihre manipulierten Nachrichten wiesen immer wieder auf jenen am Himmel auftauchenden politischen Silberstreifen hin: „Der Krieg, um allen Kriegen ein Ende zu bereiten.”
Sicher war der Silberstreifen am Horizont aufgetaucht, aber die dunklen Wolken der Pflichtvergessenheit in Washington überschatteten ihn ganz deutlich. Infolge der verschiedenen Manipulationen einiger führender amerikanischer und britischer Politiker und anderer kam es an einem Dezembermorgen zur „Entladung”. Sie stürzte direkt vom Himmel auf die Köpfe von Tausenden treuen, nichtsahnenden amerikanischen Truppen in Pearl Harbor. Über dreitausendachthundert starben! Welch’ ein Verrat! In meinem Gedächtnis bleibt immer jenes bizarre Bild von General George Marshall haften, der einem Bericht zufolge an jenem fatalen Sonntagmorgen einen Spazierritt in dem sonnigen Virginien machte, sowie an seine anderen
196
Tätigkeiten in Washington. Seine auf umständlichem Wege abgegangene warnende Botschaft war nur eine grausige Geste. Sie diente lediglich dazu, das Gesicht zu wahren, daher sollte sie auch erst nach dem „Überraschungsangriff” ankommen.
Wie viele von diesen viertausendünfhundert amerikanischen Toten und Verletzten hätten erhalten bleiben und welche hohen Schiffsverluste hätten in Pearl Harbour vermieden werden können!
Ich habe mich oft gefragt, ob Roosevelt als Teil eines von langer Hand her vorbereiteten Planes bewußt die Möglichkeit und die Gefahr eines Angriffs auf Pearl Harbour durch die sich nähernde starke japanische Sonderkampfgruppe ignoriert hat. Es war ein von uns herausgeforderter Angriff. Er muß es getan haben! Wenn das aber der Fall ist, dann muß es auch seinem Wunsch entsprochen haben. Wer aber hat ihm diesen Wunsch nahegelegt? Um was für eine Führungsgruppe handelte es sich dabei? Hatte die Machtgier die Psyche und den Charakter dieses Mannes, den ich außerordentlich geschätzt habe, so gewandelt, daß ich ihn nicht wiederzuerkennen vermochte? Konnte das derselbe Mann sein, dessen Arm ich einst bei zahlreichen Gelegenheiten gestützt hatte, um ihn vor einem Sturz zu bewahren? War das derselbe Mann, dessen zahlreiche Hoffnungen und Bestrebungen wir einst geteilt hatten? Das schien ganz zweifelhaft und war tatsächlich unglaublich.
Es ist fraglos eine feine Sache, einen Marineumhang zu tragen und an einem besonderen windoffenen Platz an Bord eines schweren amerikanischen Kreuzers ein schönes Bild für die Illustrierten abzugeben. Aber wie verträgt sich das mit den Verlusten in Pearl Harbour? Mit den Tränen? Mit der Schuld? Mit den verratenen Toten? Wer war es, der Roosevelt erklärt hat, daß ein „Pearl Harbour” notwendig sei? Und hat er sich tatsächlich der
197
Ein-Welt-Herrschaftstheorie gebeugt, weil er auf diese Weise zum Ruhm kommen zu können glaubte? Demgemäß ist es für mich sehr schwer zu begreifen, was damals geschah. Nein, es ist mehr als das. Es ist geradezu unmöglich!
Nach meinem Besuch im Weißen Haus anfangs 1943 habe ich Roosevelt weder gesehen noch gesprochen.
Getreu ihrer Tradition zogen die amerikanischen. Truppen aller Waffengattungen in großartiger Verfassung in den Zweiten Weltkrieg.
Waren der Staat und das Schatzamt dieser Haltung in ihren eigenen Abteilungen ebenbürtig? Wohl kaum.
Dürfte ich wohl den Vorschlag unterbreiten, daß für Harry Hopkins ein Denkmal zu Great Falls in Montana errichtet werde, und weitere Denkmale für Henry Morgenthau jr. und Harry Dexter White in irgendeiner anderen Gegend? Aber wie wäre es dann mit dem Felix Frankfurter-Bataillon, das in Washington D. C. stationiert ist? Hat dieser Verein die Absicht, sein eigenes Denkmal zu errichten? Möglich wäre das schon.
Ohne Zweifel waren die weiten Flüge zu den ausländischen Sitzungen für Roosevelt sehr anstrengend. Sie haben erheblich an seiner Gesundheit gezehrt. Er hätte lieber in seiner eigenen Botschaft bleiben sollen, gleichgültig ob sie von „Wanzen” wimmelte oder nicht. Noch besser wäre es freilich gewesen, er wäre in seinem Heim, im Weißen Haus geblieben. Das wäre für seine Gesundheit wie auch für die Gesundheit aller anderen besser gewesen.
Nach Abschluß der beiden Weltkriege haben unsere beiden Oberbefehlshaber, Präsident Wilson wie Präsident Roosevelt, kurz vor ihrem Tode große Enttäuschungen erlitten.
Ein kurzer Vergleich bestimmter Eigenschaften beider Präsidenten dürfte aufschlußreich sein.
Woodrow Wilson studierte 1879 in Princeton, Roosevelt
198
war ein Vierteljahrhundert später, im Jahre 1904, Student in Harvard.
Vielleicht könnte man in meinen Ausführungen über diese beiden bedeutenden Persönlichkeiten erwarten, daß ich den Mann, der die Princeton-Universität besucht hatte, infolge meiner Treue und Anhänglichkeit für „Alt-Nassau” und für alles das, was es für mich bedeutet hat, begünstigen würde. Das ist aber nicht der Fall. Ich werde meine Beobachtungen darlegen und jeder kann daraus seine eigenen Schlüsse ziehen. Politisch sehe ich in Woodrow Wilson einen Mann, der seine Seele an das Programm der Internationalisten, an die „Ein-Welt-Schuld-Finanz-Macht verkaufte und damit in unsere konstitutionellen und finanziellen „Deiche” die ersten großen Breschen legte. Roosevelt betrachtete ich nach 1932 als einen Mann, der gleichfalls seine politische Seele an dieselbe Einweit, an die internationalen Ein-Welt-Schuld-Finanz-Mächte verkaufte und dann unter ihrem Zwang die von Woodrow Wilson „in den Deich gerissenen Breschen” erweiterte. Fern jeder politischen und ideologischen Prahlerei liegt das nackte Ergebnis klar auf der Hand.
Beide Männer haben es versäumt, eine gesunde Führungsschicht für Amerika zu schaffen. Stattdessen haben sie es lediglich verstanden, sich selbst mit einer gewissen politischen Vorstellung zur Geltung zu bringen und das so mannigfaltige und von Fremden unterstützte außenpolitische Programm zu fördern. Besonders im Hinblick auf Roosevelt machte sich das bemerkbar, als seine Gesundheit nachließ und seine Berater sein Amt übernahmen. Eleanor Roosevelt war in dieser Hinsicht gewiß keine Edith Galt Wilson.
Es handelt sich hier um einen Vergleich zwischen einem Manne, der die ersten Breschen legte, und dem Manne, der nach ihm kam und diese Breschen noch vergrößerte. Noch immer leiden wir unter dem großen Unglück, das diese
199
beiden Männer unserm Lande zugefügt haben, zumal da das direkte Ergebnis, nämlich die Zukunft unseres Landes, heute in keiner Weise sicher und gesund ist. Das „Schauspiel” war im großen und ganzen dasselbe. Die Schauspieler behielten die gleichen führenden Rollen und haben sie auch gespielt. Woodrow Wilson war in einer bescheidenen intellektuellen Umgebung aufgewachsen. Roosevelt dagegen wuchs im Schütze einer wohlhabenden Umgebung auf und hatte sehr viele Möglichkeiten zu gesellschaftlichen Verbindungen. Wilson war egoistisch, eingebildet, ehrgeizig, etwas arrogant und sehr starrköpfig, Roosewelt dagegen äußerst egoistisch, eingebildet, dazu ehrgeizig und manchmal auch etwas arrogant. Es ist bekannt, daß er in seinen jungen Jahren im Sport ein schlechter Verlierer war. Er gehörte zu denen, die einem Gegner mit außerordentlichen Fähigkeiten sehr häufig ihre Abneigung zeigten. In bestimmter Hinsicht war er z. B. kritisch und eifersüchtig gegenüber General Douglas MacArthur, einem Manne, von dem er erkannt hatte, daß er fraglos viel mehr natürliche Fähigkeiten hatte als er selbst und dazu einen hervorragenden Ruf genoß. Vielleicht wußte der General nichts davon, aber ich hoffe, daß er es gewußt hat.
Wilson hatte ursprünglich großen Idealismus und eine Vorliebe für schöne Worte und Phrasen. Er hielt in keiner Weise damit zurück, seine Ideale preiszugeben. Wie man mir erzählt hat, erweckten seine Vorlesungen über Jurisprudenz und internationale Gesetze als führender Professor in Princeton die Begeisterung seiner Hörer. Wilsons Ehrgeiz und Starrsinn brachten ihn hinsichtlich gewisser grundlegender Universitätsmaßnahmen mit Princetons Dekan Andrew West in Konflikt. Er schnitt jedoch schlecht dabei ab. Mit finanzieller Hilfe mehrerer gut bekannter Studenten in Princeton, einem New Yorker Zeitungsherausgeber und einigen anderen stieg er in die
200
politische Arena und wurde Gouverneur des Staates New Jersey. Er scheint dann bereit gewesen zu sein, alles zu sagen oder auch beinahe alles zu tun, um seinen nagenden politischen Ehrgeiz zu befriedigen. Bis kurz vor seinem Tode dachte er nur an dessen Folgen.
Es muß hier noch erwähnt werden, daß, als Woodrow Wilson Gouverneur von New Jersey wurde, der Bruder eines guten Freundes von mir, der 1895 in Princeton gewesen war, Wilsons engster Berater und sozusagen seine rechte Hand wurde. Er war der anerkannte Dekan der Gesellschaft der gesetzgebenden Berichtersatter in New Jersey und vertrat die Newark News. Er hieß James F. Dale. Jim Dale war ein begeisterter Anhänger von Princeton. In seinem Leben hat er nur zwei Fußballspiele zwischen Yale und Princeton verpaßt, und das auch nur, weil er damals gerade in der Armee war, um seinem Vaterlande zu dienen.
Aus zuverlässiger Quelle wußte man, daß Woodrow Wilson niemals seine Unterschrift unter ein wichtiges Staatsdokument in Trenton setzte, wenn nicht auf der linken unteren Ecke die Buchstaben „J. D.” standen; denn Jim war als tüchtiger Mann bekannt und genoß das Vertrauen aller höherer Beamten.
Als Jim Dale starb, erschienen in den östlichen Zeitungen ehrenvolle Nachrufe. Ich zitiere hier die Newark News v. 29. Jan. 1945 über James F. Dale (S. 18): „ … Er war für die News im State House seit 1904 (41 Jahre) ,Staatskorrespondent’.. . unter Wilson studierte er in Princeton Jurisprudenz und internationales Gesetz … er entzweite sich mit Wilson .. . anfangs ein großer Bewunderer von Wilson, wandte Dale sich später gegen ihn, als Letzterer 1911 Gouverneur wurde. Als Dale das Executive Office bekleidete, klagte er darüber, daß Wilson die meisten seiner Regierungsvorschriften, die er in Princeton gelehrt hatte, selbst durchbrach (v. Verf. hervorgehoben).
201
Diese kurzen Sätze sind bedeutungsvoll, denn sie zeigen, was für einen ungeheuren Preis Wilson zu zahlen bereit war, um seinen politischen Ehrgeiz zu befriedigen. Dies machte ihn verletzbar.
Als Gouverneur Wilson Präsident der Vereinigten Staaten wurde, forderte er Jim Dale auf, mit ihm als sein Privatsekretär nach Washington zu gehen. Jim lehnte dieses schmeichelhafte Angebot ab. Es gelang jedoch Jim Dale, für diesen Posten einen ändern Mann zu gewinnen, und zwar Joe Tumulty, auch aus New Jersey. Tumulty wurde die wichtige Stellung eines Privatsekretärs beim Präsidenten angeboten, die er prompt annahm.
Ein anderer früherer Bewunderer von Präsident Wilson, der sich später mit ihm entzweite, war Oberst George Harvey, Herausgeber von Harpers Weekly. Ich zitiere hier: „Oberst George Harvey war einer der ersten, der die Kandidatur Woodrow Wilsons für die Präsidentschaft förderte. Dann entzweite er sich mit Wilson und wurde sein bitterster Feind.”
Das, was Wilson in seinen Vorlesungen in Princeton idealistisch dargelegt hatte, wurde bald, als er das hohe öffentliche Amt antrat, beiseitegeschoben und durch einen politischen Opportunismus ersetzt.
1912 war das Hauptquartier der Demokratischen Partei in New York City, in der südlichen 5ten Avenue. Ein guter Freund von mir, damals ein junger Mann, verbrachte viel Zeit im Hauptquartier als eine Art Bote. Er war der Sohn einer gut bekannten New Yorker Familie jüdischer Abstammung und erzählte mir die folgende interessante Geschichte, die sich direkt vor seinen Augen abgespielt hatte. An einem Sonnabendmorgen im Sommer 1912 kam Bernard Baruch in das demokratische Hauptquartier mit Wilson im Schlepp. „Er führte ihn, wie man einen Pudel an der Leine führt.” Wilson machte dabei ein sehr feierliches Gesicht und trug einen dunklen Anzug, da er gerade
202
in New York von Trenton angekommen war. Wie mein Freund mir erzählte, erhielt Wilson seinen besonderen politischen „Umschulungskursus” von mehreren der dort versammelten hohen Berater. Der Kursus bestand hauptsächlich darin, ihm in großen Zügen die Anordnungen zu geben, denen er im Prinzip zuzustimmen hatte.
- Der vorgesehenen Gesetzgebung über die Federal Reserve Bank durch den Kongreß seine Hilfe und Unterstützung angedeihen zu lassen, sobald Paul Warburg zu dem endgültigen Entwurf des jeweils bearbeiteten Gesetzes die endgültige Zustimmung gegeben hatte.
- Hinsichtlich der Art der zu wählenden Senatoren der Vereinigten Staaten dahin zu wirken, daß in Zukunft die Wahl direkt durch das Volk vorgenommen werden sollte, was zur Folge haben würde, daß die Berufspolitiker eine größere Macht über den Senat hätten.
- Dahingehend zu wirken, die gestaffelte persönliche Einkommensteuer einzuführen, die von England zu uns gekommen ist, um den Gewinn aus unserer eigenen Arbeit abzuführen.
- Falls Krieg in Europa ausbrechen sollte, ein offenes Ohr zu haben und hilfsbereite politische Maßnahmen zu treffen.
- Den von der Diplomatie gegebenen Empfehlungen in bezug auf Besetzung höherer Kabinettsposten ein offenes Ohr zu leihen.
Pflichtgetreu empfing Wilson diese Belehrungen und nahm sie in sich auf, schüttelte allen die Hand und verschwand. Die führenden Persönlichkeiten und ihre Berater gingen darauf „in das Hinterzimmer” des Hauptquartiers, schlössen die Tür und „hielten sich den Bauch vor Lachen”! Einer von ihnen fragte darauf: „Wie macht sich denn unser anderer Kandidat?”
Der andere Kandidat war Theodore Roosevelt, der Bull-Moose-Führer. So erfolgte jene starke Unterstützung des
203
„leitenden Ausschusses” in der Wahl von 1912 für Woodrow Wilson und Theodore Roosevelt, die gegen Präsident Taft kandidierten. Es hatte den Anschein, als ob Präsident Taft nicht sehr zugänglich war und ebenso wenig den politischen Wünschen gewisser prozionistischer Politiker nach einer Verbindung der Vereinigten Staaten mit Rußland zugestimmt hatte.
So wurde die republikanische Abstimmung durch die aufrührerischen „Bull Moose” gespalten und der Demokrat Woodrow Wilson gewann. Mit großem Interesse las ich in Felix Frankfurters Erinnerungen (S. 54) seine Bemerkungen über die Wahl von 1912. Er schrieb: „Ich… unterstützte aufrichtig Roosevelt” (T. D.). Im Laufe der Zeit sollte dann Frankfurters Onkel, der Richter des Obersten Gerichtshofes, Louis Brandes, in der neuen Wilson-Regierung in Washington eine wichtige Rolle spielen.
Man braucht wohl kaum zu sagen, daß Woodrow Wilson seinen Schulklassen-Idealismus rasch aufgab, um seiner sorgfältigen Unterrichtung entsprechend ein wohlerzogener politischer Schüler zu werden. Im Laufe der Zeit sprach er tatsächlich nur noch im Sinne seiner Ratgeber.
Um hier einen vergleichenden Blick auf Roosevelt zu werfen, so scheint es, daß er weniger idealistisch als Wilson war, aber politischer dachte. Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre wurde er von vielen Leuten beraten. Vor allem von Bernard Baruch, Felix Frankfurter, Louis Howe, Jim Farley, Herbert Lehman, seiner Frau, Sam Rosenman und anderen.
Er wurde aber auch von seiner Mutter „beraten”, die einen viel gesünderen Menschenverstand hatte. Er hätte lieber bei vielen Gelegenheiten auf sie hören sollen, dann wäre es uns allen auch besser gegangen. Diese stille Bemerkung mache ich angesichts der starken, sich selbst dienenden Kritik einiger linksgerichteter Schreiber an Roosevelts Mutter „Granny”, die niemals von Mama veran-
204
laßt wurden, ihre entstellenden Pamphlete zu unterlassen. Diese Art politischer Schreiberei ist durch und durch unfair und hätte sofort unterdrückt werden müssen. Aber es geschah nichts.
Am 7. März 1905 reiste Präsident Theodore Roosevelt von Washington nach New York City, um einen wichtigen politischen Vortrag zu halten, der am Frühnachmittag beendet war; danach folgte ein anderes wichtiges Ereignis, diesmal allerdings gesellschaftlicher Art. Relativ war das in politischer Hinsicht nicht so wichtig wie seine Rede. Vom historischen Standpunkt aus gesehen, übertraf jedoch das gesellschaftliche Ereignis alles andere.
In dem geschmückten Haus von Herrn und Frau Henry Parish in der East 76ten Street, New York, stand zwischen vielen Blumen eine schüchterne, attraktive, junge Braut. Es war Eleanor Hall Roosevelt von Long Island New York, und neben ihr stand ihr schöner, junger Bräutigam vom Hyde Park, New York. Es war Franklin Delano Roosevelt. Zu diesem glücklichen Ereignis der Hochzeit waren viele Gäste eingeladen worden … fraglos viele Gäste der besten Gesellschaft von Old New York und Hudson River Valley. Es war ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis. Der Präsident von Amerika hatte seine Nichte Eleanor verheiratet, wobei der übliche Empfang für Braut und Bräutigam in dem Hause von Parish stattfinden sollte; aber zufällig kam alles ganz anders. Unglücklicherweise hatten die meisten Hochzeitsgäste zuallererst den dringenden Wunsch, die Hand des vornehmen Gastes aus Washington, Präsident Theodore Roosevelt, zu schütteln und dann erst das wartende Brautpaar zu begrüßen.
Die Neuvermählten standen abseits, sahen einander an und warteten. Vielleicht hatten in jenem kurzen Augenblick des Wartens, der ihnen wie Stunden vorgekommen sein mag, die Werte des Lebens mit seinem Blühen und
205
Gedeihen einen tiefen Eindruck auf das junge Brautpaar gemacht. Es war sicher ihr Nachmittag, und doch war er irgendwie durch einen gewissen „Onkel Ted” aus Washington gestohlen worden. Nach einer gewissen Zeit jedoch lief alles wieder normal, und die Gesellschaft im Hause Parish dachte wieder an Eleanor und Franklin Roosevelt. Der Empfang fand weiter statt. Dieses so äußerst glückliche Ereignis verlief dann wie geplant.
Fünfundzwanzig Jahre später sagte Mama zu mir: „Sowohl Franklin wie auch ich hatten das Gefühl, daß wir damals ganz zufällig in die Politik geraten waren und daß Onkel Ted ganz unabsichtlich die erste Geige spielte.” Trotzdem bleibt der Eindruck bestehen und ich glaube auch fest daran, daß Braut und Bräutigam es sich feierlich gelobten … eines Tages werden wir die erste Geige spielen. Das ging auch in Erfüllung.
Die Saat jenes St. Patrikstages in New York trug ihre Früchte. Der ständige Ehrgeiz, nach oben zu kommen, hatte seinen „Einsetzungstag” am 17. März 1905, also lange vor dem 4. März 1933.
Ein angehender Staatsmann muß ja in erster Linie über einen brennenden Ehrgeiz verfügen. Er muß aber auch die Fähigkeit besitzen, auf bestimmte Einflüsse, ja sogar auf Repressalien bis zu Fügsamkeit zu reagieren, denn gerade sie sind in den Händen höchster Ratgeber ein bequemes und notwendiges Werkzeug für den Notfall.
Sicherlich erfüllte Franklin Roosevelt wie auch Woodrow Wilson brennender Ehrgeiz. Bei Wilson kam noch hinzu, daß er manchmal etwas abseitsging und auf Liebespfaden wandelte. Auf dem Gebiete der Rechtswissenschaft spielt so etwas keine Rolle. In der politischen Arena dagegen dürfte es für einen angehenden Staatsmann ebenso verhängnis- wie bedeutungsvoll sein, weil er dadurch viel leichter beeinflußbar wird.
Es ist allgemein bekannt, daß eines Abends die Trenton-
206
New-Jersey-Feuerwehr plötzlich gerufen wurde, um dem höchsten Beamten des Staates mit einer langen Leiter von der obersten Etage hinunter bis zu einem Seitengang durch die Hintertür eines Privathauses, gerade gegenüber dem Kapitol, sicheres Geleit zu geben. Sicherlich war das für den höchsten Beamten eine Gelegenheit, die Tüchtigkeit der betreffenden Zivil-Abteilung der Regierung zu prüfen. Vermutlich hat der Bericht über diesen ordnungsgemäß ausgeführten Dienst ein warmes Lob des Gouverneurs ausgelöst. Wenigstens hätte es so sein müssen! Im Falle Woodrow Wilsons war es ein politischer Faktor, über den nicht berichtet wurde.
Einige Monate später las ich ein interessantes Buch: When the Cheering Stopped by Gene Smith, New York, 1964. Es weist darauf hin, wie notwendig es ist, daß das amerikanische Volk vor dem geschäftsführenden Ausschuß unserer Regierung genügend geschützt wird, falls der oberste Beamte plötzlich sehr krank oder aktionsunfähig wird. Das Buch wirft einen interessanten Lichtblick auf die zweite Ehe des Präsidenten Wilson mit Frau Edith Galt und ihre aufopfernde Hingabe während dieser Jahre und berichtet auch darüber, wie sie eine Zeitlang regierte, als er krank wurde. Als ich die Seiten 20 bis 23 las, wurde ich besonders gefesselt von den allgemein bekannten „Peck-Briefen”. Es handelt sich hier um die zahlreichen Briefe von Woodrow Wilson an Frau Mary Allen Peck (später Hulbert). Nach der Scheidung nahm Frau Hulbert wieder den Namen Peck an. Ich muß sagen, daß ich gefühlsmäßig nicht ganz mit den Bemerkungen über die Peck-Briefe übereinstimme. Wie mir die Geschichte erzählt worden ist, dreht sie sich nicht um Frau Galt und Frau Peck. Mir zeigt sie vielmehr, wie Louis Brandeis von Wilson zum Obersten Gerichtshof gekommen ist. Sie dreht sich also um Louis Brandeis, nicht um die Frauen, und zeigt die Politik, wie sie wirklich ist.
207
Vor 1915 (S. 23) sprach man von Woodrow Wilson häufig „als Pecks ungezogenen Jungen” und ebenso über alles andere, was die „Witzblätter” glaubten, über ihn sagen zu müssen. Schon in Princeton erhielt er diesen Spitznamen. Angeblich war Frau Pecks Sohn in Washington in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Er brauchte etwa dreißig-tausend Dollar, um seine Schulden zu bezahlen, aber Frau Peck hatte diese Summe nicht zur Hand. Sie soll Samuel Untermeyer, einen mächtigen New Yorker Rechtsanwalt, beauftragt haben, sie zu vertreten, um das Geld für ihren Sohn zu bekommen.
Die ganze Angelegenheit soll folgendermaßen vor sich gegangen sein: Untermeyer traf eine Verabredung mit dem Weißen Haus, wo er dann Präsident Wilson besuchte und ihm die Sache seines Klienten unterbreitete. Er erklärte ihm, dieser benötige Geld, und zwar zweihundertfünfzigtausend Dollar. Dafür würde sie dann gewisse Briefe an Präsident Wilson zurückgeben, sonst müßte sie die Briefe anderweitig verwenden.
Präsident Wilson: „So viel habe ich nicht, Herr Untermeyer. Lassen Sie mir eine Woche Zeit, um zu überlegen, was ich tun kann.” Bei der nächsten Zusammenkunft fuhr Wilson fort: „Ich kann keine zweihundertfünfzigtausend Dollar aufbringen, Herr Untermeyer. Aber ich könnte Ihnen vielleicht hunderttausend Dollar geben. Würde das Ihren Klienten befriedigen?”
Untermeyer: „Nein, Herr Präsident, das würde meinen Klienten nicht befriedigen. Aber ich habe einen ganz ändern Vorschlag, der vielleicht zu einer glücklichen Lösung führen könnte. Wenn Sie mir zusagen, in Betracht ziehen zu wollen, Louis Brandeis an den Obersten Gerichtshof zu berufen, bin ich bereit, diese unglückliche Briefangelegenheit mit meinen Freunden zu besprechen. Es könnte dann möglich sein, daß die ganze Angelegenheit zum Wohle aller Parteien niedergeschlagen wird.” Präsident Wilson
208
überlegte sich die Sache und ebenso der Rechtsanwalt und seine Freunde. In kurzer Zeit saß Louis Brandeis auf dem Sitz beim Obersten Gerichtshof.
Die Peck-Angelegenheit war im politischen Washington bald vergessen. Der Richter Brandeis machte sich ausgezeichnet beim Gerichtshof, so daß er sehr bald als ein sehr befähigter Richter galt.
In der prozionistischen Weltbewegung erwies er sich als eine sehr wichtige und aggressive Persönlichkeit, wobei er gerade in dieser Hinsicht sowohl hier wie im Ausland keine Mühe scheute.
Wie allgemein bekannt ist, erlitt Roosevelt in seinen besten Jahren eine schwere Kinderlähmung, wodurch seine Beine verkrüppelt wurden. Mit großem persönlichen Mut meisterte er jedoch dieses schwere Hindernis und verfolgte gleichwohl sein politisches Ziel, das hohe Amt eines Präsidenten zu übernehmen. Seine Krankheit machte ihn jedoch nicht gefügiger, obwohl er bei wichtigen politischen Angelegenheiten dazu gezwungen war. Sie machte ihn bedeutend zugänglicher.
Roosevelt wie Wilson hatten großen persönlichen Ehrgeiz. Beide wurden regelrecht ausgenutzt.
Es erübrigt sich, zu betonen, daß es an uns liegt, diese Arbeit zu übernehmen und den Schaden zu beheben, um die gähnenden Löcher in unseren finanziellen und politischen Deichen zu stopfen, um damit wenigstens eine Zeitlang sicher zu gehen, daß eine derartig abscheuliche Mißwirtschaft, wie sie 1913 begonnen hatte, sich nicht wiederholt. Das ist unsere Arbeit, wenn wir den Willen haben, unsere Nation am Leben zu erhalten. Man könnte es fast für angebracht halten, den verborgenen Kräften der New Yorker Geldmacht zu gratulieren, jenen Leuten also, die mit soviel Erfolg Wilsons und Roosevelts Lehrmeister gewesen sind, nicht zu übersehen den mit ihnen engstens zusammenarbeitenden und ihnen ergebenen ersten Mann,
209
Dwight Eisenhower, der stets ihre internationalen Ziele gefördert hat. Jenen Mächten, denen alles dank ihres scharfsinnigen politischen Urteilsvermögens wie reife Früchte in den Schoß fiel, und zwar zusammen mit vielen Milliarden Dollar Gewinn. Diesen hatten sie behende mit ihrem Vierergespann entlang der politischen Heerstraße eingeheimst, was dann gleichsam zufällig mit dem Verschwinden des größten Teils der Goldreserven in Fort Knox zusammentraf. Und diese fortgesetzte Ausplünderung der Präsidentengruppe ist es, die auf unseren Niedergang hindeutet.
Ein Wort der Anerkennung muß aber auch dem so glatt funktionierenden Council on Foreign Relations (CFR) mit ihrer Tochtergesellschaft in London, The Royal Institute of International Affairs, ausgesprochen werden. In Wahrheit sind sie die beiden „Goldenen Zwillinge”. Woodrow Wilson erbaute diese Bühne, Roosevelt wurde ihr Hauptdarsteller und später bezahlte Eisenhower angeblich für ein neues Schauspiel großzügig im voraus die Bühnenarbeiter. Wir können nur hoffen, daß das nächste Schauspiel für das amerikanische Volk nicht derartig kostspielig sein wird.
*
Der schwierigste Teil dieses Buches ist für mich die angemessene Wiedergabe meiner Gefühle im Hinblick auf meinen früheren Schwiegervater und seine Gattin Eleanor Roosevelt nach 1933.
Als am 12. April 1945 die erschreckenden Schlagzeilen in den Zeitungen den plötzlichen Tod Franklin Roosevelts in Warm Springs bekanntgaben, traf mich dieses Ereignis ganz unerwartet. Diese traurige Nachricht erschien mir wie das letzte Kapitel einer Tragödie ohne Ende. Mag es manche Menschen gegeben haben, denen diese Nachricht nicht überraschend kam, ich selbst wurde vollständig über-
210
rascht. Ich glaubte, was die Zeitungen schrieben. Später wurden verschiedene Bücher darüber herausgegeben und im halbvertraulichen Tone ausführlich darüber diskutiert. Die Berichte über Roosevelts Tod fielen verschieden aus. Für mich war das ganze Thema so traurig, daß ich gar nicht daran zu denken wünschte.
Kurz nachdem wir nach San Antonio übersiedelt waren, saßen wir an einem Sonnabendabend in einem ländlichen Club. Es war eine vergnügte Gesellschaft. Im ganzen waren es vierzehn Damen und Herren, die in festlicher Stimmung um den Tisch herum saßen. An meiner rechten Seite saß eine attraktive Dame, deren Gatte ein prominenter Anwalt in San Antonio war. Wir waren mit beiden befreundet. Die Cocktailstunde war beendet und die Suppe wurde serviert. Ich hatte meine Suppe schon halb zu mir genommen, als plötzlich die Dame zu meiner Rechten ein erschreckendes Gesprächsthema auftischte: „Ich nehme an, daß Sie Warm Springs kennen?” Beiläufig antwortete ich, daß ich nur einmal dort gewesen sei und zwar noch, bevor Roosevelt „The Springs” gekauft hatte. Ich fuhr dann fort: „Er war damals als Gast dort und ging täglich zum Schwimmen.” Eine zweite „Salve” in meiner Richtung folgte: „Ich nehme an, Sie wissen, was zuletzt mit Roosevelt dort geschah?” Diesmal erwiderte ich ziemlich abweisend: „Nein, ich weiß nichts. Ich habe nur Verschiedenes darüber gelesen!” Dann wandte ich meine Aufmerksamkeit wieder dem Essen zu, um als Ablenkungsmanöver ein Brötchen mit Butter zu bestreichen. „Oh, wie äußerst merkwürdig!” Darauf begann sie, mir über dieses erschütternde Ereignis einige angebliche Einzelheiten zu erzählen, während ich vergebens auf meiner linken Seite nach Erlösung suchte. Aber unglücklicherweise war jene Dame in Unterhaltung mit ihrem Herrn von links vertieft. Die Geschichte über Warm Springs traf mich wie ein Donnerschlag. Ich fühlte mich wirklich schlecht und fragte rund-
211
heraus: „Woher wissen Sie das und wer hat Ihnen das alles erzählt?”
Sie antwortete in einem gleichfalls bestimmten Ton: »Mein Vetter, Frank Allcorn, war damals Bürgermeister in Warm Springs; er hat mir das erzählt!” Ich legte meinen Löffel endgültig hin und wollte den Tisch verlassen. Dann aber entschloß ich mich doch, daß es besser wäre, sitzen zu bleiben. Für mich war das Essen zu Ende. Was ich damals hörte, war, daß gerade in jener Zeit Henry Morgenthau jr. dort in Warm Springs gewesen sei. Was für ein merkwürdiger Zufall! Ich fragte mich, wer mit ihm zusammen im Wagen war, als er Warm Springs verließ. Wie ich hörte, war Roosevelts Leiche nach Macon in Georgia gebracht worden, um dort eingeäschert zu werden. Die beinah leere Urne reiste dann nach Norden.
Kein Wunder, daß jener unfreundliche und rauhe Realist, Joe Stalin, mit Nachdruck in der Presse feststellte: „Der Tote bekam kein Staatsbegräbnis!” Nachträglich las ich einen Bericht von Doc O’Connor sowie von ändern Schriftstellern. Vieles hörte sich wie „bestellt” an, als wollte man eine besondere politische Wirkung erzielen. In mir blieb dabei eine innere Leere zurück und ich war ganz erschüttert. Von den drei Vermögensverwaltern, die im Interesse von Sara Delano Roosevelt arbeiteten, bin ich der einzige Überlebende. Die meisten, die zu Roosevelts engerem Kreis im Weißen Haus gehörten, sozusagen „seine Umgebung” waren, sind alle wohlsituiert ihre eigenen Wege gegangen oder gestorben. Was mich anbelangt, so habe ich niemals den Gedanken gehabt, daß man mich „versorgen würde”! An meinem Rockaufschlag hat niemals für meine Treue und Anhänglichkeit ein Preiszettel gehangen. Das war selbstverständlich. Aber andere waren es, die die mit den hohen Ämtern verbundenen Pfründen und Gewinne gesucht haben, nicht ich! Meine Familie ist hier seit 1700, eine lange Zeit.
212
Bis 1932 führte die Franklin-Roosevelt-Familie das Leben einer normalen prominenten amerikanischen Familie. Nach 1932 jedoch trat die „Macht” in Gestalt unbarmherziger Gesandter der Geldmächte auf. Seitdem veränderte sich Roosevelt allmählich in seinem Wesen. Bis zu jenem Zeitpunkt aber hatte sich die Persönlichkeit von Roosevelt noch nicht allzu offensichtlich gewandelt. Mir schien es jedoch, als würden die alten bekannten Charakterzüge allmählich durch neue ersetzt. Nach Grannys Tode änderten sich auch langsam meine früheren Gefühle für ihn. Als ich die gewandelte Persönlichkeit und auch die seiner Gattin durchschaute, begann ich mich ihnen gegenüber reservierter und kühler zu verhalten, was mich mit Trauer erfüllte. Diese Gefühle waren mit tiefer Besorgnis gemischt, und das wachsende Empfinden, daß im Weißen Haus nicht alles gesund und in Ordnung war, fing mich immer mehr. Unser Land mußte sich also in Gefahr befinden.
Ich greife nochmals zu einem Zitat: „Ist ein Mensch mit Macht vollständig ausgestattet, so wird er unverbesserlich und muß seinen vorgeschriebenen Weg gehen. Sein Mund spricht von Tugend und Barmherzigkeit. Das Volk hört zu und glaubt ihm. Wenn aber die Zeiten, seine Umgebung und sein eigenes Wesen sich ändern, dann fällt er in die ihm eigene Verhaltensweise zurück” (Hervorhebg. v. Verf.). Diese Gefühle entwickelten sich bei mir nicht über Nacht, sondern kamen allmählich, zum großen Teil durch folgendes verursacht: Die starke Betonung des Internationalen in unserer Außenpolitik, d. h. das Kriechen vor Joe Stalin, während er gleichzeitig auf Kosten des Christentums und der steuerzahlenden Bürger der Staaten unterstützt wurde, die rechtzeitig organisierte, weitreichende politische Maschinerie, die in Washington auf Veranlassung des als Premierminister am Hofe in Baruchistan fungierenden Felix Frankfurter sich zusammengefunden hatte; die Betrügereien mit dem Gold und das US-Platten-
213
geschäft von Henry Morgenthau jr. und Harry Dexter White, die auf „Befehl” gehandelt hatten; der Aufbau der nach Revolution riechenden NAACP, die schlau geplant war, Rassenfolgen zu verdrehen, um bürgerliche Unruhen zu stiften mit dem Ergebnis, unsere Bürger zu entzweien und Gewalttätigkeiten zu entfesseln; weiter der Betrug, der mit der Gesundheit Roosevelts getrieben wurde und endlich Pearl Harbour.
Diese vom und über das Weiße Haus kommenden Ereignisse konnte ich nur schwer verstehen. Doch bald verschwand meine Verwirrung und ich erkannte klar das Programm, das dem ahnungslosen, geradezu kindlichen amerikanischen Volke aufgebürdet war.
Es ist über jeden Zweifel erhaben, daß unsere Führungskräfte für das Wohlergehen jener Menschen verantwortlich sind, die ihnen ein Führungsmandat anvertraut haben, nicht aber ein Verführungsmandat, mit dessen Hilfe sie das öffentliche Vertrauen mißbrauchen. Bedauerlicherweise hat Roosevelt dieses Vertrauen zu leicht genommen und verletzt, und zwar nur, um seinen persönlichen politischen Ehrgeiz zu befriedigen.
Es mag vorkommen, daß man in einem Einzelfalle schlecht beraten wird, aber nicht, wenn es sich um ein Programm handelt! Das ist ganz etwas anderes. Hierdurch entwickelte sich bei mir Roosevelt und seiner Gattin gegenüber ein Gefühl der Abneigung, also zwei Menschen gegenüber, die ich einst sehr hochschätzte und liebte, so daß sie jetzt beide für mich nicht mehr vorhanden, ja schon lange tot waren, als die Nachricht von ihrem Hinscheiden in der Presse erschien.
Ich bin fest davon überzeugt, daß Franklin Roosevelts Mutter, Sara Delano Roosevelt, in den letzten Jahren vor ihrem Tode nicht mit der Richtung, die die politischen Ereignisse in Washington genommen hatten, einverstanden war. Ich weiß ferner bestimmt, daß es auch sein Vetter
214
Henry Parish in New York nicht war. Erklärte er doch einmal: „Franklin wird mißbraucht.”
Für Roosevelt schien es in der Tat kein Zurück mehr zu geben. Als würde er mehr und mehr zu einem „Sklaven”, während seine Gattin sich in aller Öffentlichkeit bis zum Schluß am internationalen Schauspiel beteiligte. Sie war sehr aktiv am Programm des Außenpolitischen Rates für die Vereinten Nationen beteiligt, ebenso an der Entwicklung der NAACP, deren hauptsächliches Ziel es war, nicht etwa den treuen farbigen Bürger zu fördern, sondern den Einwelt-Internationalisten dadurch zu helfen, daß die Neger ausgebeutet und häufig nur als Werkzeug mißbraucht wurden, um den Boden für das geplante Einwelt-Programm vorzubereiten. Ebenfalls hatte diese Gruppe die Geldkontrolle in unterentwickelten Ländern und für andere Zwecke in der Hand.
Offensichtlich ließ Roosevelt zum Schluß in Warm Springs Gewissenbisse und Unruhe über die Art erkennen, wie Stalin ihn „gerupft” hatte. Man kann solche Gefühle verstehen, aber sie kamen ein wenig zu spät, denn zu dieser Zeit hatten Stalin und seine Helfershelfer in unserm Lande den ganzen „Saft” aus Roosevelts präsidentialer „Apfelsine” ausgequetscht. Für uns blieb nur noch das „Fruchtfleisch” übrig. Merkwürdigerweise hatte auch Woodrow Wilson ähnliche Gewissensbisse, als er sein Ende herannahen fühlte. Zuletzt sagte er: „Ich bin ein sehr unglücklicher Mensch … unbewußt habe ich mein Vaterland betrogen.” Er entzweite sich mit Oberst House, der sich vom öffentlichen Leben zurückzog, wenn er auch hinter den Kulissen für die Geldbarone weiterarbeitete.
Es muß sicher für beide Männer, für Wilson wie für Roosevelt, erschütternd gewesen sein, daß sie, als ihr Leben zu Ende ging und sie der nackten Wahrheit gegenüberstanden, erkennen mußten, daß sie infolge ihres ausgeprägten persönlichen Ehrgeizes und ihres starken Egoismus bei po-
215
litischen Entscheidungen ihr eigenes Vaterland in steigendem Maße geschädigt hatten. Welch ein Preis für politischen Vorrang!
216
Zwanzigstes Kapitel
Zwanzig Jahre später
Mein Gespräch bei Mittagessen mit dem früheren Gouverneur George Earle zwanzig Jahre später war erschütternd, denn was er mir da erzählte, war fast unglaublich. Mein Freund Edward W. Shober aus Philadelphia hatte das Zusammentreffen mit seinem Onkel George Earle veranlaßt. Wir trafen uns im Rittenhouse-Club in Philadelphia, einem der führenden gesellschaftlichen Clubs.
Bei mehreren früheren Gelegenheiten hatte ich mit Ed über vieles gesprochen, was unser Land gegen den Wunsch und Willen der meisten Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg getrieben hatte. Unsere nachherigen Verluste an Menschenleben, Material und Vorräten schienen nur ein Mittel für den im voraus geplanten Sieg der Sowjets gewesen zu sein.
Ebenso hatten wir im einzelnen darüber gesprochen, wie wir durch Wilson mit Hilfe von Bundesrichter Brandeis und anderen geschickt in den Ersten Weltkrieg hineinmanövriert worden waren. Auch in diesem Kriege hatten wir am Schluß nichts anderes als große Menschenverluste und Material zu beklagen.
„Curtis, kennst du meinen Onkel George Earle?” fragte er mich. „Nein, das heißt doch. Ich habe viel von ihm gelesen und gehört, warum?” „Ja”, sagte er, „er könnte dir eine merkwürdige Geschichte erzählen über deinen früheren Schwiegervater Roosevelt und über sich selbst, so daß dir deine Haare zu Berge stehen würden. Er müßte diese Geschichte dir eigentlich selbst erzählen und das amerikanische Volk müßte sie auch wissen.”
217
„Worum handelt es sich denn, Ed?”
„Nun, es handelt sich um ein deutsches Friedensangebot zur Beendigung des Zweiten Weltkriegs, das uns durch die höchsten Autoritäten unterbreitet wurde sowie um andere sehr wertvolle Informationen, die er im Jahre 1943 in Istanbul bekam. Die Sowjets taten damals so, als ob sie unsere Verbündeten wären, aber in Wirklichkeit hatten sie es sehr eilig, sich in Europa als unsere potentiellen Feinde festzusetzen. Sie wurden damals von uns weitgehend durch militärische Hilfe und mit Kriegsmaterial unterstützt. Du wirst dich noch erinnern, daß Präsident Roosevelt meinen Onkel zu seinem persönlichen Marineattaché im neutralen Istanbul ernannte, um sichere Informationen zu bekommen, was eigentlich auf dem Balkan und in Deutschland vor sich ginge. In diesem Sinne arbeitete er aber offenbar viel zu gut, als daß es den Politikern in New York und Washington, die den Krieg wollten, recht war.”
George Earle war einer der ersten „Idealisten”, die das New Deal unterstützten. Er bewunderte Roosevelt und dessen politische Philosophie. Zur rechten Zeit warf er einen fünfstelligen Scheck in den Klingelbeutel der Demokratischen Partei. Natürlich wurde diese Geste seinerseits von dem Finanzkommitee gebührend anerkannt.
Obgleich ich mit vielen von George Earles politischen Ansichten nicht übereinstimmte, war ich doch durch Eds Bemerkungen neugierig geworden und sagte ihm, daß ich seinen Onkel sehr gerne treffen möchte. Er erzählte mir noch, daß Roosevelt und seine Regierung seinen Onkel sehr herumgestoßen hätten, so daß ich noch neugieriger wurde und die Begegnung kaum abwarten konnte. Trotzdem war ich in keiner Weise auf so furchtbare Schläge vorbereitet, wie sie mir George Earles in ruhiger Weise vorgetragene Darstellung zwei Wochen später beim Mittagessen versetzte.
218
Wie ich mir so Eds Onkel am Mittagstisch ansah, hatte ich einen Mann von mittlerer Größe vor mir, dessen ganzes Interesse nur dem Wohl und der Zukunft seines Landes galt. Nach meinem Empfinden war er von keinerlei Ressentiments mehr erfüllt, sondern nur noch von einer tiefen Enttäuschung über die Vereitelung jener Pläne, die im Interesse seines Landes im Zweiten Weltkrieg gemacht worden waren. Weder lokale noch nationale Politik wurden vom Gouverneur erwähnt. Im Hinblick auf die Bedeutung des vorliegenden Themas wären diese auch nur „Kinkerlitzchen” gewesen. Sein wertvoller und rechtzeitig gegebener Rat wurde unverschämterweise ignoriert. Durch die „Palast-Garde” des Weißen Hauses, vielleicht aber sogar durch seinen alten Freund Roosevelt, der ganz unter ihrem Einfluß stand, wurde er behutsam auf ein totes Gleis geschoben. Und George Earle hatte viele Vertrauensposten innegehabt. Daher hatten seine Worte auch Gewicht.
Im Ersten Weltkrieg war er Marineoffizier, kommandierte einen U-Boot-Jäger und wurde seiner Tapferkeit wegen ausgezeichnet; 1933 bis 1934 war er amerikanischer Botschafter in Österreich; 1935 bis 1939 Gouverneur von Pennsylvanien und von 1940 bis 1942 Botschafter in Bulgarien; im Jahre 1942 ging er wieder als Fregattenkapitän in den aktiven Dienst der Marine und war Erster Artillerie-Offizier auf dem Transporter „Hermitage”, der den großen amerikanischen General George S. Patton und seine Truppen nach Nordafrika brachte.
Kurz bevor Roosevelt und Churchill sich 1943 in Casablanca trafen, um die kurzsichtige Politik der „bedingungslosen Kapitulation” Deutschland gegenüber zu verkünden, ernannte Roosevelt den Kapitän Earle zu seinem persönlichen Marineattaché in der Türkei. Roosevelt schickte seinen Freund George Earle dorthin, weil es sich um eine sehr delikate Mission handelte. Bei Beginn unseres Essens erzählte ich dem Gouverneur Earle, daß ich auch in
219
den beiden Weltkriegen in der Marine, Armee und bei der Luftwaffe gedient hätte und daß ich 1956 zu gegebener Zeit in die „Mothball-Brigade” der Luftwaffe versetzt worden wäre.
Ich redete ihn mit „Gouverneur” an, was ihm lieber zu sein schien als „Kapitän”. Der Gouverneur eröffnete das Gespräch, wie es sich für einen Marineartillerie-Offizier gehört, mit einer vollen Breitseite. Er sagte: „Dall, als ich Roosevelts Marineattaché in Istanbul war, erzählte ich ihrem früheren Schwiegervater, wie schnell wir den Zweiten Weltkrieg hätten beenden können, d. h. innerhalb von etwa zwei Jahren. Er wollte jedoch nicht auf mich hören, oder soll ich besser sagen, er durfte nicht auf mich hören. Können Sie sich das vorstellen?” Ich zuckte mit den Wimpern und erwiderte: „Inwiefern, Herr Gouverneur?” „Nun”, sagte er, „haben Sie vielleicht zufällig gelesen, was ich Fowler von den Human Events in Washington erzählt habe, und was er über diese Sache geschrieben hat?”
„Gelesen habe ich es noch nicht”, erwiderte ich, „aber ich habe davon durch einen Freund gehört.”
Der Gouverneur erzählte mir dann in allen Einzelheiten eine erschütternde Geschichte, so daß ich das Essen vor mir auf dem Tisch gänzlich vergaß.
Im Frühjahr 1943 kam er nach Istanbul. Anscheinend wurde der Gouverneur kurze Zeit vorher in einem ganz bekannten Restaurant in Bulgarien mit einigen wichtigen Nazis in einen Krach verwickelt. Die Nazis hatten von dem Orchester im Restaurant verlangt, „Deutschland über alles” zu spielen, was auch geschah. George Earle begegnete dann dieser musikalischen Aufführung dadurch, daß er dem Dirigenten des Orchesters eine brandneue Banknote hinschickte mit der Bitte „Tipperary” zu spielen, was er auch tat. In dem darauf folgenden Handgemenge soll Kapitän Earle mit einer Flasche auf einen der Deutschen eingeschlagen haben. Diese Ereignis hat in der interna-
220
tionalen Öffentlichkeit viel Aufsehen erregt, vor allem aber mit großer Genugtuung in Washington von den dem Weißen Haus nahestehenden politischen Kreisen aufgenommen worden sein. Aus diesem Vorfall entwickelte sich später ein bemerkenswertes Echo in wichtigen Antinazi-Kreisen, das dann in Istanbul seinen Widerhall fand.
Der Gouverneur erzählte mir, daß eines Morgens jemand an seine Hotelzimmertür klopfte. Er öffnete und sah einen breitschultrigen, mittelgroßen Mann in Zivil vor sich, der um ein persönliches Gespräch bat. Er stellte sich als Admiral Canaris vor, Leiter des deutschen Geheimdienstes.
Der Kern dieser Unterhaltung mit Canaris war, daß es viele vernünftige Deutsche gäbe, die ihr Vaterland liebten, aber gegen Adolf Hitler eine Abneigung hätten, weil sie das Gefühl hätten, daß Hitler die deutsche Nation in den Abgrund brächte. Er führte dann weiter aus, daß die kürzlich von Roosevelt und Churchill in Casablanca verkündete „bedingungslose Kapitulation” bei den deutschen Generälen niemals Widerhall finden würde. Sollte allerdings Präsident Roosevelt auch nur andeuten, daß er eine ehrenvolle Übergabe von der deutschen Armee annehmen würde, dann könnte der wirkliche Feind der westlichen Zivilisation, die Sowjets, aufgehalten werden. Die deutsche Armee würde dann gegen die östliche Front marschieren, um den zermalmenden Anprall der durch Roosevelts Pacht- und Leihlieferungen stark gemachten, gut ernährten und bewaffneten Sowjet-Armee gegen den Westen aufzuhalten.
Die Sowjets hätten das Ziel, sich als die führende Macht in Europa festzusetzen, und betrögen, unterstützt durch viele hohe Agenten in den Vereinigten Staaten, das amerikanische Volk.
Der Gouverneur führte aus, daß er zuerst erschrocken gewesen sei, aber dann vorsichtig dem Admiral und seinen überraschenden Vorschlägen gegenüber reagiert habe.
221
Hierauf erfolgte eine Zusammenkunft mit dem deutschen Botschafter Franz von Papen, einem gläubigen Katholiken, der gegen Hitler war.
Eine geheime Zusammenkunft sollte dann mitten in der Nacht an einem einsamen Platz unter Bäumen, fünf oder sechs Meilen außerhalb von Istanbul, stattfinden, wo sich der Gouverneur und der deutsche Botschafter mehrere Stunden lang hätten unterhalten sollen.
Der Gouverneur erzählte mir dann weiter, daß er sehr bald von der Aufrichtigkeit des Angebotes der Antinazi-Deutschen überzeugt worden sei. Als er dann noch weiter über die geheimen Pläne der sowjetrussischen Streitkräfte unterrichtet worden war, schickte er sofort ein Geheimtelegramm auf diplomatischem Wege an Roosevelt in Washington, in dem er Bericht erstattete. Dann wartete er auf die gewünschte Antwort. Doch keine kam! Wie vereinbart, rief ihn Admiral Canaris nach dreißig Tagen telefonisch an und fragte: „Haben Sie irgendwelche Nachrichten?”
Der Gouverneur erwiderte: „Ich warte auf Nachrichten. Habe aber bis jetzt keine.” Der Admiral sagte: „Das tut mir wirklich sehr leid.” Darauf sei Stille gewesen.
Kurz darauf entwickelte sich die Angelegenheit weiter. In einer privaten Unterhaltung in Istanbul hörte dann der Gouverneur von der Gattin des deutschen Botschafters, der Baronin von Papen, einige gegen Hitler gerichtete Bemerkungen. Darauf traf er den Baron Kurt von Lersner, der die Orientgesellschaft, eine deutsche kulturelle Organisation, leitete. Letzterer erzählte Earle, daß er über ihn in der Presse gelesen hätte und auch seine Ansichten über die Nazis kenne, daher hätte er das Gefühl, daß sie über gewisse Dinge derselben Meinung wären. Ein Zusammentreffen der beiden an demselben entlegenen Platz, spät in der Nacht, wurde schnell verabredet. Das Gespräch dauerte mehrere Stunden.
Dort stellte Baron von Lersner dieselbe Frage an Earle. Es
222
handelte sich darum, ob, falls die Antinazi-Kräfte in Deutschland die deutsche Armee an die amerikanischen Streitkräfte ausliefern würden, sie dann mit einer Mitarbeit der Alliierten rechnen könnten, um die Sowjets aus Mitteleuropa herauszuhalten. Von Lersner sagte weiter, wenn Roosevelt einer „ehrenvollen Übergabe” zustimmen würde, würden sie Hitler, falls er von seinen eigenen Leuten nicht vorher umgebracht sein sollte, an die Amerikaner ausliefern. Weiterhin würde die Sowjet-Armee in Schach gehalten und an den Grenzen abgeriegelt werden.
Nochmals erklärte der Gouverneur, er würde ein dringendes verschlüsseltes Telegramm an das Weiße Haus schicken, um Präsident Roosevelt zu bitten, das Angebot der Antinazis zu prüfen. Aber es kam immer noch keine Antwort.
Darauf erfolgte ein zweites Zusammentreffen mit von Lersner, der als neuen Plan vorschlug, Hitlers abgelegenes östliches Hauptquartier zu umzingeln und dann die deutsche Armee an die Ostfront zu schicken, bis ein Waffenstillstand abgeschlossen werden könnte. Gouverneur Earle erzählte, daß er ferner eine äußerst dringende Botschaft vorbereiten und an Präsident Roosevelt in Washington schicken würde, diesmal aber nicht mit der diplomatischen Post, sondern durch die Armee und Marine, um ganz sicher zu gehen, daß diese wichtige Botschaft auch Roosevelt erreichen würde. Er sagte, er hätte das Gefühl, daß Roosevelt und seine Hauptberater unter dem bezaubernden Einfluß von Stalin stünden oder, daß Roosevelt irrtümlicherweise meinte, er könne Stalin „bezaubern”, überdies sei das Weiße Haus wirklich nicht der richtige Ort, die Verhältnisse in Sowjet-Rußland angemessen zu überprüfen und zu enthüllen. Bei dieser aufschreckenden Bemerkung des Gouverneurs zuckte ich wieder mit den Augen und schwieg.
Dann fuhr er fort und sagte, er hätte das sichere Gefühl,
223
daß ein starker „Einfluß” aus dem Weißen Hause den Präsidenten beherrscht hätte, der den festen Willen erkennen lasse, das ganze deutsche Volk auszumerzen, ohne Rücksicht darauf, wie viele amerikanische Soldaten auf dem Schlachtfeld, zur See und in der Luft ihr Leben opfern müßten, nur um dieses abscheuliche Ziel zu erreichen.
In Istanbul waren Pläne ausgearbeitet worden, nach denen der Gouverneur nach der erhofften günstigen Antwort von Roosevelt hinsichtlich einer ehrenvollen Übergabe zu einem geheimen Ort in Deutschland fliegen sollte, um dort von Hitlers Feinden weitere Einzelheiten über die Übergabebedingungen zu bekommen, die dann sofort an das Weiße Haus zwecks weiterer Aktionen geleitet werden sollten. Ein Flugzeug in der Nähe von Istanbul wartete. Es wartete und wartete vergebens.
Als aus Washington auf diese dringenden Botschaften immer noch keine Antwort kam, wurde der Gouverneur immer enttäuschter und immer mehr entmutigt. Endlich kam tatsächlich eine Art Antwort an. Sie besagte, daß er mit dem Oberkommandierenden in Europa Vorschläge für einen auszuhandelnden Frieden ausarbeiten sollte. Hätte man sich ein undurchführbareres oder tragischeres Vorgehen denken können?
Vollkommen erschüttert bemerkte ich, daß es sicherlich für ihn eine herzzerbrechende „Abfuhr” gewesen sein müßte. Ich hatte das bestimmte Gefühl, daß es so gewesen war.
Blitzschnell erinnerte ich mich an General Eisenhowers abwegigen Entschluß, daß unsere amerikanischen Truppen weder Berlin noch Prag einnehmen sollten, obwohl die Bevölkerung in Prag inbrünstig darum gebeten hatte, sich den Amerikanern ergeben zu dürfen. Man behauptet, dieser Entschluß Eisenhowers sei ein offenkundiger Fehler gewesen; das stimmte indessen nicht. Er selbst hat nämlich die Entscheidung getroffen und den Befehl gegeben, den
224
Vormarsch der amerikanischen Truppen aufzuhalten, um die Ankunft der Sowjetarmee abzuwarten, wodurch dieser die Möglichkeit gegeben wurde, als „erste” einzutreffen. Auf diese Weise wurde einer feindlichen Macht ein großer Abschnitt der westlichen Zivilisation in die Hände gegeben. Das Bild, daß man sich von General Eisenhowers Gedankengängen zu jener Zeit machen will, ist, wenn man es so nennen soll, leicht zu erklären. Es ist kein Wunder, daß Stalin seiner Zeit so viel Lob an ihn verschwendete. Diese Erweiterung der Ziele der auf weite Sicht arbeitenden Weltfinanz lag jedoch nicht im Interesse zahlloser guter Amerikaner in Uniform, die ihrem Vaterlande das höchste Opfer brachten.
Nun mußte die westliche Zivilisation jahrzehntelang für diese und auch für andere sorgfältig geplanten „Irrtümer” bezahlen. In Wirklichkeit waren es jedoch keine Irrtümer, sondern sie spiegelten das auf weite Sicht geplante Ziel von Baruchistan wider, das General Eisenhower nur allzu gut bekannt war. Welche Aussichten hatte da noch George Earle, um an Roosevelt heranzukommen?
Ganz benommen saß ich am Mittagstisch und erinnerte mich, daß die Invasion in der Normandie erst ein ganzes Jahr später erfolgte.
Unsere Unterhaltung näherte sich dem Ende. Ich fragte den Gouverneur: „Was geschah dann?”
Er antwortete: „Ich war erschüttert, voller Enttäuschung und fühlte, daß ich nicht mehr von Nutzen sein konnte. Daher ging ich in die Staaten, zurück nach Hause. Der Zweite Weltkrieg nahm weiter seinen geplanten Verlauf, bis die Sowjets sich über Europa ausgebreitet hatten.” Dann fügte er hinzu: „Nach einiger Zeit jedoch entschloß ich mich, meine Ansichten und Beobachtungen über unsere sogenannten Alliierten, die Sowjets, bekanntzugeben, um das amerikanische Volk aufzurütteln. Es sollte erfahren, was in Wirklichkeit geschah.
225
Ich setzte mich mit dem Präsidenten in Verbindung, um ihn über mein Vorhaben zu unterrichten. Er reagierte indessen vollkommen ablehnend und verbot mir streng, meine Ansichten zu veröffentlichen. Als ich dann darum bat, wieder aktiven Dienst in der Marine tun zu dürfen, wurde ich nach dem weit im südlichen Pazifik liegenden Samoa geschickt. Dort würden meine großen Erfahrungen mit den zwiegesichtigen Sowjets und unsere verpaßte Gelegenheit, nutzloses Gemetzel aufzuhalten und den großen Sieg der Sowjets in Europa zu verhindern, keinen Eindruck auf die friedlichen Samoaner machen.”
Ich fand keine passenden Worte der Erwiderung. Es kam mir vor, als ob ich nicht einer New-Deal-politischen Persönlichkeit, einem früheren Gouverneur von Pennsylvanien, gegenübersaß, sondern einem sehr tapferen Marineoffizier.
Seit jenem unvergeßlichen Essen sind sechs Jahre oder noch mehr verflossen. Kürzlich sprach ich wieder mit dem Gouverneur und erzählte ihm, daß ich an diesem Buch schriebe. Ich bat ihn um seine Erlaubnis, die seinerzeit beim Essen besprochenen Einzelheiten verwerten zu dürfen. Er war mir gegenüber sehr zuvorkommend und ging sogar so weit, daß er mir den Vorschlag machte, durch seinen Neffen Verbindung mit seinem Freund B. Norris Williams, dem Direktor der Historischen Gesellschaft von Pennsylvanien, aufzunehmen. Ich sollte ihn dann bitten, die Sammlung seiner persönlichen Briefe, die dort bei den Akten lagen, zu lesen und zu prüfen. Diese vorher genannten George-Earle-Briefe sind von überaus weitreichender Bedeutung. Gott allein weiß, wieviel Menschenleben hätten gerettet werden können, wenn Roosevelt den Wunsch und die Möglichkeit gehabt hätte, zu kabeln: „George, sage ja, schicke nähere Einzelheiten, FDR.”
In der Historischen Gesellschaft von Pennsylvanien wurde ich von Herrn Williams freundlich empfangen und erhielt
226
sogleich die Erlaubnis, die Earle-Briefe einzusehen. Nachdem ich sie durchgesehen und über alles nachgedacht hatte, ging ich einige Stunden später tief erschüttert fort.
Man wird sich erinnern, daß Earles Bestrebungen achtzehn Monate, bevor es zu diesem zweideutigen und alles zermalmenden Schluß des Zweiten Weltkrieges kam, erfolgten. So hat es den Anschein, als ob die „vom Tode gezeichneten” Amerikaner von Roosevelts Beratern für diesen Zweck für gut genug gehalten wurden. Wäre mit dem Krieg im Jahre 1943 Schluß gemacht worden, was durchaus möglich gewesen wäre, dann hätte es Millionen weniger Tote gegeben sowie weniger Schulden, kein Geschrei, keine Sowjets in Europa und kein „Ost”- und „West”-Berlin. Es hätte auch keine Überschwemmung mit russischem Militärgeld gegeben, das nachher wieder in die Staaten einsickerte, um in großem Maße die wenigen Ein-Welt-Eingeweihten zu bereichern. Und es hätte keine Berlin-Mauer gegeben. Die eigentliche Mauer, um das amerikanische Volk zu betrügen, ist jedoch jetzt in wichtigen Kreisen in Washington errichtet worden und sie funktioniert in vollem Maße.
Kann man sich heute auch nur einigermaßen vorstellen, daß das deutsche Volk über den Commander Earle durch einen Frontgeneral einen äußerst vertrauenswürdigen Vorschlag für eine „Friedensverhandlung” unterbreiten lassen würde? Ich bezweifle es. Jedenfalls war die dem Commander Earle in Istanbul schließlich zugegangene geheime Antwort aus dem Büro des Präsidenten ausgesprochen zynisch, grausam und ausweichend.
General Patton wußte, was gespielt wurde. Aber er starb eines „frühen” Todes. Der Sekretär James Forrestal erkannte es ebenfalls. Auch er starb eines „frühen” Todes. Sicherlich hat es auch General Douglas MacArthur gewußt, Harry Truman jedoch anscheinend nicht; aber vielleicht wollte er es auch nicht wissen. Eine Kopie seines
227
Briefes v. 28. Febr. 1947 an den Gouverneur Earle, die am Schluß dieses Kapitels mit einigen anderen angeführt ist, hätte weit besser mit „Alice im Wunderland” unterzeichnet werden können als von einem Präsidenten der Vereinigten Staaten (Anlage 1). Zwei dieser Briefe habe ich noch in Erinnerung. Beide sind datiert v. 24. März 1945 und waren vom Weißen Haus an den Commander George H. Earle in Philadelphia gerichtet.
Augenscheinlich hatte Commander Earle über seine Tochter Anna dem Präsidenten Roosevelt ein persönliches Geschenk zugehen lassen (Anlage 2). Der Umschlag trug den Stempel 9 Uhr Abends, Washington D. C. Bei der Durchsicht des Briefes erkennt man, daß George Earle den Plänen unserer „Alliierten”, den Sowjets gegenüber, mißtrauisch geworden war. Aus diesem Grunde wurde er aber auch von den Beauftragten des Council of Foreign Relations, d. h. von einigen ihrer führenden Männer, die die dem amerikanischen Volke aufgezwungene Diplomatie des Zweiten Weltkrieges begünstigten, als äußerst gefährlich angesehen. Abgesehen von den beiden letzten Zeilen des Briefes, ist es für mich ganz selbstverständlich, daß einige der am linken Flügel stehenden Geheimagenten im Weißen Haus, die sich für derartige Aufgaben stets bereithielten, Annas Unterschrift sorgfältig geübt hatten.
Schon beim Lesen des ersten Absatzes zeigt sich an dem Hinweis, daß er im Falle der Durchführung seines vorgesehenen Programms, das sowjetische Verhalten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und zu kritisieren, des Landesverrats für schuldig erklärt werden könne, die sorgfältig in Worte gekleidete Falle für Commander Earle. Kein Rechtsanwalt hätte wohl eine strengere und gefährlichere Ausdrucksweise finden können als die, die in diesem Brief steht.
Selbstverständlich wußten nur wenige Menschen, daß George Earle 1943 auf Grund zuverlässiger Zusagen in
228
Istanbul die ersten notwendigen Schritte für Friedensverhandlungen mit Deutschland hätte tun können, wenn Roosevelt seine Weisung dazu gegeben und nicht geschwiegen hätte.
Der zweite Absatz fängt dann mit den überraschenden Worten an: „Da wir uns jetzt dem kritischen Stadium des Krieges gegen Deutschland nähern …” und „ … kostet uns vielleicht Tausende von Menschen”. Im Hinblick auf Earles tapfere Bemühungen im Jahre 1943 war das in der Tat sehr geschmacklos, so daß ich beim Lesen dieses Briefes wirklich nur Bestürzung empfinden konnte.
Ich bin überzeugt, daß Roosevelt Earles bereits erwähntes Geschenk bekommen hatte, aber er wollte beim Schreiben nicht so weit gehen, als habe er ihm dafür zu danken - einem Freunde in demselben Brief zu danken, in dem er aber auch nahe daran war, die Glaubwürdigkeit und Verwendungsfähigkeit des Commanders als eines tüchtigen amerikanischen Marineoffiziers in Frage zu stellen.
Beim Lesen des zweiten Roosevelt-Briefes vom 24. März 1945 an Commander Earle (Anlage 3) in der gleichen Angelegenheit, merkt man deutlich, daß, wer auch immer diesen Brief für Roosevelts Unterschrift vorbereitet haben mochte, Angst davor hatte, die Sowjets auch nur mit Namen zu nennen, ja auch nur die etwas unklare Bezeichnung Russen zu gebrauchen. Offenbar hat der betreffende Berater diese Situation als besonders delikat angesehen. Auch wollte man wohl nicht, daß irgendjemand den Brief zu jener Zeit lesen oder sehen sollte aus Angst, „die Katze könnte aus dem Sack schlüpfen!”
In dem Brief steht das Wort „Landesverrat”. Das ist ein starkes und häßliches Wort, vor allem, wenn es in Verbindung mit jemandem gebraucht wird, der als tapferer Offizier sein Leben zusammen mit vielen anderen eingesetzt hat und seinem Oberbefehlshaber genaue lebenswichtige und scharfsinnige Nachrichten zukommen ließ, Nachrichten
229
über eine Organisation, die in Wirklichkeit nicht unser Verbündeter war, sondern selbst damals nur daran dachte, uns zur Ader zu lassen und zu vernichten, um ihren gottlosen Kult allen europäischen Nationen aufzuzwingen. Man kann sich wirklich nur fragen, wo erfolgte denn nun der tatsächliche „Landesverrat”?
Selbstverständlich hatte Roosevelt als Oberbefehlshaber das Recht, die Veröffentlichung von bestimmten Äußerungen seitens irgendeiner Persönlichkeit in den amerikanischen Streitkräften zu verhindern, bis sie ordnungsgemäß genehmigt waren.
Doch wovor fürchtete sich Roosevelt denn so sehr, daß er sich zu derart extremen Maßnahmen hinreißen ließ? Warum diese überraschende Behandlung gegenüber Commander Earle? Warum mußten die vielen Millionen Menschen noch sterben? Wozu noch achtzehn Monate länger ein Gemetzel? Warum? Ungefähr drei Wochen, nachdem Roosevelt diesen Brief an Commander Earle geschrieben hatte, starb er in Warm Springs in Georgia. Commander Earle aber befand sich in Samoa im südlichen Pazifik. Gut unterstützt durch unsere Waffen, wälzte sich die Sowjetarmee weiter gegen Westen nach Europa.
Zweifellos war an jenem 24. März 1945 die Gesundheit des Präsidenten sehr angegriffen. Offenbar hatten seine Berater schon damit gerechnet. Es ist also durchaus möglich, daß Roosevelt so etwas wie ein politischer Gefangener geworden war. Immerhin gab es aber auch noch Personen, die ihm näherstanden und die gar keinen Grund hatten, sich weiter so sorglos hinzugeben und den Befehlen der Ein-Welt-Planer zu gehorchen, es sei denn aus rein egoistischen Gründen.
Vielleicht hat Roosevelt in seinen letzten Tagen doch tiefer über die treffenden Äußerungen seines politischen und Studienfreundes George Earle nachgedacht. Und vielleicht ist er doch zu dem Schluß gekommen, daß er selbst der Be-
230
trogene war. Wenn er das aber nicht war, was war er dann? Und was waren wir?
Roosevelts großer Irrtum, fälschlich bezeichnet als „Mißgriff”, nämlich die völlige Nichtbeachtung der rechtzeitig angebotenen Friedensverhandlungen, war für die Vereinigten Staaten und für die Welt so etwas wie eine nationale Katastrophe. Es war ein Sieg der Roosevelt-Berater und ihrer Pläne.
Man kann dazu nur noch wenig sagen und darauf hinweisen, daß die Schöpfer dieser trügerischen Götzenbilder auch heute noch fortwährend an der Arbeit sind, hochgeschätzt im Weißen Haus und auf dem Kapitol und eifrig damit beschäftigt, Nachrichten zu fabrizieren, ja selbst bestimmte Nachrichten zu unterschlagen. Commander Earle würde genau wissen, was ich damit meine. Doch auch heute sind augenscheinlich amerikanische Verluste noch ganz unwichtig.
Anlage 1
Das Weiße Haus, Washington
- Februar 1947
Sehr geehrter Herr Gouverneur!
Ich empfing dankend Ihr geschätztes Schreiben vom 26. Febr. und danke Ihnen gleichzeitig, daß Sie mich über Ihren Entschluß bzgl. der amerikanischen antikommunistischen Verbindung unterrichtet haben.
Die Menschen sind über die kommunistischen „Tumulte” sehr aufgebracht, meiner Ansicht nach jedoch ist das Land, was den Kommunismus anbetrifft, vollkommen sicher. Bei uns sind die Menschen viel zu vernünftig. Unsere Regierung dient der Wohlfahrt des Volkes, ich glaube nicht, daß jemals die Zeit kommen wird, daß irgendjemand den Willen hat, alles umzustürzen.
Mit freundlichem Gruß
Harry Truman
231
Hochwohlgeboren
George H. Earle
Grays Lane, Haverford, Pa.
(93744 - 388 A)
Anlage 2
Das Weiße Haus, Washington
- März 1945, 21 h
Sehr geehrter Commander Earle!
Ihr Schreiben v. 21. März hat mich ganz aus der Fassung gebracht. Es scheint mir einfach unmöglich, zu glauben, daß Sie ein Programm durchführen wollen, das, wenn es in dem von Ihnen beabsichtigten Sinne geschieht, dem Feinde jegliche Hilfe und Unterstützung gewähren würde. Ich kann mir nicht vorstellen, daß auch nur ein amerikanischer Bürger dies wünschen würde.
Da wir uns jetzt dem kritischen Stadium im Kriege gegen Deutschland nähern, ist es wohl selbstverständlich, daß jede Handlungsweise, die unsere freundschaftlichen Beziehungen zu unsern Verbündeten stört, nur dem Feinde helfen wird und uns deshalb vielleicht noch Tausende von Menschenleben kosten kann. Deswegen bin ich davon überzeugt, daß mein Vater es nicht wünschen wird, daß Sie Ihr Programm durchführen. Ihr sehr interessantes Geschenk für meinen Vater ist eingetroffen. Ich werde es ihm heute abend geben.
Hochachtungsvoll
(gezeichnet) Anna Roosevelt Boettiger
Com. George H. Earle
The Racquet Club
Philadelphia, Penna.
232
Anlage 3
Das Weiße Haus, Washington
- März 1945
Lieber George! Ihren Brief v. 21. März an meine Tochter Anna habe ich gelesen und mit großer Unruhe von Ihrem Plan Kenntnis genommen, Ihre ungünstige Meinung über einen unserer Verbündeten zu einer Zeit zu veröffentlichen, wenn eine derartige Veröffentlichung eines meiner ehemaligen Botschafter uns einen nie wiedergutzumachenden, unermeßlichen Schaden zufügen kann. Wie Sie sagen, haben Sie wichtige Vertrauensposten während Ihrer Verwaltung innegehabt. Die in solchen Stellungen erworbenen Informationen zu veröffentlichen, ohne einen direkten Auftrag zu haben, würde einen umso größeren Landesverrat bedeuten. Sie schreiben, Sie wollen an die Öffentlichkeit treten, sofern Sie nicht vor dem 28. März die Anweisung haben, daß ich das nicht wünsche. Ich wünsche es nicht nur nicht, sondern verbiete Ihnen, irgendeine Information oder Meinung über einen Verbündeten zu veröffentlichen, die Sie im Amt oder während Ihrer Tätigkeit in der amerikanischen Marine erhalten haben. Im Hinblick auf Ihren Wunsch, weiter im aktiven Dienst tätig zu sein, werde ich alle früheren Abmachungen über Ihren Dienst als Botschafter rückgängig machen und der Marine-Dienststelle Anweisung geben, Sie weiterhin da zu verwenden, wo sie Ihre Dienste am besten gebrauchen kann.
Es tut mir leid, daß dringende Angelegenheiten mich daran hindern, Sie am Montag zu sehen. Ich schätze unsere alten Beziehungen und hoffe, daß Zeit und Umstände eines Tages eine Erneuerung unseres guten Einvernehmens erlauben.
Mit freundlichen Grüßen
Franklin D. Roosevelt
233
Com. George H. Earle
The Racquet Club
Phila. Penna.
(93744 - 387 A)
Anlage 4
Das Weiße Haus, Washington , D. C.
kuvertiert 2. April 1945
17 Uhr Washington
Lieber George!
Ihr Schreiben v. 26. März habe ich gerade bekommen, die Befehle für Ihren Dienst im Pazifik sind bereits ausgestellt. Da ich die Anweisungen bereits einmal geändert habe, halte ich es für besser, daß Sie sie sofort ausführen und sehen, was Sie über den Krieg im Pazifik als eines unserer Probleme denken.
Mit den besten Wünschen
Freundliche Grüße
Franklin D. Roosevelt
Commander George H. Earle, U. S. N. R.
The Racquet Club, Phila. Pa.
234
Einundzwanzigstes Kapitel
Mein Besuch bei Admiral Kimmel
Es hat mich besonders gefreut, daß ich noch vor Herausgabe dieses Buches ein persönliches und außergewöhnliches Interview mit Admiral Husband E. Kimmel zustande bringen konnte. Es war sein Unglück, daß ihm völlig ungerechtfertigterweise als Überlebendem der Katastrophe von Pearl Harbour für diese die Verantwortung einseitig zugeschoben wurde. Seine Ausführungen bei unserer Unterhaltung waren so sehr für dieses Buch geeignet, daß ich sie hier einfügen möchte, um noch klarer diesen angeblichen Verrat herauszustellen, der dem amerikanischen Volke in jenen dunklen Tagen der Geschichte Amerikas untergeschoben worden ist.
Wohl mehr als jeder andere Marine-Offizier weiß Admiral Kimmel über „das Spiel” um „Pearl Harbour” Bescheid und kann die Wahrheit beweisen. Ich war erschüttert, als ich in einer Ausgabe v. 12. Dezember 1966 einer ganz bekannten Illustrierten über den fünfundzwanzigsten Jahrestag von „Pearl Harbour” las, wie dieser hervorgehoben wurde, und daß der neunundfünfzigjährige Kimmel drei Monate später gezwungen wurde, seinen Abschied zu nehmen, und seit dieser Zeit in einer Art dauernder Ungnade lebt. Diese Art von Berichterstattung war freilich nur ein schwacher Versuch, der Sache der Einwelt-Macher zu dienen, um ihren sorgfältig, ja mosaikartig aufgebauten falschen Berichten jene Wirkung zu verschaffen, die dazu bestimmt ist, wirkliche Tatsachen zu verhüllen und in diesem Falle sogar zu verheimlichen. Sie sollten damit weiterhin die Aufmerksamkeit von jenen Mächten
235
ablenken, die hinter dem begünstigten japanischen Angriff auf Pearl Harbour hervorlugten, um so ungerechterweise die Schuld dafür auf die Schultern unserer militärischen Befehlshaber in Hawaii zu legen.
Obgleich ich Admiral Husband E. Kimmel nie gesehen hatte, entschloß ich mich spontan, ihm einen Brief zu schreiben und ihm, falls er zusagen würde, einen Besuch abzustatten, um noch klarer herauszustellen, daß die Schuld bei Washington liege und nicht bei Admiral Kimmel und dem verstorbenen General Short, die beide von ihrer Regierung falsch behandelt worden waren und damit den machtvollen Kräften in und um Washington zum Opfer fielen.
Ich erinnere mich, gelesen zu haben, daß Admiral William (Bull) Halsey an Admiral Kimmel schrieb: „Man hat Ihnen den schwarzen Peter zugeschoben.” Es stimmt wirklich, daß Admiral Kimmel der „schwarze Peter” zugeschoben worden ist. Aber es stellt sich immer mehr heraus, daß dieser „schwarze Peter” nicht „made in Germany” war, sondern „made in Washington”.
So schrieb ich am 16. Dezember 1966 an den Admiral, stellte mich vor und schlug eine Zusammenkunft in seinem Hause zu einer für uns beide passenden Zeit vor, um über gemeinsame Interessen, einschließlich Pearl Harbour, zu sprechen.
Nach kurzer Zeit erhielt ich eine freundliche Antwort von ihm. Er schrieb, er ertränke in einer Flut von ungefähr sechshundert Briefen, die er seit dem 25. Jahrestag von Pearl Harbour bekommen hätte. Er bestimmte für unser Zusammentreffen den 3. Februar 1967.
An diesem Tage reiste ich mit viel Erwartung von Philadelphia nach Groton in Connecticut. Es wurde ein unvergeßlicher Nachmittag.
Nachdem ich dem Admiral meine Freude ausgedrückt hatte, ihn besuchen zu dürfen, hielt ich es für angebracht,
236
ihm gleich zu Anfang zu sagen, daß jede Mitteilung von ihm mir gegenüber streng vertraulich behandelt werden würde, falls er es wünsche. Worauf er lachte und erwiderte: „Oberst Dall, alles, was ich sage, können Sie zu jeder Zeit und allerwärts wiederholen.”
Ich wies auf verschiedene Artikel in führenden Zeitungen und Illustrierten hin und besonders auf Pearl Harbour. Tief in seinen großen Sessel gelehnt, nickte er mir zu und sagte: „Meine Angaben sind wahr.”
Dann erwähnte ich meine bescheidenen Verdienste in der Marine im Ersten Weltkrieg und, daß ich von dem mir erst seit kurzem befreundeten Admiral Zacharias darauf hingewiesen worden wäre, daß wir den Geheim-Code der Japaner schon viele Wochen vor dem Angriff auf Pearl Harbour entschlüsselt hatten. Der Admiral nickte wieder, dann begann er, über seine Beobachtungen und Erinnerungen an führende militärische und bekannte Persönlichkeiten ganz offen zu erzählen.
So saß ich denn, behaglich zurückgelehnt, in einem großen Armsessel dem Admiral in seinem gemütlichen Herrenzimmer gegenüber, wobei unser Gespräch zahlreiche interessante Themen berührte.
Das Leuchten in seinen Augen paßte zu dem hellen Licht, das von draußen das Zimmer durchflutete und sich so richtig in der schneebedeckten Landschaft widerspiegelte. Es war ein wunderschöner, klarer Wintertag. Doch gelegentlich verschwand das Leuchten in den Augen des Admirals und seine normale melodische Stimme verstärkte sich und wurde hart und eindringlich.
Admiral Kimmel meinte, der Grund für diese Post-Flut seit dem Tage von Pearl Harbour im Jahre 1966 sei wohl darin zu suchen, daß so viele Amerikaner von dem ungeheuren Betrug, der sich zu der Zeit von Pearl Harbour abgespielt hatte, Kenntnis bekommen und jetzt das Gefühl hätten, immer noch mit der gleichen betrügerischen
237
Diät gefüttert zu werden, immer noch Opfer der Einwelt-Macher zu sein, die sorgsam in hohen Regierungskreisen untergebracht worden wären.
Plötzlich sagte ich: „Warum wurde Ihr Vorgänger, Herr Admiral, der Admiral Richardson seines Kommandos enthoben?” Wie aus der Pistole geschossen, kam die Antwort: „Er wünschte, daß die Basis der Flotte an die Westküste verlegt werden sollte; er fuhr auch tatsächlich nach Washington und suchte dort Stark auf (Admiral Stark, Chef des Operationsgebietes der Marine), um mit ihm und ändern über eine derartige Verlegung zu verhandeln, und zwar vor allem im Hinblick auf die Spannungen, die sich im Fernen Osten allmählich abzeichneten. Richardson glaubte und bewies es auch, daß Pearl Harbour mit den vorhandenen Kräften und Ausrüstungen schwer zu verteidigen sei: 360 Grade Ozean seien zu überwachen, dabei sei es schwer, die Flotte laufend unter Dampf zu halten, jedem Unterseeboot-Angriff ausgesetzt zu sein bei unzureichenden Fliegerabwehrgeschützen des Heeres.
Alles das stimmte. Da er nicht mit Admiral Stark einig werden konnte, entschloß er sich, zum Präsidenten zu gehen. Auch bei ihm setzte er sich dafür ein, daß die Flotte im Pazifik eine sichere und strategisch günstigere Position einnehmen sollte. Roosevelt jedoch stellte sich taub und wollte nichts hören. Da schließlich schlug Richardson mit der Faust hart auf den Tisch, betonte dabei, er hätte damit seine Bedenken bei der höchsten Stelle vorgetragen, ging fort und fuhr zurück nach Hawaii. Bald darauf wurde er seines Kommandos enthoben. Ich wurde sein Nachfolger. Sofort setzte ich mich mit ihm in Verbindung, um ihm zu sagen, daß ich überhaupt nichts mit der Angelegenheit in Washington zu tun hätte und mit seinen Beschwerden, die beiseitegeschoben worden seien, übereinstimmte.”
Der Admiral fuhr fort und sagte: „Es ist interessant oder zumindest bedeutungsvoll, Oberst Dall, darauf hinzuwei-
238
sen, daß ich noch garnicht lange den Oberbefehl innehatte, als ein Befehl von Washington durchkam, mehrere Kriegsschiffe und auch einige Hilfsschiffe einschließlich Tanker für dienstliche Zwecke in andere Gebiete zu schicken, wodurch meine Kräfte um zwanzig Prozent reduziert wurden. Wie ich mich noch erinnere, wurden dann einige Monate später, im Juni 1941, weitere Kriegsschiffe abkommandiert und verlegt. Da ich dieses Mal darüber sehr aufgebracht war, fuhr ich nach Washington und protestierte gegen den von Admiral Stark ausgestellten Befehl. Es gelang mir, zu erreichen, daß der Befehl etwas abgeändert wurde. Trotzdem war ich weiterhin geschwächt, was mir endlose Sorgen bereitete.”
Ich bemerkte: „Haben Sie damals im Juni versucht, Roosevelt zu besuchen, Herr Admiral?” „Ja”, sagte er, „aber Roosevelt lehnte es ab, mich zu empfangen.” Auf meinen Blick hin, der deutlich meine Überraschung zeigte, fuhr er fort: „Um nun allem die Krone aufzusetzen, befahl im Spätherbst 1941, kurz vor dem Angriff, das Marineministerium in Washington die Abkommandierung meiner drei Träger, und zwar ging einer nach Wake, der zweite nach Midway und der dritte in die Heimatgewässer. Am 7. Dezember 1941 war auf diese Weise meine Flotte ihrer Flugzeugträger beraubt. General Short hatte ungefähr zwölf Armee-Aufklärungsflugzeuge, von denen aber nur sechs für weite Aufklärungsflüge über See geeignet waren!”
Der Admiral stand dann auf und schritt langsam durch den Raum, um seine Glieder zu strecken. Dann fuhr er mit seinen mich erschütternden Ausführungen fort.
„Was ich jetzt sage, wird Sie weiter überraschen, Oberst Dall. Später habe ich herausgefunden, daß die japanische Kampfgruppe besonderen Befehl hatte, bei der Annäherung an Pearl Harbour noch vor dem Angriff abzudrehen und über die japanischen Gewässer zurückzukehren, falls die amerikanischen Streitkräfte in Pearl Harbour recht-
239
zeitig Wind bekommen haben sollten. Das hat mir natürlich erklärt, warum diese in Washington empfangene, äußerst wichtige Information, die in den entschlüsselten und übersetzten japanischen Funksprüchen enthalten war, absichtlich den Befehlshabern in Hawaii vorenthalten wurde, aus Angst nämlich, die Japaner würden ihre Pläne ändern, um unter den für sie von Washington rechtzeitig geschaffenen günstigen Bedingungen anzugreifen.”
Hier zitierte der Admiral aus einer Geheimdepesche Tokios an die japanische Botschaft in Washington D. C. v. 1. Dezember 1941: „Um zu verhindern, daß die Vereinigten Staaten zur unrechten Zeit argwöhnisch werden, haben wir in der Presse und auch sonstwie bekanntgegeben, daß, obgleich zwischen Japan und den Vereinigten Staaten schwere Differenzen bestehen, die Verhandlungen weiter fortgeführt werden.” „Ich habe diese Mitteilung nie bekommen”, fügte der Admiral hinzu.
Am 6. Dezember 1941 wurde am frühen Nachmittag eine Flugzeugmeldung von Tokio an ihre Botschaft in Washington aufgefangen und entschlüsselt, die besagte, daß eine sehr wichtige Botschaft von vierzehn Punkten auf dem Weg zu ihrem Botschafter in Washington wäre. Am 6. Dezember 1941 waren um 15 Uhr dreizehn der vierzehn Punkte empfangen, von uns entschlüsselt und übersetzt. Um Mitternacht erfolgte die Mitteilung an die wichtigsten Beamten der Regierung. Als die dreizehn Punkte dem Präsidenten im Weißen Haus um 21 Uhr (15.30 Uhr Sonnabend Nachmittag in Hawaii) vorgelegt wurden, sagte er: „Das bedeutet Krieg.”
Warum wurde nicht sofort von dem Oberkommandierenden unserer Streitkräfte oder von dem unter ihm arbeitenden Admiral Stark eine Radiomeldung über den schnellsten Weg durch die Marine an Admiral Kimmel und General Short geschickt, um sie auf diese ungeheure Gefahr aufmerksam zu machen? Diese Frage bewegt mich wieder
240
und wieder. Warum? Für das Leben und für die Gesundheit der ihm unterstellten Männer die Verantwortung zu übernehmen, ist eine selbstverständliche Pflicht eines Offiziers. Es beweist, daß zwischen ehrlich kämpfenden Männern Vertrauen herrscht, selbst wenn die obersten Einwelt-Macher und ihre Freunde in den großen Banken der Ein-welt-Finanz sowohl wie auch im Ausland einen noch so großen politischen Druck auf Roosevelt ausgeübt hätten, uns in einen Krieg zu verwickeln.
Ich konnte mir lange Zeit keine Vorstellung davon machen, warum jene für Admiral Kimmel und General Short so wichtige Radiomeldung nicht sofort vom Präsidenten an sie abgeschickt worden ist. Zwei Tage später jedoch kam Roosevelts laut tönende Botschaft, die geschickt einem feierlich versammelten, zwar erschrockenen, aber getäuschten Kongreß vorgetragen wurde. Es wäre bei weitem wichtiger gewesen, wenn die Warnung rechtzeitig am Sonnabend Admiral Kimmel zugegangen wäre.
Ich erinnere mich an die so häufig zitierte Wendung vom „Tag der ewigen Schande”. Gewiß war es keine Unterschätzung seinerseits. Die „Schande” war sicherlich in mehreren Bereichen nicht zu übersehen, aber wo lag der Kern der Sache? Er lag jedenfalls in weiter Ferne von den Bomben entfernt, die auf Tausende von arglosen, anständigen Amerikanern in Pearl Harbour niederstürzten.
Admiral Kimmel erzählte weiter: „Am nächsten Tag früh - es war der 7. Dezember, ein Sonntag - trafen sich General Marshall und Admiral Stark in seinem Büro im Marine-Ministerium. Um 9 Uhr morgens war der 14. Punkt der japanischen Botschaft abgehört, entschlüsselt und übersetzt. In Pearl Harbour war es 3.30 Uhr morgens, also noch viel Zeit für eine Warnung. General Marshall bummelte in Starks Büro herum, wobei er vorgab, er hätte noch nicht die am Sonnabend Nachmittag erhaltenen 13 Punkte verarbeitet. Sein Spazierritt in Virginien am Sonn-
241
tag morgen, der so großartig veröffentlicht war, ist reine Phantasie. Stark sagte zu Marshall: ,Laß uns an Kimmel funken und ihn warnen.’ Marshall erwiderte: ,Laß uns das nicht tun, es könnte von den Japs aufgefangen werden und die Dinge verschlimmern’ (Hvhbg. v. Verf.).
Stark: ,Ich kann ihn mit Marinefunk in 15 Minuten erreichen.’ Marshall: ,Ich werde ihm später telegrafieren.’ Und das tat er dann auch schließlich”, erklärte der Admiral. „Marshall schickte mir ein ganz gewöhnliches Telegramm über die Western-Union, das weder auf die Dringlichkeit hinwies noch auf bevorzugte Bearbeitung!”
Dann schloß der zurückgetretene Kommandant diese Episode mit den Worten: „Marshalls Telegramm über die Western Union erhielt ich schätzungsweise zwei Stunden, nachdem die Bomben gefallen waren. Aber ich war so verflucht wütend, daß er mir so ein gewöhnliches Western-Union-Telegramm geschickt hatte, daß ich es nach dem Lesen zerknüllte und in den Papierkorb warf. Kurz davor hatte Admiral Stark eine Meldung an Admiral Bloch durchgegeben, um herauszubekommen, was los war. Bloch war damals Befehlshaber der örtlichen Marine-Station in Pearl Harbour.”
Wie häufig habe ich darüber Vermutungen angestellt, was sich kurz nach der Explosion der japanischen Bomben ereignet haben mag, als Roosevelt und die ändern hohen Beamten in Washington die furchtbaren Einzelheiten des Massenmordes in Pearl Harbour erfahren hatten! Wie berichtet wird, erinnerte sich der Staatsanwalt Francis Biddle, als er zu jener Zeit Roosevelt sah, wie dieser niedergeschlagen zu sein schien, ja ganz abwesend und still. Für mich war diese Reaktion seinerseits keinesweg überraschend, und zwar vor allem im Hinblick auf die ungeheuer vielen Fehler und auch, weil er es unterlassen hatte, Admiral Kimmel am vorhergehenden Abend zu alarmieren und zu warnen (Newsweek 12. Dez. 1966, 42).
242
Admiral Kimmel lud mich dann zu einer Tasse Kaffee ein, wobei wir über andere Dinge sprachen.
Ich sagte: „Was geschah, Herr Admiral, nachdem sich die japanische Flotte wieder entfernt hatte?”
Er erwiderte: „Nach einigen Tagen kam, laut Anordnung des Präsidenten Roosevelt, der Richter Owen Roberts mit einer Kommission aus Washington, um die Sache zu untersuchen, in Wirklichkeit jedoch, um die so notwendig gebrauchten Sündenböcke - damit sind natürlich General Short und ich gemeint - festzustellen.”
Der Versuch, die große Tragödie zu klären, daß sie nicht durch die Politik in Washington verursacht war, sondern durch Personen in Hawaii, gelang rechtzeitig, denn jetzt standen diese im Blickfeld und Brennpunkt des beleidigten amerikanischen Volkes.
Zehn Tage nach dem Angriff wurde ich meines Kommandos enthoben und nach dreißig Tagen verabschiedet. Roberts fing sofort mit seinem Verhör in einer äußerst autoritären Art und Weise an, wobei er das Gesetzesbeil wie ein Kreuzfahrer schwang. Mir, dem Mittelpunkt, auf den sich alles konzentrierte, war keine Rechtsberatung gestattet; ich durfte nicht einmal das wissen, was zahlreiche andere bezeugt hatten. Obgleich die stenografisch berichteten Möglichkeiten auf der Insel anerkanntermaßem falsch und ungeeignet für ein derartiges Vorgehen waren, erlaubte mir Roberts anschließend nicht, meine Zeugenaussage durchzulesen und zu korrigieren, trotz der Tatsache, daß der Bericht einige völlige Entstellungen und Abweichungen von der Wahrheit enthielt.
Schließlich protestierte ich, worauf wir sehr scharf aneinander gerieten. Fraglos hatte Roberts für die Vielwisser in Washington eine bestimmte und besondere Aufgabe durchzuführen. Daher war er unter allen Umständen entschlossen, mit den verlangten Ergebnissen zurückzukehren. In meinen Augen war er ein arroganter …
243
Sehr bald war die Theorie von einer sehr ausgebreiteten Rivalität innerhalb des Dienstes ersonnen, die natürlich von der Presse eifrig aufgegriffen wurde. Anscheinend sollen General Short und ich garnicht miteinander gesprochen haben. Diese Darstellung war so absurd, wie sie falsch war. Wir waren Freunde und berieten jeden Tag zusammen alle wichtigen Fragen.”
Der Admiral Jenkte dann meine Aufmerksamkeit auf einen langen Brief, den er an das Kongreßmitglied aus Missouri, Clarence Cannon, am 3. Juni 1958, an das House Office Buildung, Washington D. C. gerichtet hatte. In diesem Brief protestierte er gegen zahlreiche Bemerkungen über Pearl Harbour, zu denen sich das Kongreßmitglied am 6. Mai 1958 im Sitzungssaal des Hauses bemüßigt gefühlt hatte. In dem Kongreßbericht jenes Tages waren seine Ausführungen enthalten. Kimmel schrieb: „Aus Ihren Äußerungen habe ich zum ersten Male den. Ursprung jener Unwahrheit erfahren, daß General Short und ich zur Zeit des Angriffs Gegner gewesen sein sollen. Ich möchte sehr gerne den Namen jener Person wissen, die Ihnen diese Erklärung vor einem Untersuchungsausschuß des Bewilligungsausschusses gegeben hat. Ihre Behauptung, daß es zwischen General Short und mir an Zusammenarbeit gefehlt hätte, ist vollkommen falsch. Der Untersuchungsausschuß der Marine hat festgestellt, daß ,Admiral Kimmel und Generalleutnant Short persönliche Freunde waren. Sie kamen häufig zusammen, und zwar gesellschaftlich wie auch dienstlich.'”
In dem zweiten Brief an Cannon schrieb er: „Ich wiederhole, Herr Cannon, der Erfolg des Angriffes auf Pearl Harbour ergab sich nicht aus innerdienstlichen Zwistigkeiten in Pearl Harbour, sondern er war eine Folge des vorsätzlichen Unterlassens von selten Washingtons, den Befehlshabern in Hawaii die in Washington vorhandenen Informationen zur Verfügung zu stellen, wozu sie berech-
244
tigt waren. Diese den Befehlshabern in Hawaii verweigerte Unterrichtung war den amerikanischen Kommandeuren auf den Philippinen und auch den britischen Befehlshabern zugegangen” (vom Verf. hervorgehoben). Beide Briefe blieben unbeantwortet.
„Der Roberts-Bericht war eine Schweinerei”, fügte der Admiral hinzu, „er strotzte nur so von haarsträubenden Ungenauigkeiten und verfolgte lediglich den einen Zweck, mich und General Short zu ,Sündenböcken’ zu stempeln. Auf diese Weise wollte man versuchen, den durch Hulls ,Ultimatum’ v. 26. Nov. 1941 an die Japaner zu erwartenden Druck zu vermeiden, und sie durch die ihnen dargebotenen, wohlüberlegten Verlockungen zu veranlassen, uns in Pearl Harbour anzugreifen, da unter Umständen hier das geringste Risiko lag.”
„Herr Admiral”, sagte ich, „der japanische Konsul in Honolulu hat Tokio mit den genauesten Einzelheiten versorgt, welche Schiffe im Umkreis von Pearl Harbour stationiert waren. So stimmt es also nicht, daß sie Anfang Dezember 1941 wußten, daß unsere Flugzeuge auf den Trägern offenbar abwesend waren.”
„Klar”, erwiderte er und fügte hinzu: „Ich habe die entschlüsselten und übersetzten Telegramme, die wir am 5. und 6. Dezember abgefangen hatten, gelesen, natürlich später, viel später, was diesen betreffenden Punkt angeht. Damals hat man mir diese Mitteilung nicht zugehen lassen.”
Ich bemerkte, daß ich einen flüchtigen Vergleich zwischen dem Roberts-Bericht über Pearl Harbour und dem Warren-Bericht über die Ermordung des Präsidenten Kennedy in meinem beinahe abgeschlossenen Buch gemacht hätte; ich hätte vor allem darauf hingewiesen, daß meines Erachtens von dem Kongreß ohne jede Verzögerung weitere Untersuchungen über dieses letzte tragische Ereignis vorgenommen werden sollten, um die ganze
245
Wahrheit zu enthüllen. Ich las ihm mehrere Seiten vor, wobei er mit großem Interesse zuhörte und mir zustimmte.
Admiral Kimmel setzte seine Kaffeetasse hin und sagte: „Nach langer Zeit und mit viel Anstrengung konnte ich es endlich erreichen, daß eine Verhandlung vor dem Marine-Untersuchungsgericht in Washington stattfand. Es war das einzige Verhör über Pearl Harbour, in dem mir gestattet wurde, irgendjemanden einem Kreuzverhör zu unterziehen und Zeugen zu benennen. Vor allem lag mir daran, den Kriegsminister Henry L. Stimson in den Zeugenstand zu bekommen, da er erheblich in die Sache verwickelt war. Ich wollte ihm gerne mehrere eindringliche Fragen stellen. Seine Antworten dürften äußerst interessant gewesen sein. Stimson drückte sich aber wohlweislich vor dem Untersuchungsausschuß, indem er eine Krankheit vortäuschte, also einfach log. Zufällig stieß ich nämlich an jenem Morgen auf der Williams Street in New York mit ihm plötzlich zusammen. Von der ganzen Bande in Washington schien es mir, als ob Knox der Mann war, der noch am meisten von Ehrgefühl geleitet wurde.”
„Und was wissen Sie über Roosevelt?” fragte ich. Der Admiral machte eine Pause und blickte für einen Augenblick nach draußen, dann fuhr er fort: „Versetzen wir uns in das Jahr 1915 zurück, Oberst Dall. Ich war damals Marineleutnant. Ich lernte Roosevelt und seine Frau zuerst kennen, als er Zweiter Sekretär in der Marine war. Wie ich mich erinnere, fuhren sie beide mit dem Vizepräsidenten Marshall nach San Diego in Californien, um an einer Feier teilzunehmen, die aus Anlaß der Vollendung des Panamakanals stattfand, und auch, um die Flotte zu besichtigen. Ich war damals für zwei Wochen dem Stab zugeteilt als Roosevelts Adjutant. Beide waren reizend, aber so langsam wurde ich müde, Frau Roosevelts Mantel zu halten.
246
Später wurde ich zum Kapitänleutnant befördert, dann unter Admiral Hugh Rodman Artillerieoffizier in der amerikanischen Flotte. Anschließend wurde ich der Britisch Grand Fleet zugeteilt, die in Scapa Flow in Schottland stationiert war. Auf zahlreichen britischen und amerikanischen Schiffen hielt ich Vorträge über Marineartillerie, die mein Fachgebiet war, und lernte viele prächtige Offiziere kennen.
Zu Beginn des Ersten Weltkrieges besuchte Roosevelt als Zweiter Sekretär der Marine Admiral Rodman auf seinem Flaggschiff in Scapa Flow. Ich war zufällig bei dem Frühstück anwesend, das Admiral Rodman zu Ehren Roosevelts gab. Doch ganz plötzlich nahm dieses eine unfreundliche Wendung. Rodman hatte zwar eine Stimme wie ein Löwe, aber seine Sache verstand er. Bei Beginn des Frühstücks fragte er beiläufig nach dem Zweck seines Besuches in Scapa Flow. Roosevelt erwiderte, daß er gekommen wäre, um der Verantwortung für irgenwelche Mißstände in der Marine zu entgehen, die die Demokratische Partei nachteilig beeinflussen könnte. Admiral Rodman erstarrte daraufhin und sagte mit dröhnender Stimme: ,Wenn das der Grund Ihrer Reise zu uns ist, Herr Sekretär, dann packen Sie am besten sofort Ihre Koffer und gehen nach Hause!’
„Ich mochte die Engländer gerne leiden”, fügte Admiral Kimmel hinzu.
„Bestimmt war Admiral Beatty ein glänzender Offizier. Aber um auf Ihren früheren Schwiegervater zurückzukommen, ich meine, er würde auch nicht einen Augenblick gezögert haben, um jederzeit und jedem Menschen gegenüber seinen Vorteil wahrzunehmen, und wenn es sich um seine eigene Mutter gehandelt hätte, sofern es ihm politische Vorteile eingebracht hätte.”
Da durchzuckte mich plötzlich ein Gedanke. Auch ändern Menschen war dieser Hang und dieser charakteristische,
247
empfindliche Zug, der Roosevelts Wesen kennzeichnete, aufgefallen. Erfolgreich hatten sie daraus Kapital geschlagen, um ihre eigenen weitreichenden Pläne zu fördern.
Als ich hinausschaute, sah ich die Sonne untergehen. Da wurde mir plötzlich bewußt, daß über zwei Stunden verstrichen waren. So stand ich denn auf, um mich zu verabschieden.
Der Admiral begleitete mich bis an die Tür. Als ich den Wagen bestieg, winkte ich ihm zu, und auch er winkte freundlich zurück. So verließ ich Admiral Kimmel, um nach New London und New York zurückzukehren.
Der Zug nach New London war bald von einer Menge umherlaufender Matrosen, die ihren Wochenendurlaub in der großen Stadt verbringen wollten, überfüllt. Fraglos, sagte ich zu mir selbst, wird es so bei den vielen jungen Matrosen in Pearl Harbour gewesen sein, bis deren Wochenende plötzlich und für immer vorbei war.
Viele Gedanken gingen mir durch den Kopf. Ich öffnete meine Aktentasche, um Papier zu suchen und um mir kurze Notizen über die verschiedenen, in dem Hause des Admirals diskutierten Fragen zu machen.
Da schrieb so ein enttäuschter und infolge eines nur kurzen Interviews mit Admiral Kimmel verärgerter Berichterstatter einer Illustrierten in einem kürzlich veröffentlichten minderwertigen und niederträchtigen Bericht, „daß der neunundfünfzigjährige Admiral drei Monate später sich gezwungenermaßen zur Ruhe gesetzt hätte und seitdem in einem Zustand dauernder Ungnade lebe”. Die beiden letzten Worte dieses harten Berichtes oder sagen wir, um korrekt zu sein, Fehlberichtes, nagten mir am Herzen: Die Worte von der Ungnade. In New York, wo ich die Nacht verbrachte, suchte ich in einem Wörterbuch nach dem Sinn des Wortes verhängt. Die Erklärung lautete: „Ein unentschiedener oder unbestimmter Zustand.” Dementsprechend darf ich darauf hinweisen, daß das Marine-
248
Untersuchungsgericht in einer sehr gemäßigten Sprache durch den Gerichtspräsidenten Admiral Orin G. Marfin erklärte: „Wir haben festgestellt, daß Admiral Kimmel alles getan hat, was unter diesen Umständen überhaupt nur getan werden konnte” (vgl. 2. Gesetzesbrief v. 7. Juli 1958). Somit ist das recht tollkühn von einem rachsüchtigen Reporter herausgeschleuderte Wort verhängt gar nicht am Platze.
Ebenfalls stellte ich fest, daß das Wort Ungnade bezeichnet wurde als ein Zustand, in den man wegen „schlechten Benehmens” geraten war, also einer Person oder Sache wegen, die in Schande, Unehre und Schmach geraten läßt. Indem der Reporter ein ganz falsches Bild entwarf, stellte er es unverschämterweise so dar, als ob es wirklich Admiral Kimmels Fehlverhalten gewesen sei, das die große japanische Kriegsmarine ermutigte, sich heranzuschleichen und Pearl Harbour anzugreifen.
Ich hoffe jedoch sehr, durch meinen Bericht jenes boshafte und weitverbreitete Bild über Admiral Kimmel vollständig zu zerstören, zumal da dieses Bild gemacht war, um die Öffentlichkeit zu verwirren und das zwecks unserer Umerziehung von einigen mächtigen Bildfälschern errichtete, nunmehr hinfällige Lügengebäude zu stützen. Bedauerlicherweise sind nicht selten ihre verschiedenen Bemühungen erfolgreich.
Zur Zeit wäre es politisch unwahrscheinlich, von dem Kongreß zu erwarten, er könnte Admiral Kimmel gegenüber eine freundliche Stellung einnehmen, und zwar hinsichtlich der etwas verspäteten Erkenntnis des ihm vor fünfundzwanzig Jahren zugefügten Unrechts. Mit großer Würde hat er diese schwere Last der politischen Herabwürdigung getragen. Aber schließlich hat sich das „Rad” zu seinen Gunsten gedreht und wird es auch weiterhin tun. Bei unserer Unterredung über bestimmte Fragen hatte ich das Gefühl, daß ihm gewisse politische Einflüsse unbe-
249
kannt waren, während sie mir ganz klar waren. Es handelte sich hier um Einflüsse, die Roosevelt und andere veranlaßt haben mögen, rücksichtslos mit der Absicht zu experimentieren, unser Land in einen unerwünschten Krieg zu verwickeln, indem man ein Ereignis oder einen feindlichen Angriff auf amerikanischen Boden herausforderte. Die dem amerikanischen Volke gemachten wichtigen politischen Versprechungen, um Stimmen zu bekommen, waren auf diese Weise hinfällig geworden.
Admiral Kimmel ist sehr schlecht behandelt worden. Wenn das amerikanische Volk jetzt nicht mit Hilfe des Kongresses oder auf irgendeinem ändern Wege die letzten Jahre dieses vierundachtzigjährigen Admirals glücklicher gestalten wird, dann kann ich als guter Bürger nicht umhin, zu glauben, daß die über ihn verhängte »Ungnade” mir und allen nachdenklichen Amerikanern, besonders aber jenen, die es vorziehen zu schweigen, klar zeigt, daß etwas unternommen werden muß.
Die Image-Entsteller aber sollten sich genau merken: Gerechtigkeit hat schon immer letzten Endes doch über die Lüge triumphiert.
250
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Der wahre Ursprung der „Vereinten Nationen”
Hintergrund und Zweck der internationalen Mächte, die 1945 in dem arglosen San Francisco zur Gründung der „Vereinten Nationen” zusammentrafen, hat damals wenig Eindruck auf mich gemacht. Nachdem ich während des Zweiten Weltkrieges fast vier Jahre lang im aktiven Militärdienst gestanden hatte, traten mir im zivilen Leben ganz andere Probleme auf, mit denen ich mich zu befassen hatte. Und da ich stets recht naiv gewesen bin, sah ich keinen Grund, warum die Vereinigten Staaten nicht auch mit ändern Nationen zusammenkommen sollten, um konstruktive Gedanken über wichtige Fragen auszutauschen. Wie die meisten Amerikaner ahnte ich keine UNO-Falle. Zwei Jahre später jedoch beunruhigte mich, was in San Francisco geschehen und auch was von der UNO entwickelt worden war, damit es leichtgläubige Amerikaner hinunterschlucken sollten. In dieser Hinsicht saß ich in der „ersten Reihe”.
Ich weise hier auf das Einwelt-Revolutions-Programm hin, das zugunsten der Weltfinanzmächte von den sich selbst so benennenden Vereinten Nationen in Szene gesetzt worden ist. Hoffentlich werden meine Betrachtungen über die UNO, von der wir so viel lesen und doch so wenig wissen, viele Amerikaner, besonders die nächste Generation, zum weiteren Lesen und Beobachten anregen. Gerade sie müssen die Gelegenheit ergreifen, selbständig unterscheiden zu können, um in der Lage zu sein, den Weizen von der Spreu zu trennen. Davon hängt ihre ganze Zukunft ab.
Der Plan, eine überstaatliche Regierung der Vereinten
251
Nationen zu schaffen, wurde 1919 in Paris bei der Friedenskonferenz in Szene gesetzt, als der Völkerbund geschaffen wurde.
Die tatsächlichen, auf lange Sicht geplanten Ziele der UNO sind raffinierterweise verheimlicht worden. Sie werden auch weiterhin hinter den Wolken einer einweltrevolutionären sozialistischen Propaganda verborgen bleiben, die ihrerseits nur mit einem Dauerbetrug möglich sein wird.
Der Begriff eines weltumspannenden Apparates der Vereinten Nationen kam nicht von ungefähr. Denn es ist ganz klar, daß nicht ein einzelner diese ungeheuren Beträge plötzlich aufbringen konnte, um eine erfolgreiche Förderung zu ermöglichen. Die auf lange Sicht geplanten Operationen der UNO zugunsten ihren eigenen Zwecken dienender Kriege, einem schwindelhaften Unternehmen, waren daher für einige ehrgeizige, nach mehr Macht und Wohlstand strebende Leute schon den großen Teil Geldes wert. Bereits 1919 wurde auf der Pariser Friedenskonferenz in Versailles, wo der „Friede” durch Abwesenheit glänzte, der Völkerbund geboren. Eine ausländische Clique hatte ihn sorgfältig geplant und dann Präsident Wilson damit übertölpelt und dieser wieder Amerika. Welt-Bankiers waren seine führenden Verfechter und Förderer. Der Völkerbund wurde ein Fehlschlag, und zwar weil der Plan schon im voraus veröffentlicht wurde, hauptsächlich aber wegen des starken Widerstandes des Senats der Vereinigten Staaten, aber auch, weil viele aufmerksame Bürger die in ihm verborgene Gefahr erkannten.
Aber diese außerordentlich raffinierte Geldclique ließ sich durch diesen Fehlschlag des Völkerbundes nicht entmutigen. Im Gegenteil, sie beschloß, die Einwelt-Konzeption für ihre eigenen egoistischen Ziele am Leben zu erhalten, und ersann sofort andere Mittel und Wege, um ihr auf weite Sicht durch viel Kleinarbeit weiterzuhelfen. So
252
wurde für mindestens fünfundzwanzig Jahre Vorsorge getroffen, um das amerikanische Volk in die Falle zu locken.
Um dieses Mal sich gegen einen Fehlschlag zu sichern, wurde eine Organisation mit dem Namen Council on Foreign Relations (C. F. R.) ins Leben gerufen. Sie sollte dazu dienen, Menschen für die verschiedenen Tätigkeitsbereiche sorgfältig zu erziehen und sie für ihre ideologischen, politischen, finanziellen, militärischen und erzieherischen Ziele entsprechend zu formen. In London wurde das Gegenstück dazu geschaffen, The Royal Institute of International Affairs. Diese beiden Gruppen sind weltbekannt unter der Bezeichnung „die Bilderberger”. An ihrer Spitze steht Prinz Bernhard von den Niederlanden. Das Hauptquartier ist häufig in Holland zu finden.
Die erste wichtige finanzielle Zuwendung an die C. F. R. erfolgte von einer der Stiftungen der Rockefeller-Familie im Jahre 1919. Seitdem sind weitere große Schenkungen erfolgt. Oberst House, der Berater Präsident Wilsons, war der erste, der mit der neuen C. F. R.-UN-Werbung für die Internationalisten aus dem Hintergrund heraustrat, wobei ihm Baruch und Frankfurter über die Schulter sahen.
Prüfen wir einmal den Ursprung dessen, was ungenau, aber opportunistisch als Einwelt-Regierung bezeichnet wird, wie sie in den Staaten und einem ihrer hauptsächlichsten Sprößlinge, in den Vereinten Nationen, gepflegt wird. Vielleicht würde der Begriff Eingruppen-Regierung viel besser ihre wahren Ziele kennzeichnen. Seit Jahrhunderten haben die bösen Mächte den guten Mächten im Kampf gegenübergestanden. Die bösen Mächte setzen nur sorgfältig ausgesuchte und geschulte Kräfte ein, und zwar aus allen religiösen und auch nichtreligiösen Gruppen, um ihre Ziele durchzusetzen. Unter diesen geschulten Kräften und ihren Anhängern befinden sich Juden, Christen, Mo-
253
hammedaner, Hindus, Mormonen, Atheisten und andere. Wenn man über viele Jahrhunderte hinweg zurückblickt, wird es einem klar, daß diejenigen, die heute versuchen, die sogenannte „Ein-Welt-Regierung” zu entwickeln, äußerst eng mit den Ein-Welt-Bankiers und den politischen Spekulanten von ehedem verbunden sind. Insofern hat in unserm modernen Sozialgefüge im Grunde genommen keinerlei Verbesserung stattgefunden, besonders nicht seit 1913, als Woodrow Wilson Präsident wurde. In Wirklichkeit ist das heutige Staatsgefüge noch viel gefährlicher geworden infolge der Entwicklung neuer wissenschaftlicher Geräte, die die Schnelligkeit globaler finanzieller Operationen erleichtern und die nur von wenigen kontrolliert werden können.
„Kommunismus”, eine betrügerische Propaganda, zuerst als „Bolschewismus” ausgegeben, wurde ersonnen für die erste Phase eines Programms zur Einführung einer Ein-Welt-Revolution, bevor die führenden Leute das erreichen, was sie hinterhältigerweise als „Frieden” bezeichnen. „Kommunismus” ist die aktive Front, sozusagen die Beförderungsrampe für den ersten Schuß, um die tatsächliche Kontrolle der Geld-Welt-Politik in die Hand zu bekommen mit dem Ziel der Ausrottung aller Religionen.
Es ist gar nicht leicht, die Schablone dieses häßlichen Bildes zu erkennen. Es soll auch gar nicht leicht sein. Zahlreiche Erläuterungen gut unterrichteter prominenter Persönlichkeiten haben mir hier sehr geholfen, so daß ich darüber einiges sagen kann.
Erstens: „Gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation und es ist mir gleichgültig, wer dann die Gesetze macht.” Es war Amschel Meyer, der Chef und Gründer des ungeheuren Bankimperiums der Rothschild-Gruppe, von dem diese erschreckende Äußerung stammt. Heute hat diese Gruppe eine verfassungswidrige Kontrolle über die Finanzen und den Wohlstand der Vereinigten Staaten
254
vermittels der tatsächlichen Vermögenskontrolle der Privately Owned Federal Reserve Bank (der im Privatbesitz befindlichen Federal Reserve Bank). Abraham Lincoln hat schwer darum gekämpft, etwas Derartiges zu verhindern. Diese eben genannte zerstörende Macht hat das Ziel, alle Religionen vollständig auszumerzen. Auf der Grundlage mehrerer älterer europäischer Geheimverbände gründete Adam Weishaupt am 1. Mai 1776 (dem Mai-Tag der Kommunisten) den Orden der Illuminaten oder der Erleuchteten. Weishaupt stammte aus einer bayrischen, katholischen Familie und war von den Jesuiten erzogen worden. Seine persönliche religiöse Auffassung entartete jedoch und sein Plan wurde eine revolutionäre Weltverschwörung mit dem Ziel, alle bestehenden Regierungen und Religionen zu zerstören. Stattdessen wollte er eine Einwelt-Regierung errichten, die jedoch von einem sorgfältig ausgewählten Despoten beherrscht werden sollte. Das war im Jahre 1776.
„1848 veröffentlichte Karl Marx in London sein häufig diskutiertes Buch ,Das kommunistische Manifest’, wobei ihn sowohl Clinton Roosevelt wie auch Horace Greely direkt finanziell stark unterstützten. Ohne diese Hilfe wäre er ein unbekannter, besessener Revolutionär geblieben” (Vennard, The Federal Reserve Hoax, Boston). 1841 veröffentlichte Clinton Roosevelt ein Buch unter dem Titel: The Science of Government Foundes in Natural Law, (Die Art zu regieren, wie sie in den Naturgesetzen begründet ist). In diesem Buch stellt er Weishaupts Muster von der Ein-Welt-,UN’-Diktatur dar (aaO 110).
Die Geschichte erzählt uns, daß in der französischen Revolution von 1789 die führenden Männer Mitglieder von Weishaupts Illuminaten-Orden waren. Man muß sich an die Zeit erinnern, da einige mächtige Pariser Bankiers so rücksichtsvoll waren, die normale Ankunft der mit Ge-
255
treide und Lebensmitteln für Paris bestimmten Schiffe zu einer bestimmten Zeit zu verhindern, wodurch große Not und infolge der Hungersnot Unruhen in der Pariser Bevölkerung entstanden. Ganz augenscheinlich war diese Katastrophe im voraus geplant. Mit Sicherheit kann man wohl behaupten, daß das Opfer (das Volk) sie nicht geplant hatte.
Es ist interessant zu wissen, daß die Einwelt-Finanz überwiegend Woodrow Wilsons große politische Safari finanzierte und ihn sicher in das Weiße Haus lancierte. Daher war er für die Welt-Finanzmacht „ihr good man Friday” (Robinson Crusoe) und handelte weisungsgemäß. Unverzüglich zwang man ihn, anstatt der bisher geführten nationalen und nützlichen Außenpolitik unseres Landes eine internationale Politik zu führen, die Schulden mit sich brachte. Durch starken ausländischen Druck hat man es erreicht, unser Land in den ersten europäischen Weltkrieg hineinzulotsen. Die daraus entstandenen großen Kriegsgewinne fanden ihren Weg in die Koffer der Weltbankiers auf beiden Seiten der kriegführenden Mächte.
Nach der Rückkehr von der erfolglosen Friedenskonferenz in Versailles sagte Präsident Wilson: „In Europa gibt es eine geheime Macht, der wir unmöglich auf die Spur kommen können.” Nach meinem Empfinden verstand sein Berater, Oberst House, dies sehr gut und hätte der Sache leicht auf die Spur kommen können.
Während einer Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (66 Kongreß) fragte Senator McCumber Präsident Wilson: „Glauben Sie, daß, wenn Deutschland keine Kriegshandlungen oder kein Unrecht gegen unsere Bürger begangen hätte, wir dann trotzdem in diesen Krieg hineingezogen worden wären?”
Präsident Wilson: „Ich glaube es.”
Senator McCumber: „Sie sind also der Meinung, daß wir auf jeden Fall in den Krieg gegangen wären?”
256
Präsident Wilson: „Jawohl” (vgl. American Mercury, Sept. 1959, 20).
Wilson würde es niemals gewagt haben, den seinen Gönnern vor der Wahl zugesagten Verpflichtungen zögernd nachgekommen zu sein. Was kann uns wohl mehr Klarheit geben als diese Worte Wilsons, die zeigen, wie unser Land, auf unsere eigenen großen Kosten, aber mit großem Gewinn für andere, absichtlich in den Ersten Weltkrieg gesteuert wurde?
Es ist gut, daß man sich daran erinnert, was Lenin später sagte: „Durch den ersten Weltkrieg bekamen wir Rußland, durch den zweiten Weltkrieg werden wir ganz Europa in die Hand bekommen” (aaO 22). Wäre es möglich, daß Lenin im voraus gewußt hat, daß General Patton Berlin nicht nehmen durfte? Wäre es möglich, daß der C. F. R. schon im voraus alles so geplant hatte, daß wir den Zweiten Weltkrieg „verlieren” sollten? Möglich ist es ja, daß sie damals schon den Plan für die große „kein Gewinn-Politik” hatten. So scheint es wenigstens. Ich zitiere weiter: „Durch ihre List hat diese internationale Bande die Vereinigten Staaten in drei Weltkriege hineingestürzt, bei denen wir weder was zu suchen noch zu gewinnen hatten” (Vennard, aaO).
Um noch einige eindringliche Erklärungen über die Schutzherren des Kommunismus und der Weltregierung hinzuzufügen, möchte ich Dr. B. Bruce zitieren: „Die Illuminaten halten die Welt in wirtschaftlicher Sklaverei und diktieren durch ihre Geheimagenten die politischen Maßnahmen der Regierung.” Nachdem sie mit Hilfe des Sozialismus und Kommunismus beinahe alle gekrönten Häupter weggefegt haben, haben sie mit diesem oder jenem Mittel praktisch auch die Uraristokratie und die gesamte Führungsschicht ausgemerzt. Jetzt aber, da die Nationen durch Wuchereien versklavt worden sind, wollen die Direktoren die Organisation der Vereinten Nationen
257
dazu benutzen, um, wenn möglich, durch friedliche Methoden eine überstaatliche Einwelt-Regierung zu schaffen.
„… die Illuminaten beabsichtigen, den atheistischen Kommunismus und alle anderen ‘Ismen’ bis zum letzten auszunutzen. Nachdem aber die Illuminaten die Nationen in einen internationalen Staat eingepfercht haben, ist es ihr Ziel, ihren führenden König-Despoten der Welt zu krönen und so die Macht der Weltregierung an sich zu reißen” (B. Bruce. Constitutions be Damned, Boston).
Ich war baß erstaunt, als Nachrichten durchsickerten, daß Alger Hiss, einer der Hauptarchitekten der UNO-Charta, in einem geheimen Abkommen mit Molotow und anderen führenden Sowjets schon früher vereinbart hatte, daß der ständige militärische Führer der Vereinten Nationen stets ein Rotrusse sein sollte.
Wir sollten eigentlich sofort die Verbindungen mit dem ganzen UNO-Apparat und seinen dunklen Verbindungen abbrechen. Die folgenden Ausführungen entnehme ich dem Buch von H. L. Hunt „Jagd nach der Wahrheit”, S. 79: „Die UNO wurde in Wirklichkeit nicht erst mit Hiss und Harry Dexter White auf der Dumbarton-Oaks-Konferenz 1944 und auf der UNO-Tagung in San Francisco 1945 gegründet, sondern früher, als Roosevelt, Stalin und Churchill in Teheran zusammentrafen, um sich über gewisse Prinzipien zu einigen, aufgrund deren der ewige Friede gewonnen werden sollte. Die großen Drei trafen sich am 11. Febr. 1945 wieder in Jalta. Die amerikanische Delegation bestand aus dem Außenminister Stettinius, General George C. Marshall, Harry Hopkins und Alger Hiss mit Chip Bohlen als russischem Dolmetscher für Roosevelt.
In dem besonderen Telefonverzeichnis, das veröffentlicht wurde, um die private Verbindung der amerikanischen Delegation zu verheimlichen, hatte Präsident Roosevelt Telefon Nr. 1, Alger Hiss Nr. 4.
258
Um hinsichtlich der Wahlvorgänge zu einer Einigung zu kommen, zogen sich Präsident Roosevelt, Stalin, Stalins Dolmetscher und Alger Hiss zwecks einer Privatkonferenz zurück, wobei sie solche Persönlichkeiten wie Churchill, Stettinius und Marshall auf die kleinere Rolle verwiesen und sie draußen warten ließen. Dort durften sie sich dann überlegen, was wohl da drinnen geschah.
Schließlich erschien diese Clique wieder und verkündete, daß Rußland drei Stimmen in der UNO und die Vereinigten Staaten nur eine haben sollte. Als die anderen amerikanischen Delegierten gegen dieses Abkommen protestierten, soll Roosevelt geantwortet haben: „Ich weiß, ich hätte es nicht tun sollen, aber ich war so müde, als sie mich festlegten. Außerdem wird es nicht viel ausmachen.”
Zwei Monate und einen Tag später, nachdem sie bekommen hatten, was sie wollten, war er tot. Sie führen die UNO heute.
Ich wiederhole Senator McCarrens ernste Bemerkung: „Bis zu meinem Todestage werde ich es bedauern, daß ich für die UNO-Charta gestimmt habe.” Der große Senator erkannte zuletzt das ganze hinterhältige Manöver. Er war sich bewußt, daß er und auch andere im Senat durch die falschen Erklärungen von Leo Pasvolsky und Alger Hiss „überlistet” worden waren. Mit dieser Ansicht stand Mc-Carren nicht allein. Es ist erfrischend, von solcher Offenheit zu hören.
Es ist kein Wunder, daß General MacArthur und seine Truppen später durch dieses dunkle, unglaubliche militärische „Getue” in den Vereinten Nationen behindert worden waren, worüber die meisten Amerikaner arglos, uneingeweiht und falsch unterrichtet wurden und es auch heute noch sind. Damals hat es den Tod vieler amerikanischer Soldaten gekostet und ich frage jetzt klipp und klar, wie ist es heute damit? General MacArthur sagte: „Ich bin überzeugt, daß ich
259
meinen Abschied nur deswegen erhielt, weil ich im Januar, kurz vor meiner Ablösung anregte, ein Verhör wegen Landesverrat einzuleiten, um einen Spionagering aufzudecken, der für den Diebstahl meiner Höchst-Geheim-Berichte nach Washington verantwortlich war” (Vennard, aaO 136).
Man kann sich wohl nur schwer vorstellen, daß es einen Spionagering in Washington gibt, der seine höchst geheimen Berichte, in denen es sich um das Leben amerikanischer Soldaten handelte, gestohlen hat. Der berühmte General wurde entlassen, aber was geschah mit dem Spionagering? Arbeitet er heute in der NYC?
Zum zweitenmal sei ein Blick auf die Vereinten Nationen und ihre Förderer geworfen. Ich zitiere hier das erste und zweite Kapitel von „Erkenne die Vereinten Nationen”: „Wissen Sie, daß Stalin in Jalta, nachdem er von Roosevelt die Schaffung der Vereinten Nationen zugunsten des .Friedens’ verlangt hatte, als Gegenleistung für ,Hilfe’ im Zweiten Weltkrieg den von Alger Hiss aufgestellten Plan annahm? Und wissen Sie, daß Roosevelt darauf drängte, daß der Standort nicht auf amerikanischen Boden, sondern auf den Azoren sein sollte?” „Wissen Sie auch schon, daß die Vereinigten Staaten den Vertrag über die Vereinten Nationen unter falschen Zusagen ratifizierten, nämlich daß unsere nationale Landeshoheit, unsere Verfassung und unsere Flagge unverletzlich sein würden und daß der einzige Zweck Frieden wäre?”
Als ich über die UNO Auskünfte einholte, bekam ich nur einige nichtssagende, zurechtgemachte Antworten, wie etwa: „Sie wissen, daß die Charta der Vereinten Nationen das höchste Gesetz des Landes ist, weil es ein Vertrag ist, und Sie wissen auch sicher, daß es im Artikel 6 § 2 der Verfassung der Vereinigten Staaten eine Hintertür gibt.”
Jenes „Hintertür-Gerede” kam mir ziemlich fragwürdig vor bei allem Respekt vor der Beredsamkeit des verstor-
260
benen John Fester Dulles. Er war ein prominenter New Yorker Rechtsanwalt, ein eifriger Förderer und Makler der Interessen des internationalen Programms der C. F. R., eines Programms, das sowohl die Demokratische als auch die Republikanische Partei mit Gewalt hinunterschlucken mußten.
Ich wandte mich nun dem Artikel 6, S 2 in einer Abschrift der amerikanischen Verfassung zu und las. Dann habe ich ihn ein zweites und ein drittes Mal gelesen. Am nächsten Tag habe ich ihn wieder gelesen. Zur Erklärung dieses Artikels braucht man keinen auf seinen eigenen Vorteil erpichten Washington-Harvard-Rechtsanwalt. Er ist sehr klar geschrieben. Im Gegenteil, da gibt es kein „Schlupfloch”, Herr Dulles! Die große technische Lüge besteht vielmehr darin, es so oft wie möglich zu wiederholen, bis es am Ende plausibel klingt. So verhält es sich auch hier.
Artikel 6, § 2 besagt: „Diese Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten, die noch gemacht werden sollen und alle Verträge, die unter der Oberhoheit der Vereinigten Staaten gemacht worden sind oder noch gemacht werden, sollen das höchste Gesetz des Landes sein; die Richter eines jeden Staates sind daran gebunden, ungeachtet einer gegenteiligen Verfassung oder der Gesetze in irgendeinem Staat.”
Daher besitzen die Verfassung der Vereinigten Staaten, ihre Gesetze, die rechtskräftigen Verträge, also alle drei, höchste Geltung. Wie kann man daher, wenn man ehrlich sein will, nur eins von diesen dreien als letzten Maßstab bezeichnen? Eigentlich doch nur auf Kosten der beiden anderen! Das aber ist ganz unmöglich! Trotzdem versuchen es damit häufig solche Menschen, die betrügen wollen. Der manchmal zitierte Fall Fujii gegen Californien 1950 in ihrer Berufungsinstanz ist ein Beispiel dafür, daß ein betrügerisches „Bild”, das auf einer verfassungswidrigen Grundlage beruht, in einen anständigen „Rahmen”
261
gebracht worden ist. Die Charta der UNO ist also nicht das oberste Gesetz des Landes! Auf keinen Fall das der Vereinigten Staaten, die unser Land sind. Wiederum gibt es hier kein „Schlupfloch”!
Ein Vertrag wird als ein „formales” Übereinkommen zwischen zwei oder mehreren Nationen geschlossen im Interesse des Friedens, als Bündnis, zum Zwecke des Handels usw. Wenn daher ein Vertrag in irgendeiner Weise die in unserer Verfassung und in ordnungsgemäß erlassenen Gesetzen niedergelegten Rechte verneint oder verletzt, ist er offensichtlich ungültig, es sei denn, er wird durch einen besonderen verfassungsmäßigen Abänderungsvertrag bestätigt. Einige Bestimmungen der UNO-Charta greifen rigoros in unsere nationale Oberhoheit ein und sind daher verfassungswidrig. Man erinnert sich der Worte: „Gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation und es ist mir gleichgültig, wer die Gesetze macht.” Sind wir heute in dieser Lage, was die UNO angeht?
Wir müssen die Luft reinigen, einen Spaten einen Spaten nennen und Schritte unternehmen, um die Staaten von der UNO zu befreien.
Ein Bündnis mit ändern friedlichen Nationen aus objektiven Gründen zu haben, ist für die Vereinigten Staaten eine Sache für sich, aber in gemeinsame Aktionen mit einer Gruppe anderer zerstreut liegender Nationen aus subjektiven Gründen verwickelt zu sein, ist ganz etwas anderes. Ersteres zielt auf den Aufbau unserer Nation, während das andere ein auf uns gerichteter Dolch ist, der uns trifft, wenn wir ihn nicht abwehren. Vielleicht könnte ein unter Druck gesetzter, geschickter politischer Anwalt versuchen, uns aus dem Text die Worte am Schluß des Artikels 6, § 2, die sich auf die Verfassung irgendeines Staates beziehen, zu erklären und sie auf die erste Zeile anwenden, die sich auf die Verfassung der Vereinigten Staaten bezieht. Ein derartiges Verfahren würde aber nichts anderes bedeuten
262
als ein frecher Betrugsversuch an denjenigen, die nicht sorgfältig Artikel 6, § 2 gelesen haben. Demgemäß ist es mein Wunsch, den Irrtum jenes irreführenden Geschwätzes vom „höchsten Gesetz des Landes”, das so oft gedruckt und von dem so viel heimlich geredet wird, zu beseitigen.
Jeder Vertrag wie z. B. die UNO-Charta, der versucht, auf verschiedenen Wegen in unsere souveränen Rechte einzudringen, und damit unsere Verfassung bedroht, muß zur Sicherheit eine verfassungsmäßige Abänderung enthalten, um in den Vereinigten Staaten rechtskräftig sein zu können.
Diese gerissenen Verfechter der UNO für die Eine-Welt-Regierung über den Weg des C. F. R. wissen das natürlich, sie befürchten aber, daß bei einem offenen Vorgehen ihrerseits zugunsten einer verfassungsmäßigen Abänderung das amerikanische Volk ihnen eine vernichtende Niederlage bereiten würde. Sie würden 10:1 geschlagen werden.
Sämtliche amerikanischen Parteien sollten in ihr Parteiprogramm den Austritt aus der UNO mit aufnehmen und dann ihr Parteiprogramm trotz des starken Gelddruckes der Illuminaten und der C. F. R. auf alle unsere führenden öffentlichen Beamten zu Erfolg und Ansehen bringen. Selbstverständlich wird man versuchen, die UNO-Charta zu „modifizieren”, um ihr so mit Hilfe eines großen Pressetheaters neue, zweckmäßigere Satzungen zu geben. Doch würde ein derartiges Vorgehen Betrug auf Betrug und Irrtum auf Irrtum häufen. Dann würde ein „hohes Gebäude” unsicher auf einem wackeligen Fundament ruhen. Man könnte natürlich rechtzeitig eine bona fide-Weltgesellschaft für entsprechend objektive Zwecke im Interesse der Nationen gründen, ohne daß dabei nach einer engen Ein-Welt-Finanzmacht und nach politischer Kontrolle gestrebt wird. Die gegenwärtigen geheimen Förderer der UNO und ihre zahlreichen Satelliten würden allerdings
263
wohl niemals bereit sein, zuzustimmen, wenn sie nicht durch eine zornige und aufgebrachte Bürgerschaft dazu gezwungen werden würden.
Die UNO wird als ein „Albatros” beschrieben, der sich am Halse von Onkel Sam festgekrallt hat. In der Tat ist die UNO nichts anderes als die „Neue Geschäftsabteilung” für einige sehr große internationale Banken und Bankhäuser. Und sie funktioniert ausgezeichnet.
Im Jahre 1960 schickte ich folgendes Telegramm an den Präsidenten Eisenhower über UNO-Fragen in den Staaten:
„Philadelphia, Pa. 27. Sept. 1960
Präsident Dwight D. Eisenhower
Adr. Das Waldorf Astoria Hotel, Park. Ave. N. Y.
Bitte nachsenden: Das Weiße Haus, Washington, D. C.
Sehr geehrter Herr Präsident!
Im heutigen ,Inquirer’ lese ich, daß Sie Chruschtschow erklärt haben, daß die Vereinigten Staaten entschlossen sind, das Bestreben des Kremls, die Vereinten Nationen in eine Sowjetform zu pressen, mit aller Gewalt zu verhindern. Stop. Unter weniger ernsthaften Umständen könnte eine derartige Warnung an Chruschtschow etwas lächerlich erscheinen.
Ferner ist Ihr dargelegtes Ziel, lediglich die vom Kreml öffentlich erklärten Bestrebungen zu verhindern, in dieser Beziehung durch und durch negativ. Eine angemessene Stellungnahme in dieser Angelegenheit müßte aber positiv sein. Sie sollten ganz unmißverständlich die Auflösung der gegenwärtigen UNO, die sowieso jetzt nur noch ein sterbendes Sowjet-Etwas ist, fordern und stattdessen eine einwandfreie Weltvereinigung schaffen, und zwar ohne geheime militärische Abmachungen und andere Machenschaften, denn durch diese wird gerade den Sowjets und ihren Satelliten die tatsächliche dauernde Kontrolle über die Vereinten Nationen ermöglicht. Stop. Ihnen wird jetzt
264
sicher bekannt sein, daß aufgrund eines dem Kongreß wenig bekannten Geheimabkommens zwischen Alger Hiss, Molotow und Wyschinsky die Vereinten Nationen in einer Sowjetwiege geboren worden sind. Stop. Die heutige Not verlangt daher von Ihnen, Herr Präsident, eine starke, bejahende Führung und keine blasse Brüderschaft. Das Land verlangt es. Ergebenst
Curtis B. Dall
South Broad Street 123, Phila. 9, Pa.”
Darauf erhielt ich keine Antwort.
Uns ist allen bekannt, daß die Hochschulen sowohl in Amerika wie überall da, wo sie sich in hohem Maße Vorrechte erworben haben, wissen, wohin die Propaganda der Ein-Welt-UNO zielt. In dieser Beziehung schienen mir die nachstehend zitierten Einzelheiten nicht ganz einwandfrei.
Am 24. März 1964 berichtete die Princeton-University-campus-Zeitung in „The Daily Princeton” auf S. l: „Der amerikanische Gesandte bei den Vereinten Nationen, Adlai E. Stevenson, erklärte gestern Abend vor einem ausgesuchten Publikum in der Alexander-Halle, die einzig gesunde Politik für Amerika liege in einem geduldigen, unauffälligen und, falls erforderlich, einsamen Suchen nach den Interessen, die die Nationen einigen.” Und in dem folgenden Absatz steht: „Herr Stevenson erwähnt die Notwendigkeit, das Hauptproblem unserer Tage in die Hand zu bekommen.”
Zwei Absätze weiter führte der amerikanische Gesandte aus: „Der Soldat der UNO ist nicht dasselbe wie ein anderer Soldat. Er hat keine andere Mission zu erfüllen als den Frieden und keinen anderen Feind als den Krieg!”
Im ersten Abschnitt steht kurz zusammengefaßt: „Die einzig gesunde Politik für Amerika liegt darin, diejenigen Interessen zu koordinieren, die die Nationen einigen.”
265
Persönlich kann ich nicht mit dem Wunsch einer derartigen Politik für Amerika übereinstimmen. Ich habe gar kein Interesse an Interessen, die die Nationen vereinigen sollen, im Gegenteil, hier handelt es sich um die schamlose öffentliche Erklärung einer Untreue gegenüber Amerika. Ich liebe mein Vaterland und bin unserer verfassungsmäßigen Republik, den Vereinigten Staaten von Amerika, treu. Da es mein dringender Wunsch ist, mit allen ändern Völkern in guter Nachbarschaft zu leben und zu versuchen, ihre Probleme zu verstehen, habe ich gleichwohl nicht den geringsten Wunsch, mit vielen anderen Nationen „vereinigt” zu werden. Ich bin ein Amerikaner und dies allein bestimmt unsere Interessen. Unsere Vorfahren kamen hierher, um von den Bündnissen der Alten Welt loszukommen und neu anfangen zu können. Sollten wir „vereinigt” werden, dann würde unsere Zivilisation, würden Kultur und Erbe, wie wir sie gepflegt haben, durch eine plötzliche Entscheidung dieser obersten „Vereiniger” Hunderte von Jahren zurückfallen. Und das ist gerade das, was diese obersten UNO-Planer wollen. Betrachtet man jedoch ihr ganzes zwielichtiges Gerede nüchtern, so haben sie selbst gar nicht die Absicht, etwas zu riskieren. Glauben sie doch, daß sie mit Hilfe einer Weltrevolution auf den Flügeln ihrer Geldsäcke und ihrer Macht geschickt in eine neue Ein-Welt-Regierung fliegen können, während neunundneunzig Prozent bei uns es nicht können. Bauern sollen wir werden, nichts anderes als bessere Leihstücke in einer Ein-Welt-Richtungsschau. Das würde freilich eine „Schau” von kurzer Dauer sein, selbst dann, wenn sie mit einer ersten nach Verwesung riechenden Premiere beginnen und vor einem leeren Hause gespielt würde.
Um auf Adlai Stevensons Worte zurückzukommen, „das Hauptproblem in die Hand zu bekommen”, muß ich sagen, daß meiner Ansicht nach wir es nicht anpacken müssen, sondern selbst schon in den Klauen eines gut fundier-
266
ten „Hauptthemas” sind, nämlich des blendend organisierten C. F. R.-Ein-Welt-Konzerns. Für uns Bürger gilt .nur das eine, diese gefährliche Lage so schnell wie möglich zu erkennen, meinem vorher geäußerten Drängen nachzugeben und das in den „Sog” geratene Schiff der Vereinten Nationen zu verlassen.
Um auf Adlai Stevensons Wort zurückzukommen, der UNO-Soldat sei nicht wie alle anderen, so muß ich sagen: das stimmt, denn in Wirklichkeit ist er überhaupt kein Soldat, sondern ein Geheimpolizist der im Dienste der Bilderberger C. F. R. zum Krieg hetzenden UNO.
Ferner heißt es, er hat keine andere Mission als den Frieden. Wessen Frieden? Ist das der Friede des Illuminaten-königs-Despoten? Das ist wirklich die Kardinalfrage, wessen Frieden? In jenes eingebildete internationale Mosaik, in das vielleicht gerade die Amerikaner, wenn überhaupt, hineinpassen? Möglich, weil wir ein verwirrtes, benebeltes, wenn auch ganz unternehmungslustiges und arbeitsames Volk sind. Offenbar kann man sich auch auf uns verlassen, um von ändern zu deren großem Vorteil trocken gemolken zu werden.
Dieses ansprechende, aber mißbrauchte Wort „Friede” ist in Wirklichkeit die schönste Heuchelei. In dem Sinne, wie wir es einst verstanden haben, wird es heute nicht mehr gebraucht. In dem internationalen Vokabular über den Begriff „Frieden” bedeutet dieser, daß er unter ihren Bedingungen durch verschiedene Verfahren nach Art des trojanischen Pferdes zustandegekommen ist. Wenn man keinen Zweifel hegt, bedeutet das Ewiger Friede!
Zum Schluß heißt es: „Der Soldat der UNO hat keinen ändern Feind als den Krieg.” Ich bin der Meinung, daß die vollkommene Albernheit und Betrügerei dieser Behauptung eines bekannten Beamten der Vereinten Nationen, dazu noch eines Bürgers unseres Landes, keiner weiteren ernsthaften Erklärung bedarf!
267
Mit Bestürzung haben wohl die meisten von uns schon festgestellt, daß, wenn die Soldaten der UNO unter Leitung der C. F. R. kämpfen, sie in der Regel die Vertreter und Verteidiger des wirklichen Friedens angreifen und ausmerzen, nämlich die Anti-Kommunisten.
Für die C. F. R.-Förderer der UNO dient der Soldat der UNO nur dem Zweck, für ihre obersten Bankherren auf geradem oder auf schrägem Wege neue, an Bodenschätzen reiche Gebiete zu erwerben; der Öffentlichkeit ist natürlich davon nichts bekannt. Aus diesem Grunde schaffen sie eine neue „demokratische” Regierung mit einem neuen überwachten Geldsystem, um dann sofort Pläne zu schmieden, wie die Bodenschätze am besten auszubeuten und auf den Markt zu bringen seien. In Wirklichkeit ist das nichts anderes als eine gut organisierte Ausplünderung der zahlreichen unterentwickelten Völker, wozu auch schlecht unterrichtete Amerikaner gehören, die andrerseits die meisten Kosten für die Erwerbung jener neuen Märkte und Gewinne der obersten Besitzer der UNO zu tragen haben.
Es ist sehr zu bedauern, daß Adlai Stevenson diese falsche Propaganda vor jugendlichen Zuhörern wiederholt in seinem eigenen Lande vorgetragen hat.
Eine kurze, aber eindrucksvolle Widerlegung meinerseits gegenüber den genannten Behauptungen von Adlai Stevenson, die die Ein-Welt-Lehre vertreten, dürfte die Wiedergabe eines Verses von einem Lied sein, dessen Worte und Musik ich für die Klasse von 1920 schrieb, der ich angehörte. Ich glaube, daß dieses so manchen von der großen Princeton-Familie interessieren wird, die über das ganze Land zerstreut sind. Das Lied mit dem Titel „Ein Wiedervereinigungslied” hat drei Verse und einen Refrain. Der letzte Vers lautet:
268
Fremde Mächte bedrängen uns,
umgeben uns mit Dunkelheit,
werfen Brand auf unser Land
durch Betrug und Ränke.
Sammelt Euch um Gott und Land,
verteidigt Freiheit und Gesetz,
schmiedet ein Schwert für unser Volk
in den Hallen von Alt-Nassau!
Ich bin daher bereit, mein „Schwert” mit Adlai Stevenson und seinesgleichen zu kreuzen für die Studenten unserer Universitäten. Bindet den Helm fester!
General MacArthur wußte genau über diese schleimige Phrase „der UNO-Soldat” Bescheid. Erinnere dich an alles das, was er im Hinblick auf die UNO und auf andere, die unsere „Niederlage” wünschten, zu bewältigen hatte, um den Krieg zu gewinnen. Die Kosten für diesen „kleinen Krieg” beliefen sich auf ungefähr 145 000 Tote und zwanzig Milliarden Dollar. Sehr bald wird es noch mehr Kriege geben. Die Agentur der UNO und der C. F. R. sorgen schon dafür, denn dann werden neue Banken eröffnet, neue Währungen, neue Kredite geschaffen. Es gibt größere Anleihen für uns mit höheren Zinsen und neue Märkte für andere. Vielleicht wird mancher Leser versuchen, diese Ausführungen als übertrieben hinzustellen und davon abzulenken, um die dreiste Schuld der UNO hinsichtlich der Rechte und Oberhoheit Amerikas zu entschuldigen. Mir ist das ganz recht, denn ist diese Schuld der UNO nicht wirklich eine verbrecherische Handlung? Verrat ist „Landesverrat”; die Verfassung der Vereinigten Staaten (Artikel III, Abschnitt 3) besagt: „Hochverrat gegen die Vereinigten Staaten besteht allein darin, Krieg gegen sie zu führen oder ihren Feinden dadurch Beistand zu leisten, daß ihnen Hilfe und Unterstützung gewährt werden.”
269
In der Beihilfe für unsere Feinde, um ihnen Hilfe und Unterstützung zu gewähren, ist die UNO als ein gut organisiertes und geschütztes Nest von Spionen beschrieben worden. J. Edgar Hoover hat in dieser Beziehung einige treffende Äußerungen von sich gegeben.
Beim Lesen des Buches „Rote Spione in der UNO” wurde meine Aufmerksamkeit auf ein Bild gelenkt, das meine frühere Schwiegermutter Eleanor Roosevelt zeigt, wie sie an der Spitze einer feierlich aufgestellten UNO-Delegation Konstantin Zinchenko von den Sowjets zu seiner Ernennung zum stellvertretenden Leiter der Vereinten Nationen strahlend begrüßte. Einige Jahre später, als General Mac Arthur ihn anklagte, unseren Feinden zu helfen, entrann er mit Mühe und Not der F. B. L, floh nach Rußland, um dort über das Spionagenest der UNO seine Spionage fortzusetzen.
An der gesamten UNO-Niederlassung in New York City finde ich nur eines ganz nett, und das ist das farbenfrohe Bild der Fahnen vieler Nationen. Wenn an einem schönen Tag diese Fahnen im Winde flattern, bringen die Eltern ihre kleinen Kinder von überall her, um sie. zu sehen. Vor Begeisterung klatschen sie in ihre kleinen Hände.
Das ist ein wohl überlegter malerischer äußerer Anblick des UNO-Gebäudes. Innen jedoch schwirren die Vertreter der subventionierten freiwilligen Mitglieder-Nationen umher und erwarten das von der UNO prophezeite Kommen des von ihr durchgeführten „Friedens”, und zwar jenes Friedens einer gottlosen Diktatur der einen überstaatlichen Finanzweltmacht.
Wenn ein derartiger Tag einmal kommen würde, dann würde unsere gesamte persönliche Freiheit, unsere Religion und unser Recht keine Rolle mehr spielen.
270
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Konservative, Liberale und die übrigen
Der Schritt in ein neues Leben begann für mich in vieler Hinsicht an einem Februarmorgen 1946.
Beim Pentagon stieg ich in einen Luftwaffenbus nach Andrews-Fields, um mich wieder einer bürgerlichen Tätigkeit zuzuwenden. Nach Unterzeichnung eines Haufens Papiere war ich einige Stunden später aus dem aktiven Dienst entlassen, gehörte jedoch weiterhin der Luftwaffenreserve an. Im Zweiten Weltkrieg war ich nicht in Übersee gewesen wie im Ersten Weltkrieg, sondern oblag meinen dienstlichen Pflichten in Harrisburg Cincinnati, Ft. Leavenworth und im Büro des stellvertretenden Oberbefehlshabers im Luftwaffenhauptquartier im Pentagon, eine sehr interessante Stellung, und alle diese Anstrengungen galten einem aus der Fassung gebrachten backenbärtigen alten Herrn, Onkel Sam.
So sagte ich an jenem Morgen allen „Arbeiten” ein Auf Wiedersehen und erinnerte mich an alle jene anständigen Amerikaner, denen ich während meiner Zeit begegnet war, wie zum Beispiel die Generale Larry Kuter, Lauris Norstad und zahlreiche andere, die einen weniger hohen Dienstgrad hatten: „Smorky” Caldara, „Sunny” Whitney, Pete Hamilton, Johnny Wack, George Carey, Harvey Gram, Ed Leland, Joe Halverson; in der Armee Courtney Whitney; in der Marine mein Freund Admiral Zackarias, von mir kurz „Zack” genannt. Er wurde von unserm Verteidigungsminister James V. Forrestal, dem besten Staatsmann unserer Zeit, vorzeitig vom Vierstreifen-Admiral zum Konteradmiral befördert.
271
Als ich an jenem Morgen das Pentagon verließ, sagte ich im Gedanken an einen besonders guten Freund, einem besonders hervorragenden Fliegeroffizier aus Lancaster in Pennsylvanien, General Joe Lutzenheiser, ein besonderes „au revoir”. Joe hatte gerade kürzlich jene auserwählte und tapfere Gruppe alter Krieger bei einem Zusammentreffen getroffen, bei dem die Tapferen immer wieder zusammenkommen, um die Erinnerungen an die alten Zeiten unter dem Schütze unserer Fahne Wiederaufleben zu lassen.
Kurz darauf erhielt ich den allgemeinen „Dankesbrief” an die Soldaten von Präsident Truman. In Wirklichkeit wäre es richtiger gewesen, wenn mir und so vielen ändern dieser Dankesbrief von Stalin und seinen Günstlingen aus zugegangen wäre, der von der amerikanischen Armee die Erlaubnis hatte, bis nach Mitteleuropa einzumarschieren, wobei sie von den betrogenen und überarbeiteten amerikanischen Steuerzahlern unterstützt wurden.
Nach einigen vergnügten Monaten in Baltimore fuhr ich mit meiner Familie nach San Antonio in Texas, wo für mich ein neuer Lebensabschnitt begann.
Der Lone Star Staat schien mich einzuladen. Meine alte Gesellschaft, „Die Tennessee Gas & Transmission Company” hatte sich weiter entwickelt. Ihre neue Geschäftsleitung indessen schien nicht die Notwendigkeit zu empfinden, die Dienste ihres Gründers in Anspruch zu nehmen. Es war etwas enttäuschend, aber vielleicht auch verständlich.
Texas ist groß. Wenn man Texas auf der Karte überschaut, sieht man, wie es sich nördlich bis Kanada ausbreitet und im Osten von Louisiana bis westlich nach Colorado und Neu Mexico. Wenn man in diesem Staate lebt, werden einem schon nach kurzer Zeit die großen Unterschiede in Kultur, Anschauung und Interessen bewußt, die sich in den großen, weiten Räumen dieses Landes wider-
272
spiegeln. Man konnte nicht lange die Blashörner vom Zapfenstreich und von der Parade vom Ft. Sam, Housten, hören, um die großen Weiten von Texas zu erkennen, ohne sich dabei bewußt zu werden, daß ein großer Teil dieses großen Landes noch nicht unter der Kontrolle der großen politischen Stadtbonzen in Chicago, New York, Detroit, San Francisco und Philadelphia stand.
Als ich langsam dieses wahre Bild erfaßte, und zwar wirklich so langsam, daß es mir selbst kaum bewußt wurde, wurde ich politisch konservativ.
Lange Zeit hatten mich zahlreiche Ereignisse und politische Maßnahmen, die aus der auch heute noch sogenannten Demokratischen Partei stammen, vor ein Rätsel gestellt. Häufig hatte ich das Empfinden, daß in meinem Denken irgendetwas nicht mehr ganz stimmte. Der einzige Kummer war jedoch, daß ich nicht früher gedacht habe. Lange Zeit hatte ich geglaubt, daß Roosevelt viele Gedanken und Ideen aus sich selbst heraus zum Wohle seines Vaterlandes, der Vereinigten Staaten, entwickelt hatte. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Der größte Teil seiner Gedanken, seiner politischen „Munition” sozusagen, wurde sorgfältig für ihn im voraus von der C. F. R.-Einwelt-Finanzmacht-Gruppe zurechtgemacht. Glänzend, mit großem Schwung, wie ein schönes artilleristisches Schaustück, trug er mit Begeisterung diese vorbereitete „Munition” mitten in ein argloses Ziel, in das amerikanische Volk hinein. Auf diese Weise bezahlte er und erhielt sich auch gleichzeitig dadurch die internationale politische Unterstützung. Vielleicht ahmte er in dieser Hinsicht übertrieben Wilson nach und verfiel so bereitwillig der Einwelt-Finanzintervention und dem Betrug der Vereinten Nationen. Nach meiner Ansicht hat er diese Hilfe mehr aus praktischen Gründen angenommen, um für sich selbst eine größere persönliche und politische Macht zu gewinnen und zu erhalten. Mancher andere hat seine Meinung über diese Frage besser in
273
Worten ausgedrückt, als ich es kann. Vielleicht aber war meine Treue zu Roosevelt zu stark verwurzelt und zu fest. Mit einer klareren Auffassung wurde ich mir erst später dieser schrecklichen Erkenntnis bewußt, jedoch auch über einen langsamen und schmerzhaften Weg.
Ich zitiere hier einige gut bekannte Persönlichkeiten: „Es besteht wohl kein Zweifel mehr, daß der Zweite Weltkrieg zu Folgerungen führte, die gänzlich im Gegensatz zu dem Ziel standen, das von Präsident Roosevelt verkündet worden war. Es bedarf daher wohl dringend einiger Erklärungen, um sie unbedingt dem getäuschten und • ernüchterten Volke vorzutragen” (George N. Crocker, Roosevelts Road to Russian, Chicago 1959). Sicher gehörte ich auch zu dieser „Menge”!
„Man muß sich daran erinnern, daß Roosevelt uns den Krieg aufzwang oder zum mindesten die amerikanische Beteiligung daran, wobei er sich bei der Führung des Krieges mit der Wucht und impertinenten Sicherheit eines Hausierers unentbehrlich machte” (aaO IX). Es heißt dann weiter: „Es ist eine traurige, ja zeitweilig schmutzige Geschichte. Die Vereinigten Staaten hatten keinen gelehrten Philosophen wie Talleyrand, der die Eleganz mit leidenschaftlicher Liebe zu seinem Vaterland verband, um ihn nach Kairo, Teheran und Jalta zu schicken. Wenn sie jedoch einen Talleyrand gehabt hätten, so hätten sie ihn nicht geschickt. Es war auch kein Woodrow Wilson da, der bei den Massenvertreibungen hilfloser Bevölkerungsmassen vor Scham errötete … die geheimen Abkommen, die heuchlerischen Berichte; noch war ein Theodore Roosevelt da, der bei Unterredungen mit Stalin oder mit dem amerikanischen Volke Nägel mit Köpfen gemacht hätte” (aaO XIII).
Sicher hat uns Roosevelt mit dem Krieg verraten, aber zu wessen Vorteil? Weiterhin heißt es: „Roosevelt hat weder damals noch später das Jalta-Abkommen der gesetzmäßi-
274
gen Körperschaft der Regierung als Vertrag vorgelegt. Augenscheinlich war er nicht daran interessiert, ihn als Vertrag zu behandeln” (aaO 2). Was bedeutet das? War das legal?
Vielleicht haben seine Berater, aus Furcht vor einer möglichen Nichtratifzierung seitens des Senats, ihm befohlen, den Vertrag nicht dem Senat vorzutragen. Vielleicht lebte in ihm das „L’Etat c’est moi”, und das genügte ihm, um total seine Macht auszuüben und die amerikanischen Bauern zufrieden zu stellen.
In der ihn stark beherrschenden Absicht, alles richtig zu machen, ist er wesentlich durch Harry Hopkins (Baruchs Mann), dessen ausgesprochene Geringschätzung für das amerikanische Volk bekannt war, ermutigt worden. Es “Heißt weiter: „Es war auch Roosevelt, der 1945 absichtlich solche Männer wie Harry Hopkins und Alger Hiss (keinen patriotischen Talleyrand) mit sich um die halbe Welt bis nach Rußland nahm, um mit Stalin zu reden und die Sowjetunion zu bestechen, in den Krieg mit Japan einzutreten und gerade noch rechtzeitig die Frucht des Sieges zu pflücken” (aaO 4). Warum? „Es besteht kein Zweifel, daß Roosevelt während des ganzen Krieges entschlossen war, die Wahrheit über unsere Beziehungen mit Sowjet-Rußland nicht bekanntzugeben” (aaO 10).
Es ist daher kein Wunder, daß Roosevelts persönlicher Marine-Attaché in Istanbul, George Earle, vergeblich gegen eine „CFR-Mauer” und gegen den finsteren baruchschen Blick im Weißen Haus anrannte bei seinem Bemühen, Roosevelt dahin zu bringen, den Zweiten Weltkrieg in seiner ersten Phase aufzuhalten. Kommander Earle hat mir das selbst berichtet. Es hätten eine Million oder vielleicht noch mehr Tote und unzähliges Leid vermieden werden können. Aber was bedeutet schon für Stalin und seine New Yorker Finanzmacht eine Million tote Amerikaner?
275
Ich zitiere hier Sherwood: „Ich war erschrocken über sein (Roosevelts) Aussehen … der Minister Stimson war über _ den geistigen und körperlichen Zustand des Präsidenten erschüttert. In sein Tagebuch vorn 11. September, am Tag vor der Quebec-Konferenz schrieb er: ,Ich bin über den physischen Zustand des Präsidenten sehr beunruhigt .. ich habe große Sorgen, wie diese schwere Konferenz sich auf ihn auswirken wird. Ich bin besonders beunruhigt … daß er dort hingeht, ohne überhaupt für die Lösung des Problems, wie Deutschland behandelt werden soll, vorbereitet zu sein. So weit wir aus seinen Worten entnehmen konnten, hat er sich überhaupt nicht mit dem sehr schweren Problem, über das wir zu entscheiden haben, beschäftigt”‘ (aaO 233). Weiter heißt es: „Dies war der Mann (Harry Dexter White), der den sogenannten Morgenthau-Plan für Henry Morgenthau jr. ausgearbeitet hatte. In diesem Plan wollte man aus Deutschland ein Agrarland machen. Er sollte die Krönung alles Erreichten auf der zweiten Konferenz in Quebec darstellen. Daß der Präsident der Vereinigten Staaten in diese durchsichtige kommunistische Falle geriet, zeigt, mit welcher Unverantwortlichkeit er in den letzten Monaten des Krieges die amerikanische Außenpolitik leitete” (aaO 230). „Natürlich begrüßten Harry Dexter White und seine sowjetischen Antreiber den ,Morgenthau-Plan’, weil dadurch die westeuropäische Wirtschaft zerstört werden würde. Es war Überdies ein Teil des militanten Kommunismus” (aaO 232).
Die Worte „Die durchsichtige kommunistische Falle” sind kennzeichnend genug, um mich zu veranlassen, Henry Morgenthau jr. zu seinem bemerkenswerten Scharfblick und seiner und Harry Dexter Whites so lebhaft bekundete Teilnahme am Wohlergehen des amerikanischen Volkes zu gratulieren. Weiter: „Wir wissen, daß Minister Hüll und Kriegsminister Stimson über diese schändliche Konferenz
276
in Quebec im Sept. 1944 von Grauen erfaßt worden waren” (aaO 228). Er fährt dann fort: „Herr Goebbels sagte mit vollem Nachdruck: ,Wenn das deutsche Volk seine Waffen niederlegen würde, würde der Vertrag zwischen Roosevelt, Churchill und Stalin den Sowjets die Möglichkeit geben, ganz Ost- und Südosteuropa zusammen mit einem großen Teil des Reiches zu besetzen. Ein eiserner Vorhang würde sofort auf dieses Gebiet niedergehen … und unter diesem Vorhang würde eine Massenschlächterei des Volkes vor sich gehen … alles, was dann übrig bleiben würde, würde eine primitive, stumpfsinnige und gärende Menschenmasse sein von Millionen Proletariern und verzweifelten Lasttieren'” (aaO 279).
Indem ich nochmals auf die von Roosevelt in Jalta getroffenen unglücklichen Entscheidungen hinweise, Stalin aus noch nicht geklärten Gründen zu versorgen, und auch im Hinblick darauf, daß der Glaube der Menschheit an Amerika verschwunden ist, zitiere ich weiter: „Letzten Endes war dies wohl der tragischste und schlechteste Dienst, den Roosevelt seinen Landsleuten erwiesen hat” (aaO 280). Wir wissen alle genau, daß die Politik von der Zweckmäßigkeit bestimmt wird. Die meisten von uns haben schon das Sprichwort gehört „Weß” Brot ich eß, deß’ Lied ich sing”. Beim Überschreiten der Grenzen der „Zweckmäßigkeit” taucht sichtbar in der Ferne der Landesverrat auf.
Als Harry Hopkins, in der „Blüte seiner Jugend” ein unbekannter Angestellter bei der Fürsorge, eine freche Bemerkung machte, daß die Amerikaner viel zu dumm wären, um zu verstehen, was geschehe, machte er ihnen unwissend ein großes Kompliment. Fraglos sind die Amerikaner, als Volk gesehen, auch heute noch gar nicht darauf vorbereitet, den großen Betrug zu erkennen und zu erfassen, der von Männern in führenden Stellungen, die die Politik bestimmen, an unserm Vaterlande begangen wor-
277
den ist. Auf jeden Fall war ich sicherlich dumm! Aber was soll man machen, um so etwas zu ändern? Was sollte man tun, um unser unübertroffenes Erbe der nächsten Generation weiterzugeben? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil wir unter der Finanzierung der Schulden beinahe zusammenbrechen und viele Fremde unter uns aufgenommen haben, die garnicht an uns interessiert sind, sondern im Gegenteil, aus verschiedenen Gründen den Wunsch haben, unsere Gesellschaftsordnung zu zerstören. Warum sollte diese große Nachsicht unsererseits diese ausgesprochene Intoleranz noch so lange ertragen? Der Standpunkt der Amerikaner muß unbedingt erhalten bleiben. Natürlich ist in allen diesen Jahren die Frage nach den „Roosevelts”, dem Weißen Haus, Baruch, Felix Frankfurter, Henry Morgenthau jr. und verschiedenen ändern Persönlichkeiten, die in Zusammenhang mit Roosevelts verlängerter Amtszeit in Washington standen, an mich gerichtet worden. In der Regel waren diese Fragen taktvoll gestellt, oft jedoch waren sie auch grob, plump und ärgerlich. Da war ich dann natürlich auch plump, wenn die Lage es verlangte. Sehr bald entwickelte ich eine besondere Technik, die, mit einem einfachen „Ausweichen” verbunden, in einer unklaren Antwort bestand. Vieles, was Jimmy, Elliot und Franklin jr. taten, schien viel Neugier und zeitweise auch viel Kritik hervorzurufen. Meine Antwort war dann nur: „Ich weiß auch nicht mehr als das, was in der Zeitung steht”, oder: „Ich habe die Jungens eine Ewigkeit lang nicht mehr gesehen”. Das war auch wahr. Der Vergangenheit gegenüber habe ich stets versucht, ihr objektiv zu begegnen.
Die Zukunft stellte viele neue Anforderungen an mich. Daher schaue ich auch vorwärts und erinnere mich immer an die Worte: „Die Vergangenheit ist erst das Vorspiel.” Natürlich hat man mir viele „Steine” in den Weg gelegt, weil ich der sogenannten Demokratischen Partei und ihren
278
CFR-Einwelt-Finanzberatern den Rücken drehte. Ich dagegen bin der Meinung, daß die Demokratische Partei mir, einem konservativen amerikanischen Wähler, „den Rücken drehte”.
Heute bedeutet das Schicksal unserer Nation für mich viel mehr als eine falsch benannte Partei, die eine uns fremde Politik betreibt und unsere Stimmen „kauft”, natürlich mit unserm eigenen Geld.
Viele Leute sagen, es sei „unmöglich”, eine „dritte Partei” ins Leben zu rufen, und zwar wegen der Kosten, die bei der Verwaltung einer derartigen Organisation entstehen. In mancher Hinsicht trifft das zu. In Wirklichkeit jedoch würde eine „dritte Partei” nur die zweite Partei sein, da beide Parteien, sowohl die Demokratische wie die Republikanische, von der Einwelt-Finanzmacht und der Einwelt-Machtgruppe gelenkt werden.
Es gibt eine ganze Menge Menschen, „die nach einer Reform” innerhalb der Struktur einer großen Partei streben. Mag sein, aber wenn man alle die falschen Bilder, die zurechtgemachten Nachrichten und den Betrug sieht, der täglich dem Volk von „oben” vorgesetzt wird, so muß man zugeben, daß dieser Weg mit Dornen übersät ist. Die Anhänger der Republikanischen Partei könnten sich theoretisch im Interesse ihres Landes für die notwendige Reform einsetzen. Bedauerlicherweise scheinen sie an einer politischen Kehlkopfentzündung zu leiden.
So hängt die Zukunft der jungen Amerikaner jetzt in der Luft. Bevor es nun den Finanzmächten möglich ist, die beiden einstmals großen Hauptparteien unserer konstitutionellen Republik einzuschüchtern, sollte es für unser Volk die einzig richtige Wahl zwischen einer konservativen und einer liberalen Partei geben, wenn möglich, eine liberale Partei, die von keinem einweit-sozialistischen Kommunismus angesteckt ist. Zweifellos werden die Berufspolitiker, wenn sie das lesen, geringschätzig lächeln
279
und gähnen, aber das stört mich gar nicht. Bekanntlich haben die dreizehn Kolonien unserer konstitutionellen Republik ganz klein angefangen, genau so wie die Republik von Texas. Es waren gottgläubige, charaktervolle Menschen, die sie aufgebaut haben. Für unsere Nation wird es höchste Zeit, daß sie sich sowohl einen reinen politischen Kragen wie auch ein reines politisches Hemd anzieht, das nicht mit dem politischen B. O. überladen ist und dem der Korruptionsgestank von Washington nicht anhaftet.
Wenn wir das nicht bald tun, werden wir auch bald kein „Hemd” mehr anzuziehen haben.
Zweifellos werden einige rechtzeitig Auserkorene der „Bildmacher” auftauchen, um einiges in diesem Buch zu widerlegen, weil sie den Bildmachern nicht angenehm sind, und zwar mit dem Ziel, mich zu verleumden. Das ist ganz verständlich. Ich hoffe jedoch, daß diese Verleumdungskampagnen von vorne kommen und nicht von hinten, wie es meistens geschieht.
Ich habe „Goliath” hier beschrieben und sozusagen „einen Stein” für Goliath gemeißelt, der genau mitten in das Ziel treffen soll: Der Federal Reserve Board mit seinem neuen dunklen, internationalen Gegenstück The Council on Foreign Relations (CFR), Prinz Bernhards weitverbreitete Bilderberger Gruppe und zuletzt ihre verrufenen Handlanger, die sich selbst als Vereinte Nationen bezeichnen.
Man wird mir recht geben, daß das ein Ziel von beträchtlicher Größe und Macht ist, sicherlich ein seltenes Ziel. Aber warum nicht? Zumal da ich nur einen „Stein” besitze, den ich werfen kann. Jeder Mensch besitzt einen Stein. Darin liegt ja die Stärke so vieler souveräner Bürger, besonders, wenn sie sehen, daß ihnen nur zwei- oder dreihundert Menschen feindlich gegenüberstehen.
Zur Zeit hat die internationale Finanzmacht Erfolg, indem sie sich weit hinaus vor das Volk gewagt hat. Jedoch rennt sie um ihr Leben, denn sie hat Angst wegen ihrer
280
Untaten und sieht einer lange überfälligen notwendigen Reform entgegen.
Darf ich eine Warnung hier aussprechen, damit wir nicht wieder auf die Meldungen hereinfallen, die besagen, daß hier und dort von den Agenten der Bildmacher öffentliche Denkmale errichtet und Belohnungen erteilt werden, um ihre Erkorenen mit Ehren zu überhäufen, damit die gegenwärtige und zukünftige Generation zum Narren gehalten wird. Für Wilson schlage ich ein öffentliches Denkmal vor zur Erinnerung an ein äußerst wichtiges Ereignis im Dezember 1913, als er durch ein Gesetz den falsch unterrichteten Kongreß in die bereits wartenden Klauen der im Privatbesitz befindlichen Federal Reserve Bankgruppe mit ihrem einflußreichen Aufsichtsrat übergab, die auf billige Art und Weise unser eigenes Geld drucken ließ, dabei selbst Milliarden machte und dann unsern eigenen Kredit mit Zinsen belastete. Eine unglaublich kostspielige Operation, die selbst intelligente Menschen kaum vertragen können.
Für sein unaufhörliches Bestreben, unser Land in diese Verworrenheit des europäischen Krieges zu stürzen, große Schulden und Verluste auf unser Land zu häufen, nur um eine persönliche, vor der Wahl gemachte politische Schuld zu bezahlen, müßte ihm noch eine weitere öffentliche Anerkennung zuteil werden.
Es gibt Leute, die der Ansicht sind, daß diese beiden vorher erwähnten Leistungen während seiner Regierungszeit am besten gekennzeichnet sind, wenn sie irgendwo in einem tiefen muffigen Loch begraben werden, wo der Grund nicht mehr zu sehen ist, falls ängstliche Amerikaner hinunterspähen, um nach Freunden zu suchen. Dieses tiefe Loch würde die Ergebnisse von Wilsons katastrophaler, doppelzackiger Finanz- und Außenpolitik widerspiegeln. Über die Berechtigung eines öffentlichen Denkmals für Roosevelt besteht gar kein Zweifel mehr, zumal da dieses
281
schon in Washington besprochen worden ist. Wie dem auch sei, am Ende seiner politischen Regierungszeit standen sich die Amerikaner verhältnismäßig viel schlechter als die hochgestellten Helfer und Berater, die immer fetter und mächtiger wurden, weil sie ja in jenem Zeitraum weiterhin ihre eigenen weltumfassenden Ziele erfolgreich fördern konnten. Daher die Frage, was für eine Art politischen Denkmals?
Der bedeutende englische Schriftsteller A. K. Chesterton schreibt im Blick über die weltumfassenden Ziele. Ich zitiere aus seinem aufschlußreichen und glänzend geschriebenen Buch „The New Unhappy Lord”: „Die letzte Szene von Bretton Woods, in der die Weltbank und der internationale Währungsfonds eingerichtet wurden, die Dumbarton Oaks-Konferenz, die die Vereinten Nationen und ihre Agenturen schuf, sowie die Havanna-Konferenz, in der ein gemeinsames Übereinkommen für Zölle und Handel zustande kam, und viele ähnliche Zusammenkünfte zwischen ganz besonders ausgesuchten Funktionären, war nicht durch die im Kriege befindlichen, schwer bedrängten Regierungen ausgebrütet, sondern durch eine übernationale Finanzmacht, die es sich erlauben konnte, vorwärts zu schauen, um die Nachkriegswelt so zu gestalten, daß sie ihren Interessen entsprach” (A. K. Chesterton, The New Unhappy Lord, London).
Obgleich Roosevelt geschickt allem auswich, zugleich aber den vorbereiteten Plan der Weltfinanzmacht, der den Staatsbürger seiner Goldreserve berauben sollte, erfüllte, wurde er von der breiten Aussicht unserer so benannten Außenpolitik immer stärker gefangengenommen. Er wurde dadurch auf einen Sockel gestellt, der es ihm ermöglichte, laufend politisch im Vordergrund zu stehen. Nach Ansicht vieler Menschen war das wichtigste Ereignis in seiner Regierungszeit „Pearl Harbour”! Dieser tragische Vorfall spiegelt so einige auf weite Sicht vorgenommene
282
Ziele jener wider, die die Außenpolitik Roosevelts manipulierten. Sie hatte ja auch wirklich einen merkwürdigen Beigeschmack. Trotzdem stellte sich Roosevelt bereitwillig in den Mittelpunkt.
Wir wollen hier einmal ein dubioses Bild betrachten und dabei einige juristische „Spitzfindigkeiten”, die pflichtgemäß von dem Richter Roberts in seinem „Pearl-Habour-Bericht” aufgeführt worden sind, weglassen. Bezüglich der Schuldfrage deutet seine „Inspiration” in die falsche Richtung.
In vieler Hinsicht zeigen die im einzelnen recht interessanten Punkte des „Roberts-Berichtes” über Pearl Harbour ähnliche Merkmale wie der „Bericht” des Richters Earl Warren. Es soll bei den Amerikanern der Eindruck erweckt werden, daß sie in jeder Weise über die Mächte unterrichtet worden sind, die die tragische Ermordung des Präsidenten Kennedy in Dallas bewerkstelligten. Die meisten Amerikaner haben aber das Empfinden, daß der „Warren-Bericht” in seiner Darstellung viel zu knapp ist, sofern man über sämtliche Tatsachen hatte berichten wollen. Dabei sind aber angeblich einige sehr wichtige politische und ideologische Gesichtspunkte unter den Tisch gefallen.
Wenn auch die tiefsten Sympathiegefühle und das Verständnis für die persönliche Trauer und Leiden der Kennedy-Familie zum Ausdruck gebracht worden sind, so wird es doch immer klarer, daß die amerikanische Öffentlichkeit verlangen kann, besser über die Ermordung ihres Präsidenten unterrichtet zu werden als nur über das, was in dem „Warren-Bericht” steht. Im Hinblick darauf, daß laufend immer mehr Tatsachen hierüber ans Licht kommen, und auf die hastigen Bemühungen einiger Beamter in Washington, gewisse Akten im „Archiv” zu begraben, ist eine Untersuchung des Kongresses über die ganze Angelegenheit unbedingt notwendig.
283
Aber haben wir eine anständige Regierung? Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir keine Regierung, sondern eine von einer Mißgestalt überschattete Demokratie. Mag man es noch so schön bemänteln, es bleibt immer nur ein armseliger Ersatz für die Wahrheit, auch wenn es sich um die wichtigen Ereignisse in Dallas oder in Pearl Harbour handelt.
Die Erklärungen von Admiral Kimmel, damals kommandierender Offizier in „Pearl Harbour”, zielen geradeswegs wie ein Donnerschlag auf diesen Punkt hin: „Roosewelt und die Großbetreßten haben absichtlich die amerikanischen Streitkräfte in Pearl Harbour verraten” (vgl. News Week v. 12. Dez. 1966, S. 40).
Ferner: „Roosevelt war der Architekt der ganzen Sache. Er gab die Befehle. Ich kann es nicht bestimmt beweisen, daß über die japanischen Flottenbewegungen keine Mitteilung nach Pearl Harbour geschickt worden ist, außer durch Marshall, und dann wurde Marshall angewiesen, nichts zu berichten” (vgl. New York Times v. 7. Dez. 1966, S. 22). Niederschmetternd!
Es wird daher ein öffentliches Denkmal für Roosevelts Außenpolitik vorgeschlagen. Sie hat so treffend die weitgesteckten Ziele der Experten von Baruchistan widergespiegelt. Ganz offiziell in Pearl Harbour und nicht in Washington, nicht in Moskau und nicht in London sollte man dieses Denkmal errichten. Da liegt der Rumpf des gesunkenen Schlachtschiffes „Arizona”, umspült von der See. Es protestiert schweigend gegen den Verrat, ebenso das erschütternde Grab von tausend Amerikanern, das so plötzlich für sie geschaffen wurde, aber nicht durch Kampf für ihr Vaterland, sondern durch Verrat. Man betrachte dieses hervorstechendste Denkmal Rooseveltscher Außenpolitik und seiner geheimnisvollen Produzenten! Es ist für uns alle ein so ungeheuer beredtes Denkmal, das alle Reden des Demosthenes übertrifft.
284
Professor Dr. DAVID L. HOGGAN
Der erzwungene Krieg
Die Ursachen und Urheber des Zweiten Weltkriegs
Neunte Auflage
936 Seiten, mit 53 Seiten Quellen- und Literaturverzeichnis sowie Abbildungen und Karten, 2 Bände in einem Band, Ganzleinen DM 48,-
Das deutsche Volk wird nun endlich erfahren, wie und warum es Anfang September 1939 zum Kriege kam und großen Gewinn aus dieser ebenso sensationellen wie umwälzend neuen Informationsquelle ziehen können, zu der man ihm über zwei Jahrzehnte lang den Zugang verwehrt hat.
Prof. Dr. Harry E. Barnes, Malibu, California
Wir haben Hoggan für sein Werk zu danken, und auch die Verächter Hitlers sollten einer Leistung, die mit wissenschaftlicher Sorgfalt, seltener Noblesse und beispielhafter Gerechtigkeit von einem Amerikaner für Deutschland vollbracht wurde, ihre Achtung nicht versagen.
Dr. F. Thieß, Vizepräsident der Akad. d. Wissenschaften u. der Literatur
Ein Werk wie das Hoggans will mit Abstand und Kühle betrachtet sein. Es sollte vor allem aus dem Streit politischer Meinungen herausgehalten werden. Es wäre unerwünscht, wenn daraus ein nationalistischer Propagandaschlager gemacht werden sollte. Aber ebenso unerwünscht wäre es, wenn das Werk nur deshalb verworfen werden sollte, weil es in das zur Zeit gängige Konzept der Meinungsbildung in der Bundesrepublik nicht zu passen scheint. Die Auseinandersetzung über die verschiedenen Probleme des Zweiten Weltkrieges hat in der Geschichtswissenschaft noch kaum begonnen. Vor allem wird die Schuldfrage noch weitaus eingehender und ausführlicher erörtert werden. Die Stimme Hoggans wird dabei nicht zu überhören sein.
Neue Deutsche Beamtenzeitung
Selbst „Der Spiegel” schreibt über den „sechs Sprachen beherrschenden US-Professor” Hoggan, daß er „das ausführlichste Quellenmaterial” vorweise, „das je ein wissenschaftliches Werk über den Kriegsausbruch von 1939 stützte. Allein das Literaturverzeichnis polnischer Werke zählt 134 Quellen auf. Das ausführliche Buch der deutschsprachigen Kriegsschuldforschung Walther Hofers ,Die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges’ nennt nur drei polnische Titel”.
GRABERT-VERLAG TÜBINGEN
Reverend Peter H. Nicoll, M. A., B. D.
Englands Krieg gegen Deutschland
Die Ursachen, Methoden und Folgen des Zweiten Weltkriegs
588 Seiten, mit 32 Bildtafeln und Lebensübersichten
führender Staatsmänner,
Anmerkungen und Literaturverzeichnis, Ganzleinen DM 38.-
Urteile:
Das Buch ist eine Tat, und ich kann nicht genug die Klarheit und ethische Glut der Darstellung rühmen. Hier fährt einmal ein reinigender Blitz in eine von Heuchelei und Lügen verdunkelte Atmosphäre. Das tausendfach verratene Gewissen der Menschheit richtet sich im Protest dieses Mannes auf und man begegnet beglückt dem tiefen Verantwortungsernst, der nicht mit zweierlei Maß mißt, sondern Unrecht Unrecht nennt, auch wenn es nicht Deutschland, sondern seinen Gegnern zur Last fällt.
Der Dichter Friedrich Franz von Unruh
Der moralische Mut des Verfassers ist geradezu einzigartig und für die heutige deutsche Haltung beschämend. Sie haben sich durch die Publikation dieses Buches ein außerordentliches Verdienst erworben.
Der Verleger Dr. Adolf Spemann
Nicoll muß zu den großen ausländischen Historikern gezählt werden, die nach dem Zweiten Weltkrieg in umfassenden Untersuchungen nachweisen halfen, daß Deutschland nicht der Schuldige am Zweiten Weltkrieg gewesen ist.
Nation Europa
Mit lutherhaftem Mut und mit der Überzeugungskraft der Wahrheit spricht dieser Mann, der zwei Söhne im Luftkampf gegen Deutschland verloren hat, dieses Deutschland von der Kriegsschuld frei.
Deutsche Wochen-Zeitung
Das Buch Nicolls ist ein außergewöhnliches Buch. Es wird Gegner und Anhänger finden und heftige Diskussionen auslösen. Eines aber wird man dem Verfasser nicht vorwerfen können, daß er sich nicht bemüht habe, gerecht, sachlich und objektiv zu urteilen.
Blick und Bild
Das Buch ist ein weiterer bedeutsamer Markstein auf dem Wege zur Klärung der Kriegsschuldfrage. Die Wahrheit dringt langsam, aber unaufhaltsam durch.
Der Eckartbote, Wien
GRABERT-VERLAG TÜBINGEN
####
Vier gegen zwei
Vor fünfundvierzig Jahren legte die DEUTSCHE WEHRMACHT die Waffen nieder. Roosevelt hatte seinen Plan “der bedingungslosen Kapitulation” mit Hilfe Churchills durchgesetzt. Amerikas gewaltiges Waffenpotential zwang Deutschland in die Knie. Franklin Delano Roosevelt, Domestik des amerikanischen Banker- Imperialismus, der nach einen plausiblen Vorwand gesucht und ihn auch gefunden hatte, um in das europäische Kriegsgeschehen mithandelnd eingreifen zu können, führte nun eine “Siegermacht” an. Churchill und Stalin triumphierten gleichermaßen. Den Konferenzen von Casablanca, Teheran und Jalta folgte Potsdam. Doch blenden wir auf ein vier Jahre davor liegendes Treffen zurück, das am 14, August 1941 auf dem britischen Schlachtschiff “Pince of Wales” stattgefunden hatte. Churchill und Roosevelt sprachen hier die Grundsätze ihrer zukünftigen Kriegs- und Nachkriegspolitik miteinander ab. In Artikel 2 ihrer Übereinkunft legten sie u.a. fest: Eigener Verzicht auf fremdstaatliche Gebietsaneignung bzw. keine Unterstützung bei territorialen Änderungen, die nicht mit dem frei zum Ausdruck gebrachten Wunsch der betreffenden Völker übereinstimmen; Artikel 3 regelt die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Völker bei der Wahl ihrer Regierungsformen und bei der Regelung territorialer Streitigkeiten; Artikel 4 will Gleichberechtigung aller Staaten im Welthandel; Artikel 7 fordert die Freiheit der Meere. Insgesamt wurden 8 Artikel vereinbart, die in einem Dokument niedergelegt wurden, das unter dem Namen “Atlantikcharta” später ein wichtiges UN-Statut bilden sollte und teilweise in den Artikel 24 der UN- Charta eingeflossen ist.
Nach Abschluß des Potsdamer Abkommens von 1945 mußten die Deutschen erfahren, daß das Papier nicht die Tinte wert war, mit der die “Atlantikcharta” von Churchill und Roosevelt unterzeichnet worden war: Die Sowjets kassierten ungefragt Königsberg und das nördliche Ostpreußen; Polen schob seine Westgrenze bis an Oder und Neiße vor. Die Deutschen durften keine andere als die ihnen aufgezwungene westliche Regierungsform annehmen und wurden “demokratisiert”.
Siegerwillkür unterwarf sich entwaffnete Machtlosigkeit!
Inzwischen sind, wie schon gesagt, 45 Jahre vergangen. Fast ein halbes Jahrhundert. Die erste Nachfolgegeneration in Deutschland befestigte die übernommene demokratische Staatsform und übertrug deren “Spielregeln” auf alle nur möglichen Gesellschafts- und Lebensbereiche. Waren nicht die Besiegten - so jedenfalls sollte es von der jüngeren Generation verstanden werden - im Laufe der Jahre zu Partnern der ehemaligen Sieger geworden? Hitler- Deutschland gab es nicht mehr. Die ehemals Besiegten hatten sich von ihren Siegern zu willfährigen Unfreien umerziehen lassen. In sinnvernebelnder Wortumdeutung gestatteten sie ihren deutschen Heloten, ihre Besatzungstruppen in Truppenstationierungen “befreundeter Verbündeter” umbenennen zu dürfen. Arglose Nachgeborenen hatten so für die Präsenz fremder Truppenteile auf deutschem Grund und Boden zumindest fürs erste eine dürftige Erklärung.
Die, die einst den Krieg hautnah miterlebt hatten, Männer und Frauen auf beiden Seiten, sind heute Großväter und Großmütter Inzwischen sind viele von ihnen an gesundheitlich schwerwiegenden Folgen, die der 2. Weltkrieg als unheilbare Krankheitsspur bei ihnen äußerlich wie innerlich hinterlassen hatte, verstorben.
Fünfundvierzig Jahre sind eine lange Zeit. Diejenigen, die als Staatsführer, Militärs oder Diplomaten unmittelbar das Kriegsgeschehen in Europa mitbeeinflußten oder es gar steuerten, leben ebenfalls nicht mehr:
Roosevelt starb als einer der ersten. Churchill, Stalin, Hitler, De Gaulle und Mussolini sind ebenfalls tot. Ihnen ins Grab folgte im Verlauf der Zeit die erste Garnitur ihres Mitarbeiterstabes: Ihre Außenminister und Generäle.
Heute, 1990, bestimmt nirgendwo auf der Welt auch nur eine einzige Person, die unmittelbar und direkt am politischen Weltgeschehen während der Jahre von 1933 -1945 an maßgeblicher Position mitgewirkt hat, die Geschicke seines Landes.
Die Sieger von gestern sind tot! Die Besiegten von gestern gibt es nicht mehr!
Und doch werden in diesen unseren Tagen auf makabre Weise die Toten von 1945 wiederbelebt! Dem nach 1945 gebräuchlichen und zu Recht angewandten Begriff SiEGERMÄCHTE wurde neuer Odem eingehaucht. Sonderbar, wo doch das neue (viergeteilte Deutschland als nachrangig unbedeutender Staat seit vier Jahrzehnten friedlich und fleißig sein erarbeitetes Nationaleinkommen an alle Welt als “Wiedergutmachung” verteilt, wie ihm aufgetragen? Das Wiedervereinigungsstreben der beiden deutschen Teilstaaten “BRD” und “DDR” vereinigt die modernen Staatsführungen der USA, Frankreichs, Englands und der UdSSR in der Formel “zwei plus vier”. Plötzlich sitzen nicht mehr “gleichrangige” Partner einander am (Friedens-)Verhandlungs1isch gegenüber, sondern die vier(?) SIEGERMÄCHTE den von ihnen selbst ins Leben gerufenen zwei “Staaten”: der “BRD” und der “DDR”.
Das heutige Deutschland wurde auf seinen Platz verwiesen. Wer in Deutschland heute noch glaubt - und das gilt auch für Österreich - daß wir in unseren deutschen Ländern über Souveränität und Gleichberechtigung in Verfolg ureigenster Interessen verfügen, der wird an den leicht ablesbaren künftigen Geschehen, das Deutschland, seine Wiedervereinigung und eine Lösung der Ost-Grenz-Frage betrifft, einsehen müssen: Deutschland ist auch in der nun heranwachsenden dritten Generation eine geschlagene, eine besiegte Nation. Die Sieger von einst haben es uns selbst verraten: Wir haben sie gefälligst als SIEGERMÄCHTE zu bezeichnen!
G.A.Bosse